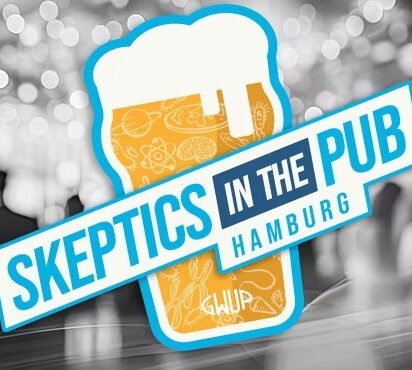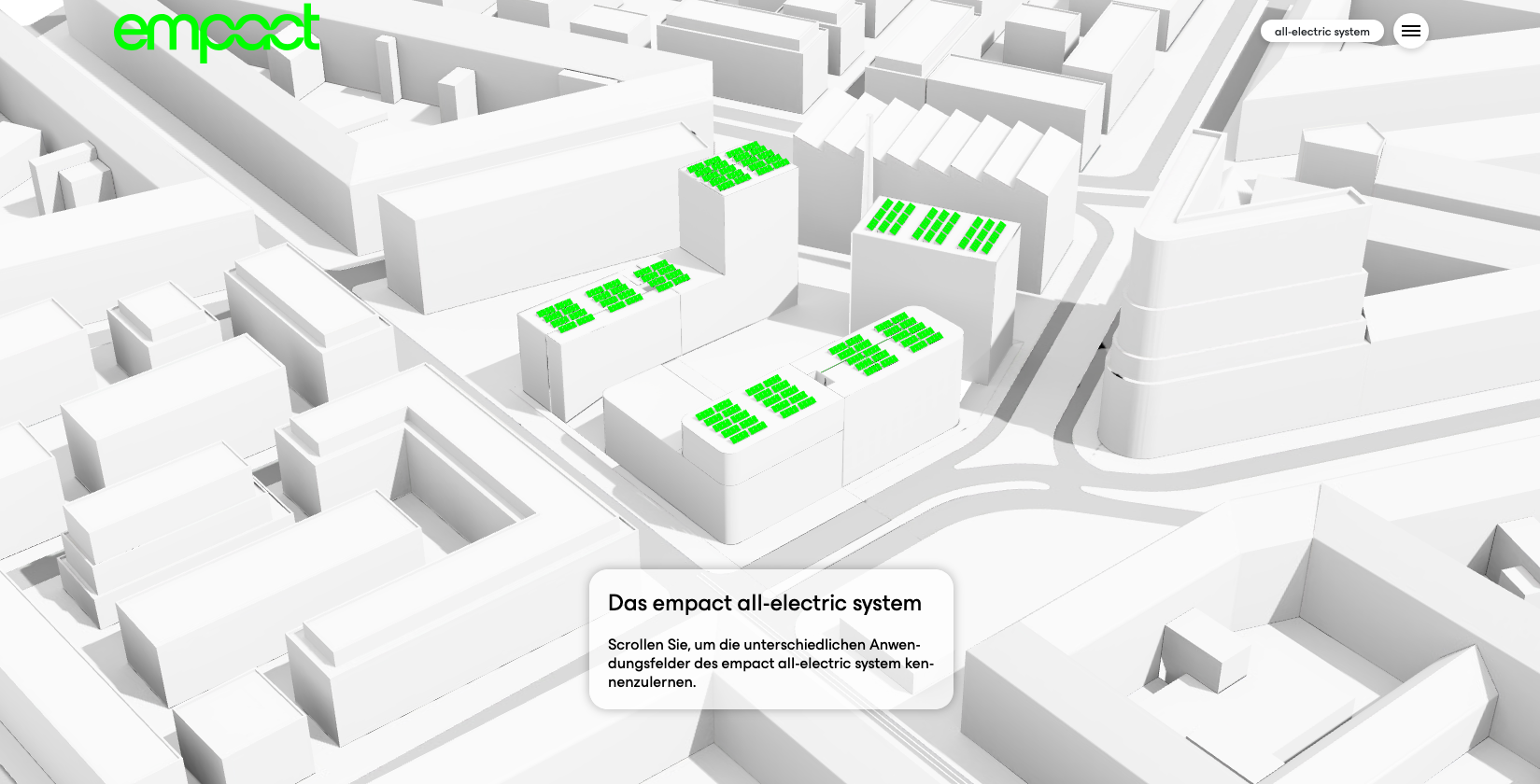Fichtner: E-Fuels sind kein Freifahrtschein für Verbrenner
Batterie statt E-Fuel: Warum Prof. Dr. Fichtner den direkten Weg zur Klimaneutralität bevorzugt und weshalb wir dafür mehr Vertrauen in Forschung brauchen. Der Beitrag Fichtner: E-Fuels sind kein Freifahrtschein für Verbrenner erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.
Er ist einer der meistzitierten Batterieforscher weltweit, hat über 400 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, mehr als 20 Patente angemeldet – und bleibt bei all dem immer auch ein neugieriger Erklärer: Prof. Dr. Maximilian Fichtner spricht im Podcast mit Tim Gabel nicht nur über Batterietechnologien, sondern auch über wissenschaftliche Neugier, gesellschaftliche Fehlannahmen und die Frage, warum Deutschland technologisch nicht zwangsläufig zurückliegen muss – sofern es seine Stärken gezielt nutzt.
Fichtners Karriere beginnt nicht im Hightech-Labor, sondern mit einem Chemiebaukasten unterm Weihnachtsbaum. „Da hat’s mich gepackt“, erinnert er sich. Es folgt eine ungewöhnliche Wissenschaftsbiografie, die von Umweltanalytik über Wasserstoffspeicher bis zu elektrochemischen Grenzfragen reicht. Immer wieder betont er: Wirklich gute Forschung beginnt mit präzisen Fragen – und mit dem Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen.
Ein wiederkehrendes Motiv des Gesprächs ist die Kluft zwischen Forschung und Anwendung. Fichtner erklärt, wie schnell sich im Labor faszinierende Ergebnisse erzielen lassen – und wie trügerisch daraus abgeleitete Erwartungen sein können. „Nur weil etwas einmal funktioniert, ist es noch lange kein marktfähiger Prozess.“ Es bedarf Jahre, oft Jahrzehnte, bis eine neue Technologie von der Idee zur industriellen Realität werde. In der Öffentlichkeit – und nicht selten in der Politik – fehlt dieses Verständnis.
Warum technische Lösungen mehr erfordern als Labore
Ein prägendes Beispiel liefert er gleich mit: In Zusammenarbeit mit Bayer entwickelte seine damalige Forschungsgruppe einen hocheffizienten Reaktor, der die Jahresproduktion einer Chemikalie in nur sechs Wochen ermöglichen sollte. Der industrielle Durchbruch blieb aus – nicht wegen technischer Probleme, sondern weil der Betriebsrat befürchtete, dass zu viele Arbeitsplätze wegfallen könnten. „Ein Paradebeispiel dafür, wie politische und soziale Interessen technische Machbarkeit ausbremsen“, so Fichtner.
Trotz solcher Erfahrungen bleibt er der Wissenschaft verpflichtet. Besonders eindrücklich ist seine Beschreibung jener Momente, in denen Forschung wirklich Grenzen verschiebt. Etwa, als sein Team begann, nicht mehr mit positiv geladenen Lithium-Ionen zu arbeiten – dem etablierten Prinzip moderner Batterien – sondern mit negativ geladenen Chlorid- oder Fluoridionen. „Einfach mal den Spieß umdrehen“, sagt Fichtner. Das Ergebnis: funktionierende Anionenbatterien – eine Tür, die zuvor niemand geöffnet hatte. „Und wenn du eine Tür aufgestoßen hast, dann bleibt sie offen. Das ist das Schöne an Wissenschaft.“
In der industriellen Praxis ist die Lithium-Ionen-Batterie weiterhin das Maß der Dinge. Und das aus gutem Grund: Seit ihrer Markteinführung 1991 hat sich ihre Energiedichte vervierfacht, gleichzeitig sind die Kosten um den Faktor 50 gesunken. Heute treiben Lithium-Akkus Elektroautos an, versorgen Smartphones und speichern Solarstrom. Und doch arbeitet Fichtners Team längst an Alternativen – Magnesium, Natrium, Calcium. „Wir haben diese Rohstoffe direkt vor der Haustür, sie sind günstig und gut verfügbar – wir müssen nur lernen, sie richtig einzusetzen.“
Gerade Magnesium könnte für Europa ein strategischer Rohstoff sein. Die sogenannte Dolomit-Formation der Schwäbischen Alb, so Fichtner, sei ein riesiges, bislang unterschätztes Potenzial. Der Vorteil: kein geopolitisches Risiko wie bei Lithium, kein toxisches Material, keine Importabhängigkeit von instabilen Regionen. „Das wäre unsere Chance, unabhängig zu werden – technologisch wie politisch.“
Am E-Auto führt in puncto Effizienz kein Weg vorbei
Auch die Frage der Effizienz treibt ihn um. Fichtner rechnet vor: Ein Elektroauto benötigt für 100 Kilometer etwa 16 Kilowattstunden Energie, ein vergleichbarer Diesel rund 60 Kilowattstunden. Der Grund: Während beim Verbrenner 70 bis 80 Prozent der Energie in Form von Wärme verloren gehen, kommt beim Elektroantrieb der Großteil direkt an den Rädern an. „Wer die Energiewende ernst meint, kommt an der Batterie nicht vorbei“, so sein Fazit. Auch zur Stabilisierung der Stromnetze bei schwankender Einspeisung aus Wind und Sonne seien Batterien ein zentrales Element.
Was ihn besonders ärgert, ist ein hartnäckiges Missverständnis: Elektroautos seien „nicht wirklich sauber“, weil ihre Batterien so energieintensiv in der Herstellung seien. „Das ist zu kurz gedacht“, sagt Fichtner. Zwar verursache die Batterieproduktion zunächst hohe CO₂-Emissionen – etwa durch die Herstellung der Elektroden und globale Rohstofftransporte –, doch das sei nur ein Teil der Wahrheit. In der Fachsprache spricht man vom CO₂-Rucksack, den ein E-Auto zu Beginn seiner Lebenszeit mit sich trägt. Entscheidend sei, wie lange und mit welchem Strom das Auto betrieben wird.
Denn während ein Verbrenner bei jedem Kilometer weiter CO₂ ausstößt, verbessert sich die Klimabilanz eines Elektroautos mit jedem gefahrenen Kilometer. Je nach Fahrzeugtyp und Energiequelle liegt der sogenannte Break-even-Punkt – also der Moment, in dem das E-Auto klimafreundlicher als ein Verbrenner fährt – zwischen 20.000 und 60.000 Kilometern. „Danach fährt das Auto klimatisch ins Plus“, so Fichtner. Durch optimierte Produktionsprozesse und den Einsatz von Grünstrom lasse sich dieser Wert deutlich senken. Ein in Texas gefertigtes Model 3, das vollständig mit erneuerbaren Energien produziert wurde, überschreite die kritische Schwelle laut Fichtner bereits nach 8500 Kilometern.
Doch nicht nur der CO₂-Rucksack wird kleiner – auch die Lebensdauer der Akkus wächst. Fichtner verweist auf Serienfahrzeuge, die nach Hunderttausenden von Kilometern kaum Degradation zeigen. Der oft bemühte Vergleich mit alternden Smartphone-Akkus greife zu kurz: „Ein Handyakku ist ein völlig anderer Anwendungsfall – schlechter gekühlt, weniger intelligent gesteuert. Autobatterien sind darauf ausgelegt, über viele Jahre zu funktionieren.“ Einige Hersteller garantieren mittlerweile Laufleistungen von bis zu einer Million Kilometern – ohne nennenswerten Kapazitätsverlust.
Für Fichtner ist klar: Die Kritik an der Batterie ist nicht nur überzogen, sondern basiert häufig auf falschen technischen Annahmen. „Wenn wir wirklich über Nachhaltigkeit sprechen wollen, müssen wir die gesamte Lebensdauer betrachten – nicht nur die Herstellung.“ Die Batterie sei keine Übergangstechnologie, sondern das Fundament für eine effiziente, klimaverträgliche Mobilität der Zukunft.
Effizienz statt Wunschdenken: Was E-Fuels nicht leisten können
Ein Thema, das Fichtner besonders kritisch sieht, ist die aktuelle Euphorie rund um sogenannte E-Fuels – synthetische Kraftstoffe, die mit grünem Strom und CO₂ aus der Luft erzeugt werden. In politischen Diskussionen und öffentlichen Debatten gelten sie häufig als rettende Lösung für den Fortbestand des Verbrennungsmotors. Die Vorstellung: Bestehende Fahrzeugflotten könnten weiterbetrieben werden, ohne das Klima zusätzlich zu belasten. Fichtner widerspricht entschieden. „Dieser Satz, dass wir mit E-Fuels unsere Bestandsflotte klimaneutral betreiben können, enthält gleich mehrere Denkfehler“, stellt er klar.
Zwar sei die Herstellung solcher Kraftstoffe technisch möglich. CO₂ kann mithilfe von Direct-Air-Capture-Verfahren aus der Atmosphäre gewonnen, Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff gespalten und anschließend mit CO₂ zu synthetischen Kohlenwasserstoffen umgewandelt werden. Doch was in der Theorie elegant klingt, scheitert laut Fichtner an den physikalischen Realitäten: „Der Energieeinsatz ist gewaltig – und die Verluste entlang der gesamten Prozesskette sind enorm.“ Bei jedem Umwandlungsschritt geht ein großer Teil der eingesetzten Energie verloren.
Im Vergleich zur direkten Nutzung von Strom im Elektroauto schneiden E-Fuels deshalb äußerst schlecht ab. Während batterieelektrische Antriebe rund 70 bis 80 Prozent der eingesetzten Energie in Fortbewegung umsetzen, erreichen E-Fuels laut Fichtner kaum mehr als 10 bis 15 Prozent. „Am Ende bleibt energetisch kaum etwas übrig“, bringt er es auf den Punkt. Hinzu kommen hohe Produktionskosten, begrenzte Verfügbarkeit und der Bedarf an riesigen Mengen grünen Stroms. Selbst wenn E-Fuels in größerem Maßstab verfügbar wären – für den Pkw-Bereich wären sie laut Fichtner weder ökologisch noch wirtschaftlich darstellbar.
Sein Fazit: Im Straßenverkehr führt auf absehbare Zeit kein Weg am batterieelektrischen Antrieb vorbei. E-Fuels könnten dort sinnvoll sein, wo Elektrifizierung technisch kaum umsetzbar ist – etwa in der Luftfahrt oder im maritimen Schwerlastverkehr. Als pauschaler Freifahrtschein für den Weiterbetrieb von Verbrennern im Alltag taugen sie aus seiner Sicht nicht. „Die physikalische Realität lässt sich nicht wegdiskutieren“, sagt Fichtner. Wer Klimaziele ernst nimmt, müsse den effizientesten Weg gehen – und der führe nicht über Umwege, sondern direkt über den Akku.
Im über drei Stunden langen Gespräch merkt man: Fichtner ist kein Technikeuphoriker, sondern ein analytischer Realist. Er plädiert für eine faktenbasierte Debatte, in der Batterietechnologien nicht ideologisch überhöht oder politisch instrumentalisiert werden, sondern als das betrachtet werden, was sie sind: ein Schlüssel zu mehr Energieeffizienz, Rohstoffsouveränität und Klimastabilität. „Wissenschaft funktioniert nicht wie ein Start-up-Pitch“, sagt er. „Es geht nicht darum, möglichst viel zu versprechen, sondern möglichst sauber zu arbeiten.“
Sein Appell an Deutschland: nicht versuchen, China bei der Lithium-Ionen-Batterie zu überholen – sondern eigene Wege gehen, frühzeitig in neue Materialsysteme investieren und die Stärke der eigenen Forschung konsequent ausspielen. „Wir sind nicht schlechter. Wir stellen nur oft die falschen Fragen.“
Quelle: Tim Gabel – Prof. Dr. Fichtner: Die Wahrheit über E-Autos und Batterien
Der Beitrag Fichtner: E-Fuels sind kein Freifahrtschein für Verbrenner erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.












:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/56/34/563474ec61bdfb1aa8f68d563b0cd683/0122087849v1.jpeg?#)