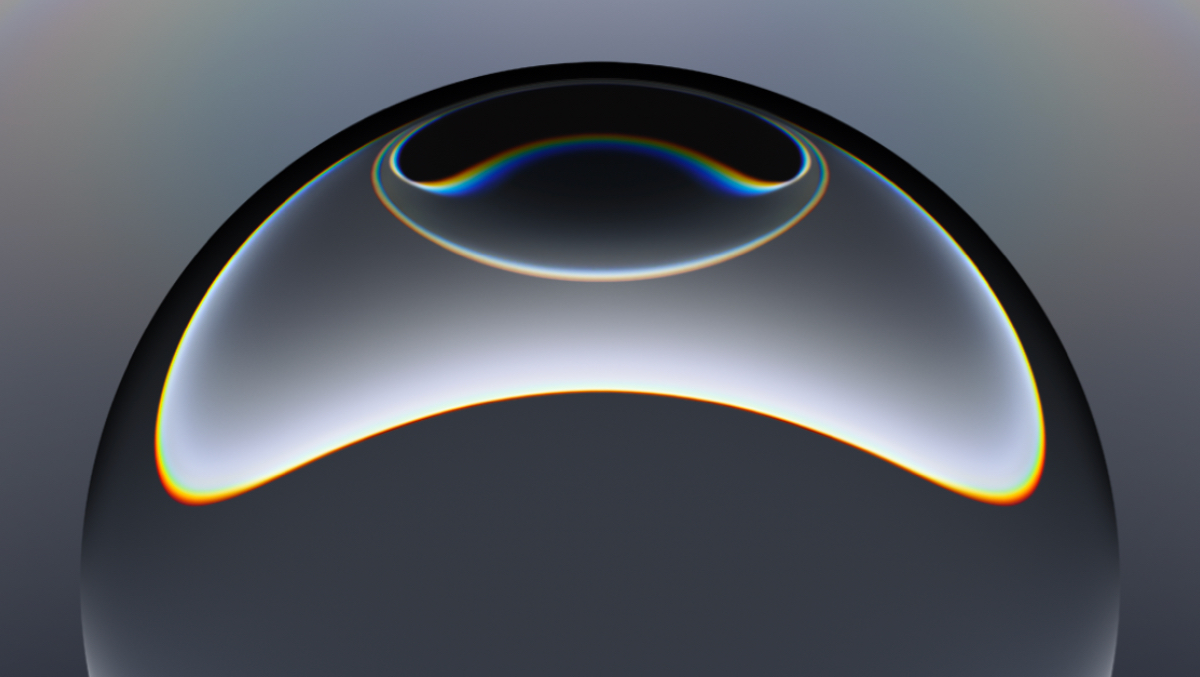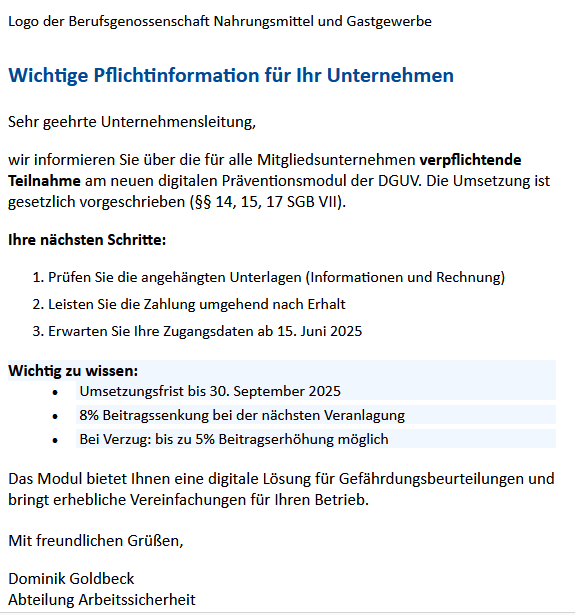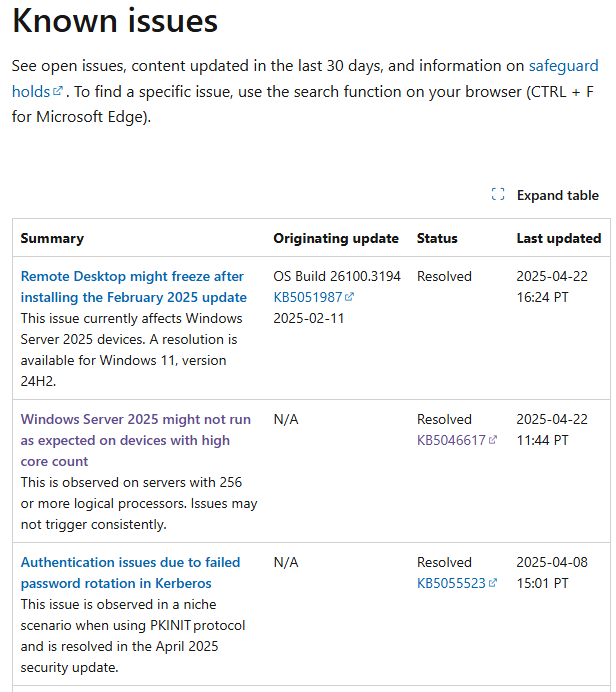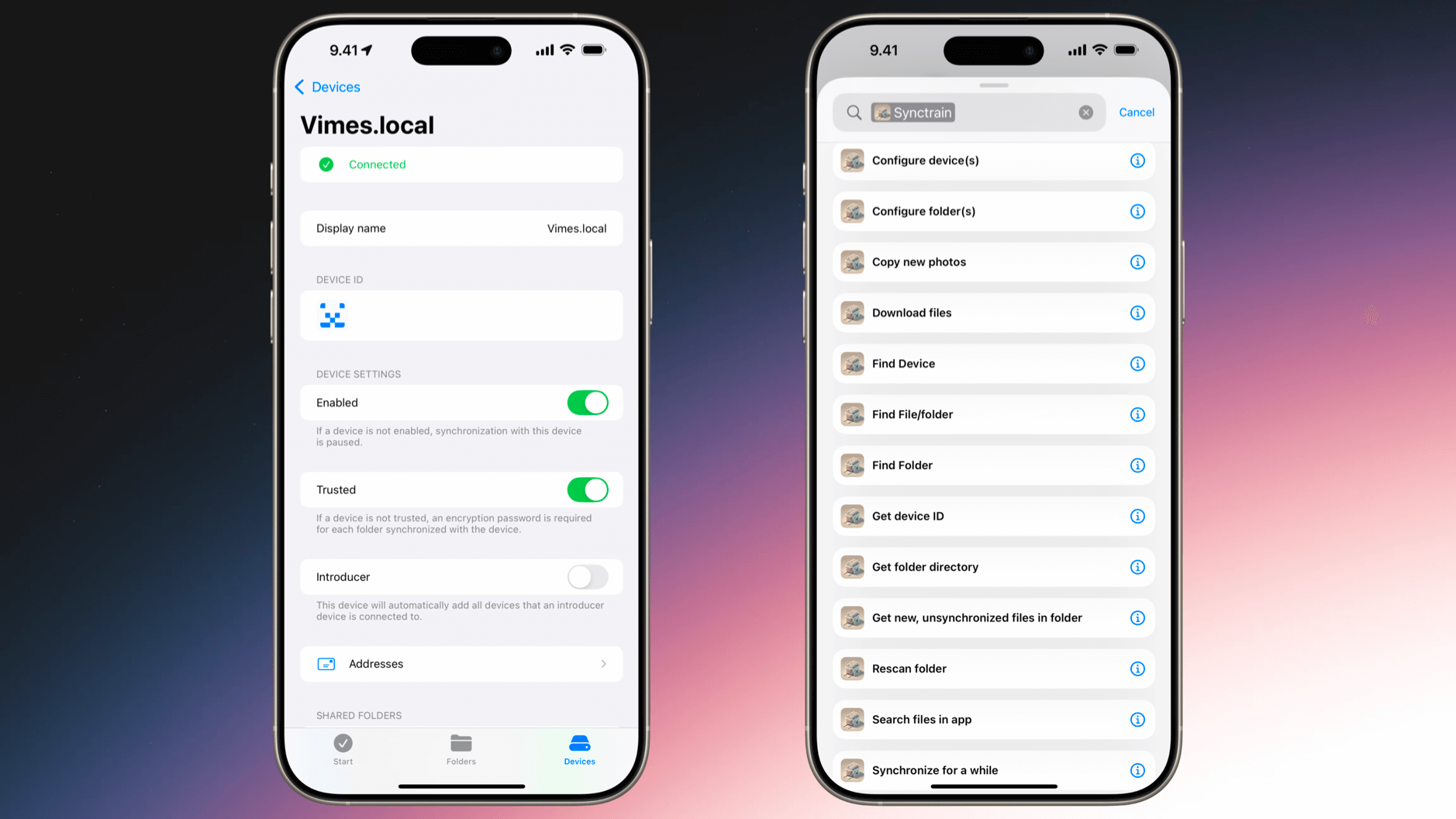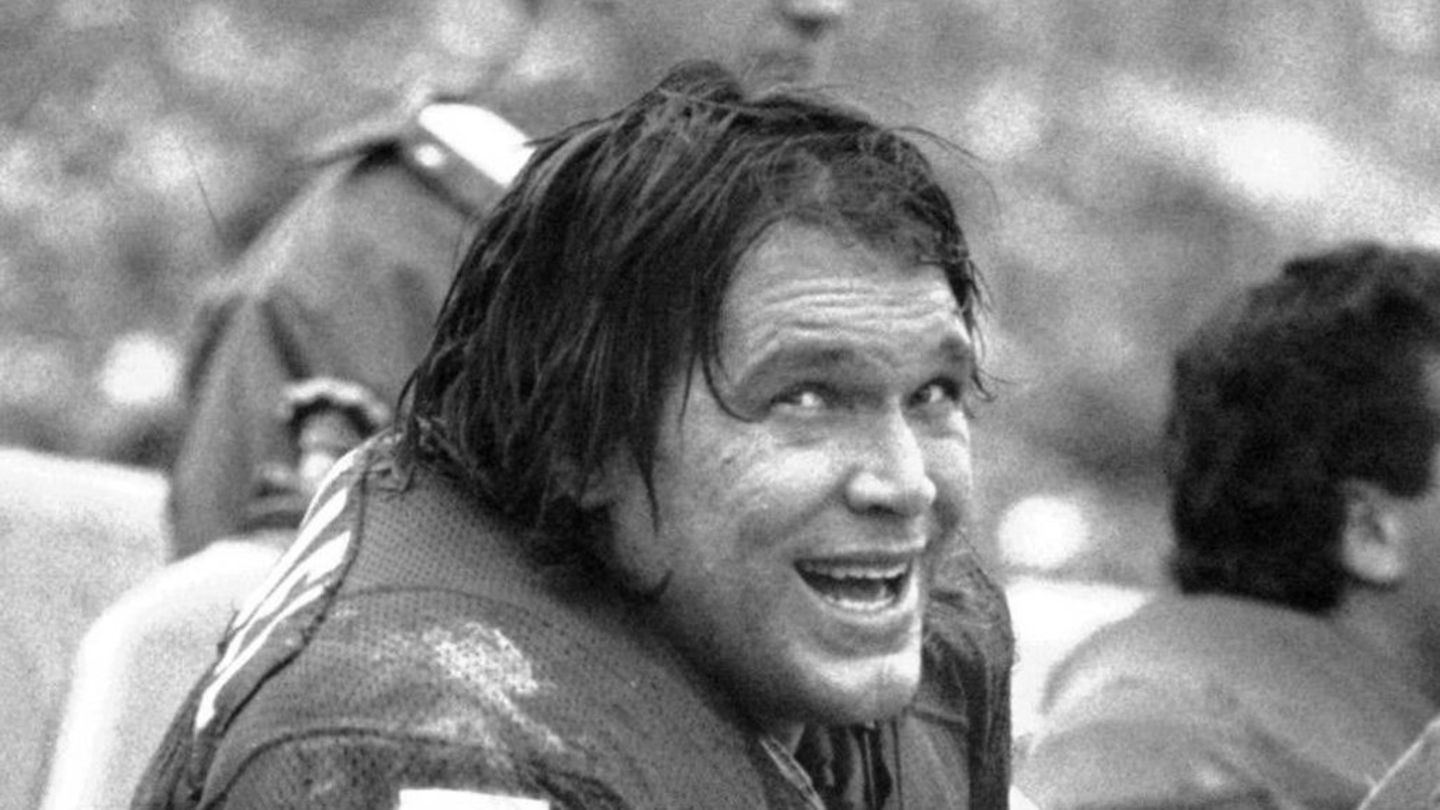Branchenverbände: Stromnetz nicht bereit für Elektro-Lkw
Der Herstellerverband ACEA und Eurelectric fordern die Politik dazu auf, europäische Stromnetze auf schwere elektrische Nutzfahrzeuge vorzubereiten. Der Beitrag Branchenverbände: Stromnetz nicht bereit für Elektro-Lkw erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.

Hersteller- und Elektrizitätsverbände fordern die Politik dazu auf, die europäischen Stromnetze auf Elektro-Lkw und andere elektrische Nutzfahrzeuge vorzubereiten: Der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) und Eurelectric, ein Branchenverband der europäischen Elektrizitätswirtschaft, haben ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht, in dem die Verbände den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge fordern.
Aktuell werde der Ausbau insbesondere entlang der TEN-T-Korridore und an wichtigen Standorten in Städten und Depots durch Netzbeschränkungen, langwierige Genehmigungsverfahren und regulatorische Engpässe gebremst. Der TEN-T-Korridor („Trans-European Transport Network“) ist Teil eines europaweiten Plans, um das Verkehrsnetz der EU zu verdichten und zu modernisieren, um den Güter- und Personentransport zu optimieren.
„Ohne ein zukunftsfähiges Netz wird dieser Übergang einfach nicht gelingen“
ACEA und Eurelectric weisen darauf hin, dass die CO2-Reduktionsziele für schwere Nutzfahrzeuge bis 2030 einen starken Anstieg emissionsfreier Lkw und Busse erfordern. Vor diesem Hintergrund unterstreichen die beiden Verbände in ihrem Papier die entscheidende Rolle der Verteilernetzbetreiber und fordern einen vorausschauenden, nachfrageorientierten Ansatz für Netzinvestitionen. „Ein zweckmäßiges Ladenetz für schwere Nutzfahrzeuge ist für die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs unerlässlich. Aber ohne ein zukunftsfähiges Netz wird dieser Übergang einfach nicht gelingen“, so Thomas Fabian, Chief Commercial Vehicles Officer des ACEA. „Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, um einen effektiven und effizienten Übergang zu einem emissionsfreien Straßenverkehr auf unserem Kontinent zu gewährleisten“.
In dem Papier werden mehrere politische Empfehlungen ausgesprochen, darunter mehr Transparenz durch harmonisierte Netzkapazitätskarten, straffere Genehmigungsverfahren, vorausschauende Investitionen und flexible Anschlussmodelle. Außerdem betonen die Verbände die Notwendigkeit, das Aufladen im Megawattbereich zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Strompreise die Wettbewerbsfähigkeit elektrischer Lkw und Busse unterstützen.
Verkehrsministerium schreibt den Ausbau des Lkw-Schnellladenetzes aus
Aktuell verursacht der Straßengüterverkehr in Deutschland rund ein Drittel der CO2-Emissionen des Verkehrssektors. Die Bundesregierung und die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur haben aufbauend auf dem Klimaschutzprogramm 2030 und dem Gesamtkonzept für klimafreundliche Nutzfahrzeuge im Oktober 2022 umfassende Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Ladeinfrastruktur II beschlossen, um die Elektrifizierung des schweren Straßengüterverkehrs auf der Fernstrecke zu ermöglichen. Dazu gehört auch der Aufbau eines Lkw-Schnellladenetzes entlang der Fernverkehrsstrecken sowie die Unterstützung des Aufbaus einer Lkw-Ladeinfrastruktur in Depots und Logistikhubs.
Im September 2024 haben das Verkehrsministerium (BMDV), die Autobahn GmbH des Bundes und die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur ein Vergabeverfahren zum Aufbau eines Lkw-Schnellladenetzes entlang der Bundesautobahnen gestartet. Gegenstand der Ausschreibung ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb der Schnellladeinfrastruktur für Elektro-Lkw und -Busse auf rund 130 unbewirtschafteten Rastanlagen.
Das Lkw-Schnellladenetz soll mit insgesamt etwa 350 Standorten an unbewirtschafteten und bewirtschafteten Rastanlagen entlang der Bundesautobahnen den Weg zu einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und verlässlichen Ladeinfrastruktur für schwere elektrische Nutzfahrzeuge ebnen. Das Lkw-Schnellladenetz soll letztlich rund 4200 Ladepunkte umfassen, darunter Megawatt- und CCS-Ladepunkte, die den spezifischen Anforderungen des Schwerlastverkehrs gerecht werden.
Die Vergabe erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren, das von der Autobahn GmbH durchgeführt wird. Unternehmen, die über die wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen zur Planung, Errichtung und zum Betrieb der Ladeinfrastruktur verfügen, sind eingeladen sich für die Teilnahme am Verhandlungsverfahren zu bewerben – die Zuschlagserteilung soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 erfolgen. Die Ladeinfrastruktur soll sukzessive bis 2030 implementiert werden. Parallel zum Ausschreibungsverfahren werden aktuell bereits die notwendigen Netzanschlüsse für die Standorte beauftragt und hergestellt.
Fraunhofer-Untersuchung: Mehr als 90 Prozent der Lkw-Flotte lassen sich elektrifizieren
Konkrete Mindestziele für die öffentliche Lkw-Ladeinfrastruktur legt auch eine EU-Verordnung für alle EU-Mitgliedsstaaten fest: In Deutschland müssen bis 2025 insgesamt 32 Lkw-Ladeorte bereitstehen, bis 2027 bereits 104. Bis 2030 sollen 314 Lkw-Ladestandorte hierzulande verfügbar sein. Laut dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI dürfte die erforderliche Gesamtladeleistung für Elektro-Lkw in Deutschland in diesem Jahr etwa 66 Megawatt erreichen, 2030 sollen bereits 918 Megawatt erforderlich sein. In der EU-Verordnung ist ebenfalls geregelt, dass Schnellladeinfrastruktur für batterieelektrische Lkw alle 60 bis 100 Kilometer entlang der wichtigsten deutschen Autobahnen zur Verfügung stehen muss.
Die Fraunhofer-Forschenden kamen im Rahmen des Forschungsprojekts HoLa im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass ein Startnetzwerk für Deutschland etwa 142 Ladestandorte umfassen sollte. Das zugrundeliegende Szenario sieht dabei vor, dass Lkw 2030 während der gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeitunterbrechung von 45 Minuten nach viereinhalbstündiger Fahrt nachgeladen und etwa 15 Prozent aller schweren Lkw batterieelektrisch betrieben werden. Allerdings gehen die Forschenden davon aus, dass maximal die Hälfte der Ladevorgänge an öffentlicher Ladeinfrastruktur stattfindet – die restlichen Ladevorgänge werden in Depots und Transporthubs durchgeführt.
Für das HoLa-Projekt wurden an fünf Standorten entlang der A2 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet insgesamt acht Hochleistungsladepunkte mit dem Megawatt Charging System (MCS) für Lkw aufgebaut und im realen Logistikbetrieb genutzt. Aus den Forschungsergebnissen wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die wichtige Erkenntnisse für einen flächendeckenden bundesweiten Ladeinfrastrukturausbau beinhalten. Im Projekt wurden Simulationen einer zukünftigen Elektro-Lkw-Flotte auf Basis vorliegender Fahrprofile von 2400 Diesel-Fahrzeugen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass sich bei einer Batteriegröße von maximal 700 Kilowattstunden im Jahr 2030 und 900 Kilowattstunden im Jahr 2050 durchgängig deutlich mehr als 90 Prozent dieser fiktiven Lkw-Fahrzeugflotte elektrifizieren ließen. Zudem würde den Forschenden zufolge für die Mehrheit der Ladevorgänge eine Langsam-Ladeinfrastruktur ausreichen – dabei würden die Elektro-Lkw in der Regel auf privatem Gelände mit maximal 44 Kilowatt geladen.
Quelle: ACEA – Pressemitteilung vom 15.04.2025 / Bundesministerium für Digitales und Verkehr – Pressemitteilung vom 16.09.2024 / Fraunhofer ISI – Pressemitteilung vom 07.03.2024
Der Beitrag Branchenverbände: Stromnetz nicht bereit für Elektro-Lkw erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.












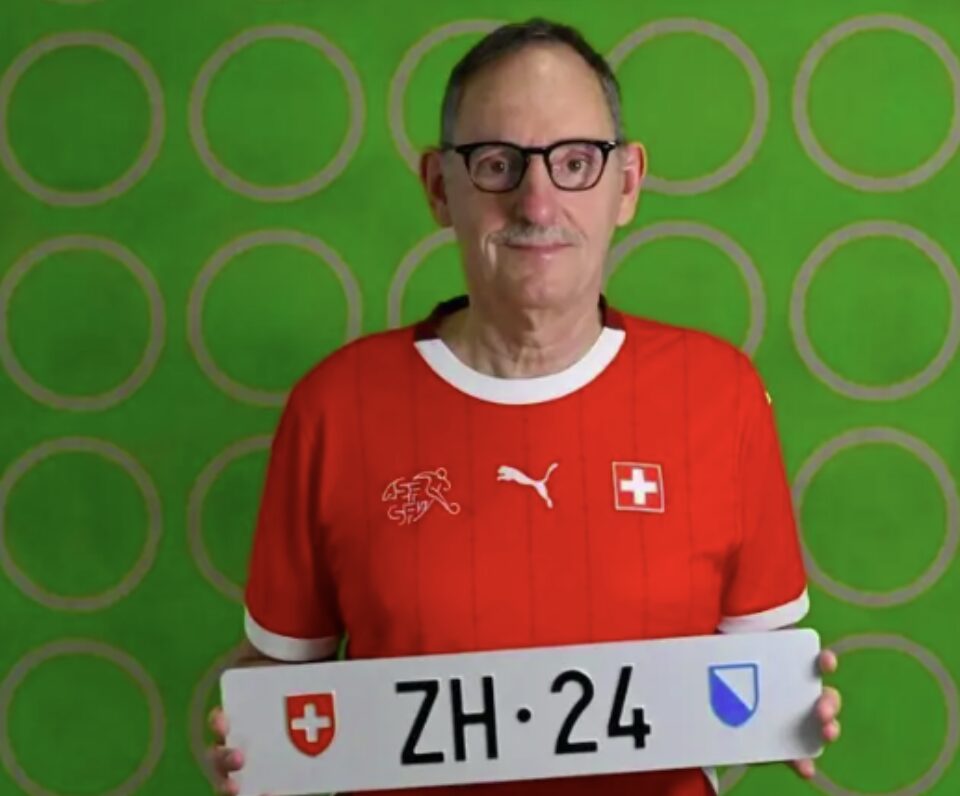
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ce/ae/ceae19b641fa0eda020c9e6bc7f34f39/0124273041v1.jpeg?#)