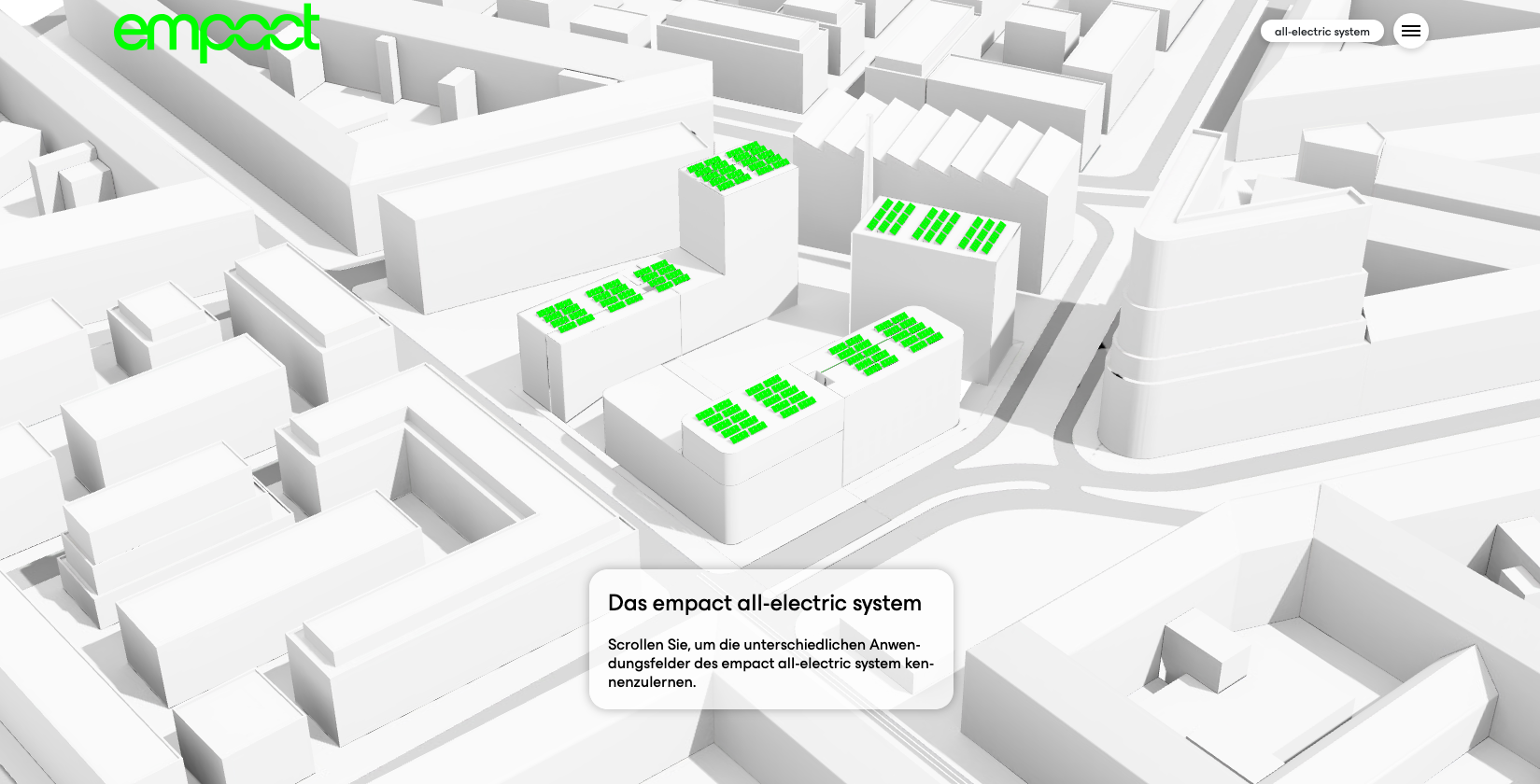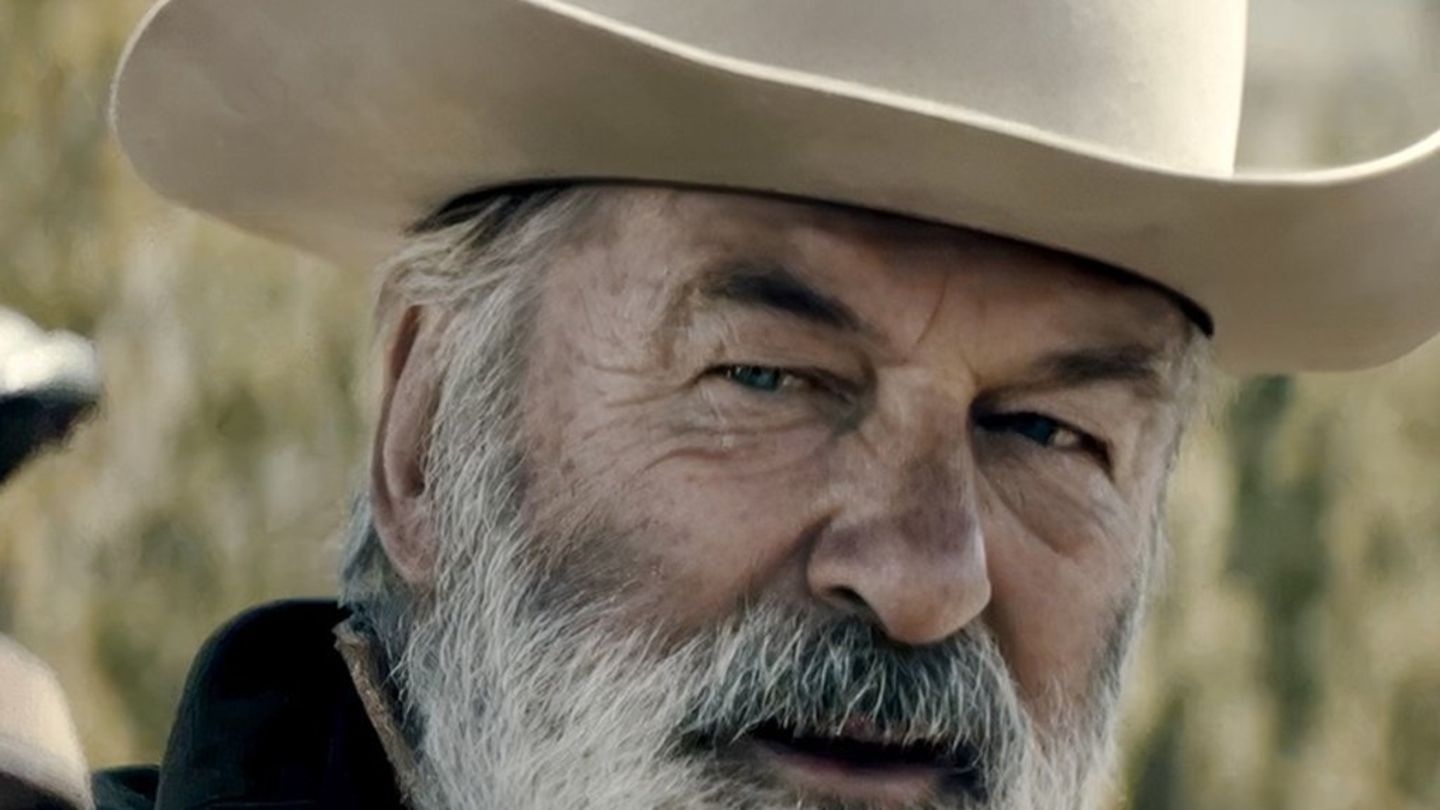Frühlingsbote: Vom Massenphänomen zur Rarität: Wo sind all die Maikäfer hin?
Einst gehörte er wie selbstverständlich zum Mai, war tausendfacher Frühlingsbote. Heute kennen ihn wenige Menschen aus eigener Anschauung. Was ist mit dem Maikäfer geschehen?

Einst gehörte er wie selbstverständlich zum Mai, war tausendfacher Frühlingsbote. Heute kennen ihn wenige Menschen aus eigener Anschauung. Was ist mit dem Maikäfer geschehen?
Viele kennen ihn bloß als schokoladigen Leckerbissen, der jedes Frühjahr in die Supermarktregale flattert. Oder aus den Streichen von Max und Moritz, die ihn heimlich unter der Bettdecke von Onkel Fritz platzierten. Oder aus den Erinnerungen der Großeltern, die ihn in Kindertagen fingen. Einen echten Maikäfer allerdings erblicken Menschen heute eher selten. Dabei waren die Insekten einst allseits vertraute Frühlingsboten.
Mit lautem Surren flogen sie in Gärten und auf Felder, krallten sich an Fensterrahmen, knisterten an Hosensäumen. Für viele Mädchen und Jungen war der Mai ohne Käfer kein richtiger Mai. Der Maikäfer, er war ein Tier, das man nicht suchen musste. Er war einfach da. Doch was ist passiert mit dem geflügelten Brummer? Warum ist er vielerorts verschwunden? Wie und wo lebt das Insekt überhaupt noch?
Zur Gattung Melolontha gehören rund 60 Arten, bei uns findet man hauptsächlich den Feldmaikäfer und den Waldmaikäfer. Der Lebenszyklus der Tiere ist so kurios wie faszinierend.
Die Larven der Maikäfer fressen Pflanzenwurzeln und verpuppen sich im Herbst
Die meiste Zeit ihres Daseins verbringen die Insekten im Dunkeln, unter der Erde: als Larven, Engerlinge genannt. Drei bis vier Jahre lang nagen die cremeweißen Tiere an den Wurzeln verschiedener Pflanzen. Dann, im Herbst, verpuppen sich die Engerlinge – in einer Tiefe von etwa einem Meter, machen eine Metamorphose durch und schlüpfen als erwachsene Käfer. Den Winter über harren die Sechsbeiner jedoch noch in der kalten Finsternis aus, in einer Puppenwiege. Erst im nächsten Frühjahr graben sie sich ins Freie, entfalten ihre braun glänzenden Flügeldecken und heben ab in die laue Luft. Früher machte der Maikäfer seinem Namen alle Ehre, heute – durch den Klimawandel – werden die Tiere immer früher rege und müssten inzwischen eher Aprilkäfer heißen.
Einmal der Erde entstiegen, steht nun ein kurzes, aber intensives Erwachsenenleben an, das weniger als zwei Monate dauert. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Die Männchen machen sich auf die Suche nach paarungsbereiten Weibchen, erschnüffeln potenzielle Partnerinnen mit 50.000 hochfeinen Sensoren an ihren gefiederten Antennen. Nach der Begattung legen die Weibchen bis zu 100 Eier pro Tier. Diese vergraben sie, oft mit einer Portion Kot als erste Babynahrung, im lockeren Erdreich. Nach ein paar Wochen schlüpfen aus den Eiern wieder Larven. Der Zyklus beginnt von vorn.
Früher kam es alle paar Jahre zu Massenaufkommen von Maikäfern. Zum Leidwesen von Land- und Forstwirten. Die Larven vertilgten die Wurzeln von Ackerpflanzen, vernichteten Getreidefelder, die Erwachsenen futterten ganze Bäume kahl. Daher bekämpfte man Melolontha jahrzehntelang mit Pestiziden – systematisch und flächendeckend. Noch bis in die 1950er-Jahre wurden Flugzeuge eingesetzt, die ganze Waldgebiete mit Insektiziden wie DDT überzogen. Maßnahmen, die den Maikäfer an den Rand der Ausrottung trieben. Die einst so häufigen Tiere wurden zu echten Raritäten.
Auch wenn solche Methoden in dieser Form inzwischen längst verboten sind, hat sich der Bestand der Maikäfer nie wieder vollständig erholt. Intensive Landwirtschaft, die Fragmentierung von Lebensräumen, der ununterbrochene Einsatz von Pestiziden haben dafür gesorgt, dass der Maikäfer weiterhin vielerorts fehlt. In manchen Regionen allerdings sind die Insekten heute wieder häufiger zu sehen, kommt es zu "Flugjahren", in die Käfer wieder in erfreulich großer Zahl umherschwirren.
Alte Rezepte künden von einer vergessenen kulinarischen Köstlichkeit: Maikäfersuppe
Dabei ist der Maikäfer mehr als ein nostalgischer Erinnerungsanker. Auch ökologisch spielen die Insekten eine Rolle – landen in den Mägen von Vögeln, Igeln und anderen Kleintieren, lockern Böden auf, sind Teil des komplexen Netzes biologischer Beziehungen. Dass man sie heute fast nur noch in naturbelassenen Gebieten findet, zeigt, wie empfindlich viele Arten auf menschliche Eingriffe reagieren. Und wie schnell und still das Verschwinden oft geschieht.
Früher, als er noch tausendfacher Frühlingsbote war, überall zugegegen, wurde dem Maikäfer auch eine ganz andere Ehre zuteil: Man aß ihn. In alten Rezeptbüchern findet sich etwa die "Maikäfersuppe" – mit in Butter gerösteten Insekten oder Engerlingen. Und Mitte des 19. Jahrhunderts konnte man in mancher Konditorei kandidierte Maikäfer kaufen – eine begehrte Nachspeise. Die Schokoversion des Insektes kam erst viel später in Umlauf, nachdem die echten Käfer bereits selten geworden waren.












:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d4/78/d478c1a9d756abef3c1532d6859a7a29/0123963507v2.jpeg?#)

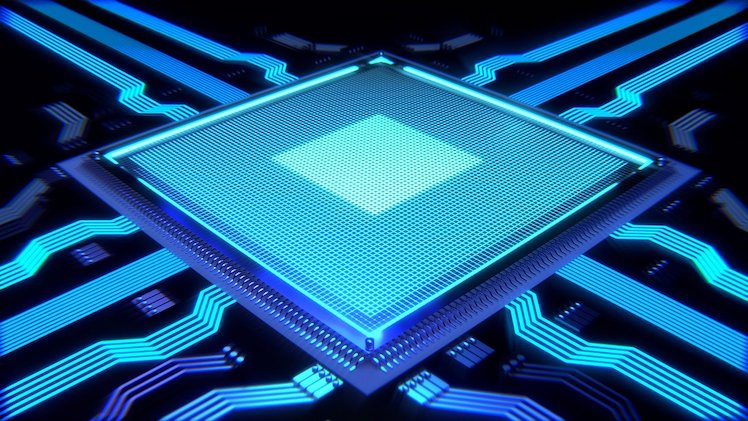



:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/56/34/563474ec61bdfb1aa8f68d563b0cd683/0122087849v1.jpeg?#)








![Wahlen in [LAND]: Rechtspopulist [NAME] gewinnt haushoch – Vorlage](https://dietagespresse.com/wp-content/uploads/2025/05/kopf.png)