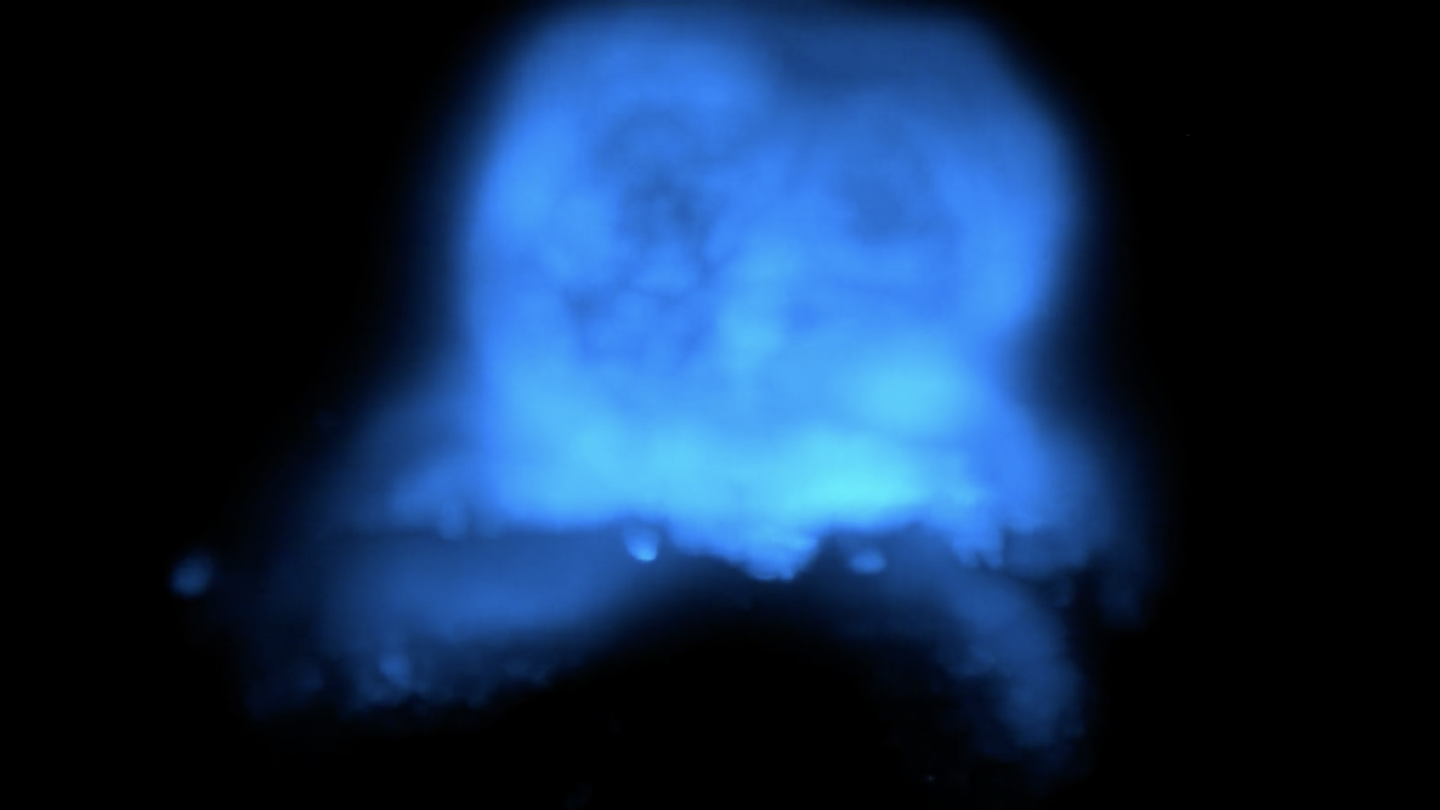Regeln als inhaltslose Verhaltensnormen? [Gesundheits-Check]
In der Süddeutschen Zeitung hat Sebastian Herrmann vor ein paar Tagen eine neue Studie von Granulo et al. vorgestellt. Armin Granulo arbeitet an der TU München am Lehrstuhl für Marketing, seine Koautoren Christoph Fuchs und Robert Böhm an der Uni Wien. Die Studie zeigt, dass Menschen neue Verhaltensregeln zunächst als Einschränkung ihrer Freiheit wahrnehmen, dann…
![Regeln als inhaltslose Verhaltensnormen? [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)
In der Süddeutschen Zeitung hat Sebastian Herrmann vor ein paar Tagen eine neue Studie von Granulo et al. vorgestellt. Armin Granulo arbeitet an der TU München am Lehrstuhl für Marketing, seine Koautoren Christoph Fuchs und Robert Böhm an der Uni Wien.
Die Studie zeigt, dass Menschen neue Verhaltensregeln zunächst als Einschränkung ihrer Freiheit wahrnehmen, dann die Vorteile sehen und doch akzeptieren. Beispiele sind etwa der Sicherheitsgurt oder die Rauchverbote. Die Autoren weisen darauf hin, dass man dies nutzen könne, indem man zu Beginn mehr den gesellschaftlichen Nutzen der Maßnahmen betont. Armin Granulo zieht das Fazit:
„Wer sich der psychologischen Mechanismen bewusst ist, kann die Reaktionen vieler Menschen, den Verlauf der Debatten und die Erfolgsaussichten von Gesetzen besser beurteilen und danach handeln.“
Es geht also um „psychologische Mechanismen“, d.h. um etwas hinter dem Rücken der betroffenen Subjekte und diese Mechanismen kann derjenige nutzen, der sich dessen bewusst ist. Das scheinen nicht die Betroffenen zu sein, sondern die, die Regeln erlassen und durchsetzen wollen. Die Autoren schreiben, „we provide causal evidence“, also hartes Faktenwissen darüber, wie Menschen funktionieren, aber eben nur die den Regeln ausgesetzten Menschen, nicht die Regelsetzer. Ob hier nicht eine sozialtechnologische Manipulationsstrategie propagiert wird. Vielleicht ist das das Wesen des Marketings, aber ist das gute Psychologie?
Und was bedeutet das für die Politik? Bei der Einführung des achtjährigen Gymnasiums in Bayern mit dem Schuljahr 2004/2005 gab es zunächst auch Kritik bei den Eltern, dann Akzeptanz und 2017 wurde die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium beschlossen. Psychologisch gesehen alles gut gelaufen?
Versucht man, die Einführung neuer Regeln aus der Sicht der betroffenen Menschen zu denken, leuchtet ein, dass wahrgenommene Einschränkungen der Freiheit zunächst Ablehnung motivieren und später erfahrener Nutzen dazu beiträgt, die Regeln anders zu bewerten. So weit so gut. Aber ist das wirklich unabhängig vom Inhalt der Regeln, wie die Autoren meinen? Gibt es keinen Unterschied zwischen der Gurtpflicht und – Extrembeispiel – der bei den Nazis geltenden Vorschrift, Juden an die Gestapo zu melden?
Wenn dem so wäre, wäre das nicht hochgradig alarmierend, weil es bedeuten würde, dass sich die normalen Menschen zumindest nicht ohne Weiteres der „psychologischen Mechanismen“, denen sie folgen, bewusst werden können, diese Mechanismen aber für beliebige Zwecke eingesetzt werden können? Und müsste man dann nicht an der Stelle fragen, was dazu beiträgt, dass sich die Menschen Gedanken über die konkreten Inhalte der Regeln machen, den blinden „Mechanismus“ der Reflexion und dem bewussten Handeln verfügbar zu machen, statt als „Mechanismus“ den politischen Planern anheimzustellen?
Am Ende des Artikels schreiben die Autoren:
„our findings highlight the complex nature of public reactions to system-level policies aimed at achieving socially desirable outcomes.“
Mir scheint, die Studie unterläuft eher die komplexe Natur menschlicher Reaktionen und sie verdeutlicht vielmehr, dass der Gegensatz zwischen demokratischem und potentiell autokratischem Denken manchmal auch in scheinbar nur „interessanten“ psychologischen Studien relevant wird. Es macht einen fundamentalen Unterschied, ob man Menschen mit „psychologischen Mechanismen“ zum vermeintlich gesellschaftlich nützlichen Verhalten bringen oder sie zur informierten Entscheidung befähigen will, wem man also das Heft des Handelns in die Hand gibt. Das gilt auch, wenn es um das Gute im Interesse aller geht.














:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/fe/8afe405b9e0c706205333d2a6f2a04d6/0124568746v2.jpeg?#)











,regionOfInterest=(803,483)&hash=ee34910273c3b33320cae745c8063b761de688e22aca492231891fb196d34717#)