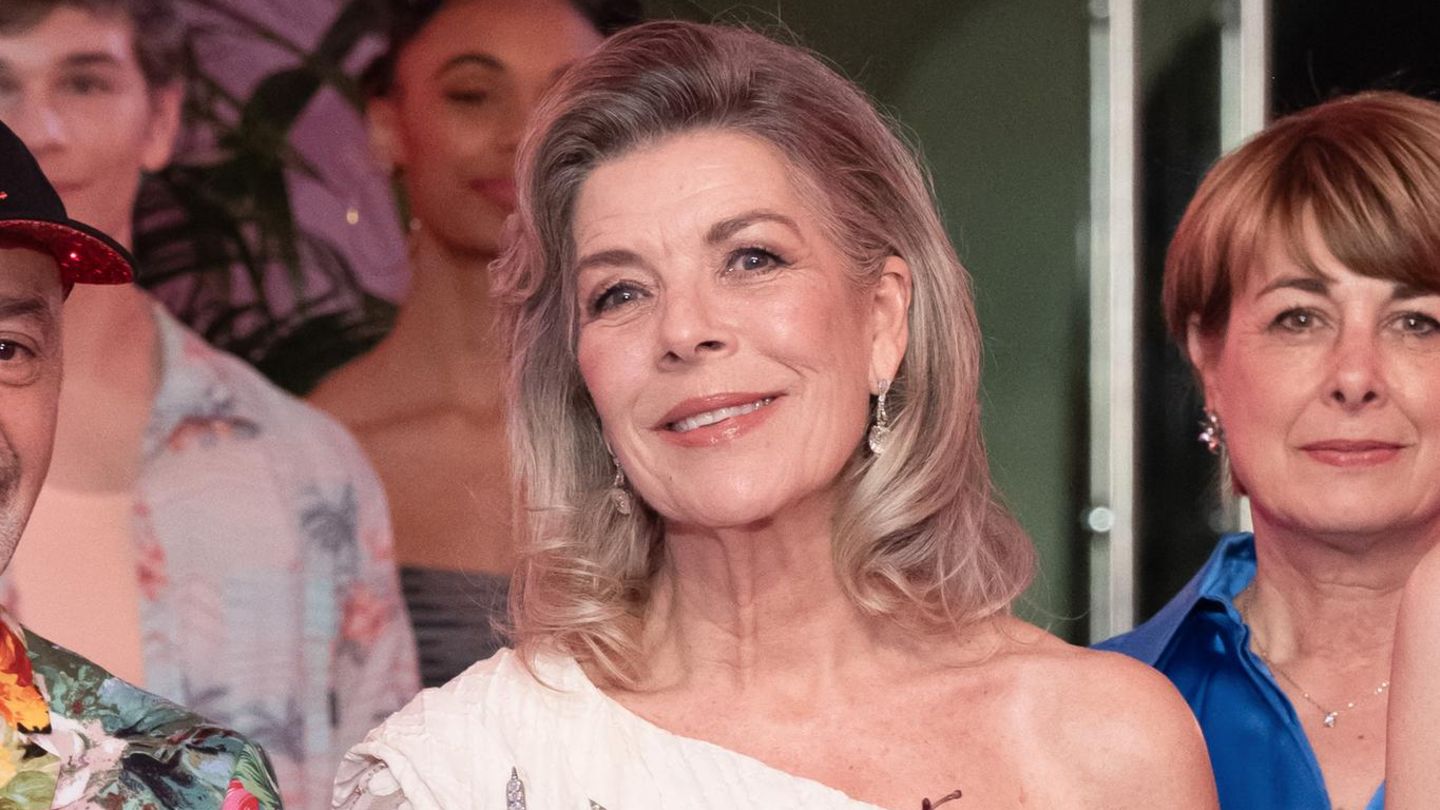Psychologie: Diese Methoden aus der Wissenschaft können auch bei Alltagsproblemen helfen
Im Laufe der letzten paar Jahrtausende haben Menschen in der Wissenschaft viel erreicht und hochkomplexe Probleme gelöst. Wie kommt es, fragt man sich da, dass wir die Methoden, die sie dazu bemüht haben, so selten auf unser Leben anwenden?

Im Laufe der letzten paar Jahrtausende haben Menschen in der Wissenschaft viel erreicht und hochkomplexe Probleme gelöst. Wie kommt es, fragt man sich da, dass wir die Methoden, die sie dazu bemüht haben, so selten auf unser Leben anwenden?
Das Leben erweist sich oft als überaus komplex und überwältigend, doch auf eines dürfen wir uns tendenziell verlassen: Als Menschen verfügen wir über die Voraussetzungen, es zu meistern. Seit mindestens 300.000 Jahren gibt es laut Fossilienfunden den Homo sapiens. Allein die Tatsache, dass wir heute noch existieren, berechtigt uns dazu, unsere Entwicklung als Erfolgsgeschichte zu betrachten – und uns als gut gewappnete, kompetente Lebewesen.
Ein zentrales Motiv der jüngeren Kapitel dieser Geschichte bildet die Wissenschaft. Wie selbstverständlich gehören die Ergebnisse, die wir ihr verdanken, heute zu unserem Alltag. Haben wir Kopfschmerzen, nehmen wir eine Ibu, suchen wir Kontakt, schreiben wir eine WhatsApp-Nachricht, haben wir Hunger, gehen wir einkaufen und bezahlen dafür mit Geld.
In einer ähnlichen Weise wie die Ergebnisse könnten uns auch einige Methoden aus der Wissenschaft durch den Alltag helfen. Schließlich dienen sie dem Anliegen, komplexe Probleme zu lösen. Sie sind entstanden aus Fehlversuchen und dem daraus Gelernten. Und ihre Nutzer sind Menschen. Folgende Standardstrategien aus der Wissenschaft könnten wir zumindest einmal ausprobieren, wenn wir uns von unserem hochkomplizierten Leben überfordert fühlen.
3 Methoden aus der Wissenschaft, die auch bei Alltagsproblemen helfen
1. Analogiebildung
Ein Standardverfahren in einigen Wissenschaften besteht darin, ein schwieriges, ungelöstes Problem in ein vergleichbares, bereits gelöstes zu verwandeln und von dort aus die Antwort zu suchen. In der Regel wenden wir dieses Verfahren intuitiv auch an, wenn wir eine Fremdsprache lernen: Zum Beispiel reichen uns meist ein bis zwei Sätze, um ein bestimmtes Verb korrekt zu verwenden. Haben wir einmal gehört "Ich sehe den Berg", können wir selbst schlussfolgern, dass es heißen muss "Ich sehe den Apfel", ohne diesen Satz je zuvor gehört zu haben. Von bekannten, gelösten Beispielen zu abstrahieren und die geltenden Regeln und Muster auf neue Probleme anzuwenden, hat sich wissenschaftlich bewährt und fällt uns weitaus leichter, als jede unbekannte Aufgabe als Einzelfall zu behandeln.
Im Alltag können wir die Methode oft und in vielfältiger Weise anwenden: Befinden wir uns etwa zum ersten Mal an einem neuen Ort, können wir uns daran erinnern, wie wir uns in der Vergangenheit eingelebt haben und nach ähnlichen Mustern vorgehen. Besteht ein Konflikt zwischen einer Person, die wir nicht gut kennen oder einschätzen können, können wir uns vorstellen, es wäre unsere Freundin oder Schwester, mit der wir schon viele Konflikte gelöst haben, und uns entsprechend verhalten.
2. Vergrößern
Ein Beispiel für eine Vorgehensweise, die Forschende in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen anwenden, finden wir in dem wohl berühmtesten Werk des griechischen Philosophen Platon: "Politeia", "der Staat". In dieser Schrift möchte Platon klären, was einen Menschen ausmacht und was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Da ihm das aus unterschiedlichen Gründen schwerfällt, entschließt er sich, zunächst zu überlegen, was einen Staat ausmacht und wie er organisiert sein müsste, um gut zu funktionieren – schließlich besteht ein Staat aus vielen, vielen Menschen. Was im Kleinen und im Einzelfall nicht zu erkennen ist, macht vielleicht das Große sichtbar, die Betrachtung einer Vielzahl von Fällen.
Anwenden können wir diese Methode besonders gut bei Alltagsproblemen, bei denen wir uns in Einzelheiten und Details verlieren. Wenn wir uns zum Beispiel Gedanken über eine Nachricht machen, die wir einer Person schreiben möchten, oder darüber, was wir jemandem sagen: Tun wir einfach mal so, als adressierten wir 20, 30 Menschen gleichzeitig. Das erleichtert uns, uns darauf zu konzentrieren, was wir eigentlich mitteilen möchten, anstatt uns damit aufzuhalten, was wir glauben, was in der anderen Person vorgeht.
Gewiss ist es nicht grundsätzlich falsch, auf einen Menschen ganz individuell und mit möglichst viel Empathie eingehen zu wollen. Aber letztlich können wir in den meisten Fällen doch nur raten – und oft erreichen wir mehr, wenn wir alle Beteiligten (inklusive uns) für sich sprechen lassen, als wenn wir vermuten und unterstellen.
3. Aus der Ausnahme eine Regel ableiten
Zu forschen bedeutet meist, viel zu experimentieren, ohne das erwartete oder gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und wenn dann doch mal etwas glatt läuft, heißt es: Unbedingt herausbekommen, was der entscheidende Schritt war, der die Rechnung hat aufgehen lassen. Die Psychologin Alice Boyes teilt in einem Beitrag für "Psychology Today" das Video eines Mathematikers, der erklärt, wie Wissenschaftler:innen zufällig geglückte Experimente zurückverfolgen.
Wie wir diese Methode im Alltag anwenden können, liegt beinahe auf der Hand: Anstatt es als glücklichen Zufall zu betrachten, wenn etwas wider Erwarten gut gelaufen ist, können wir schauen, was diesmal anders war. Warum hatten wir heute Morgen Spaß am Joggen, nennt Alice Boyes als Beispiel, wenn wir es sonst verabscheuen. Warum fühlen wir uns heute aufgeladen nach einem Abend in Gesellschaft, wenn wir sonst leer und ausgelaugt sind? Manchmal bestätigen Ausnahmen eine bekannte Regel – doch manchmal offenbaren sie eine unbekannte.











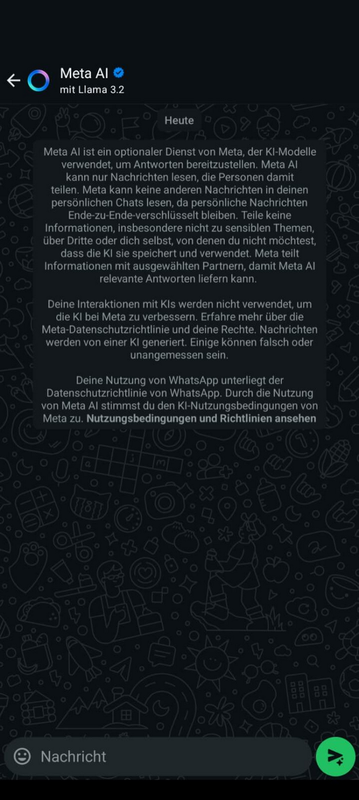








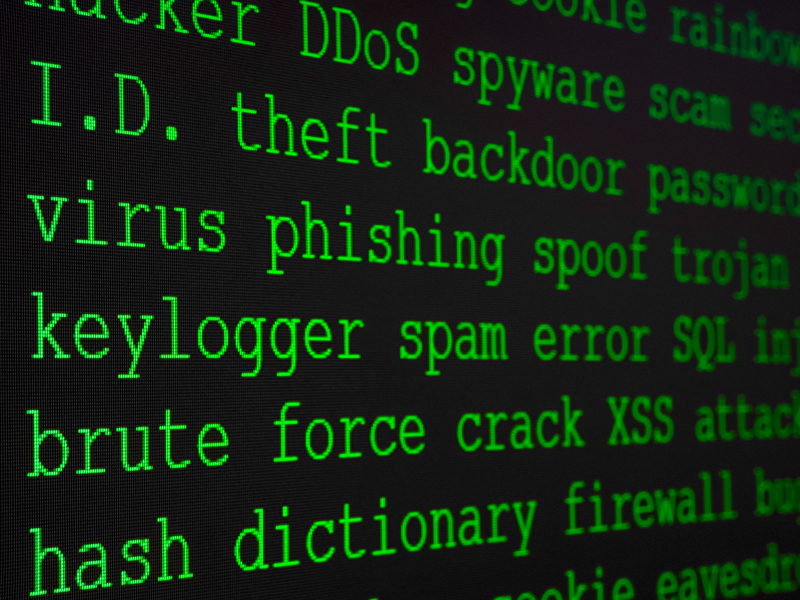

,regionOfInterest=(615,271)&hash=d495bddeca4a9924beae67c704b21a3980c383a1789d891fb6aae546d215533c#)
,regionOfInterest=(304,150)&hash=f4eabf6a9da0b65f4383d679ca1aa22780743e52a2ffee6f685c115ca62c1093#)
,regionOfInterest=(600,333)&hash=262dc11888560fc10453c318e6b699ab3b08208dfda3c80b0c790099181359ce#)
,regionOfInterest=(838,383)&hash=7e4394dd13fbe9af86907a38a58420cb9e70f7dbe5057a523b1561cbe7c3e7cc#)
















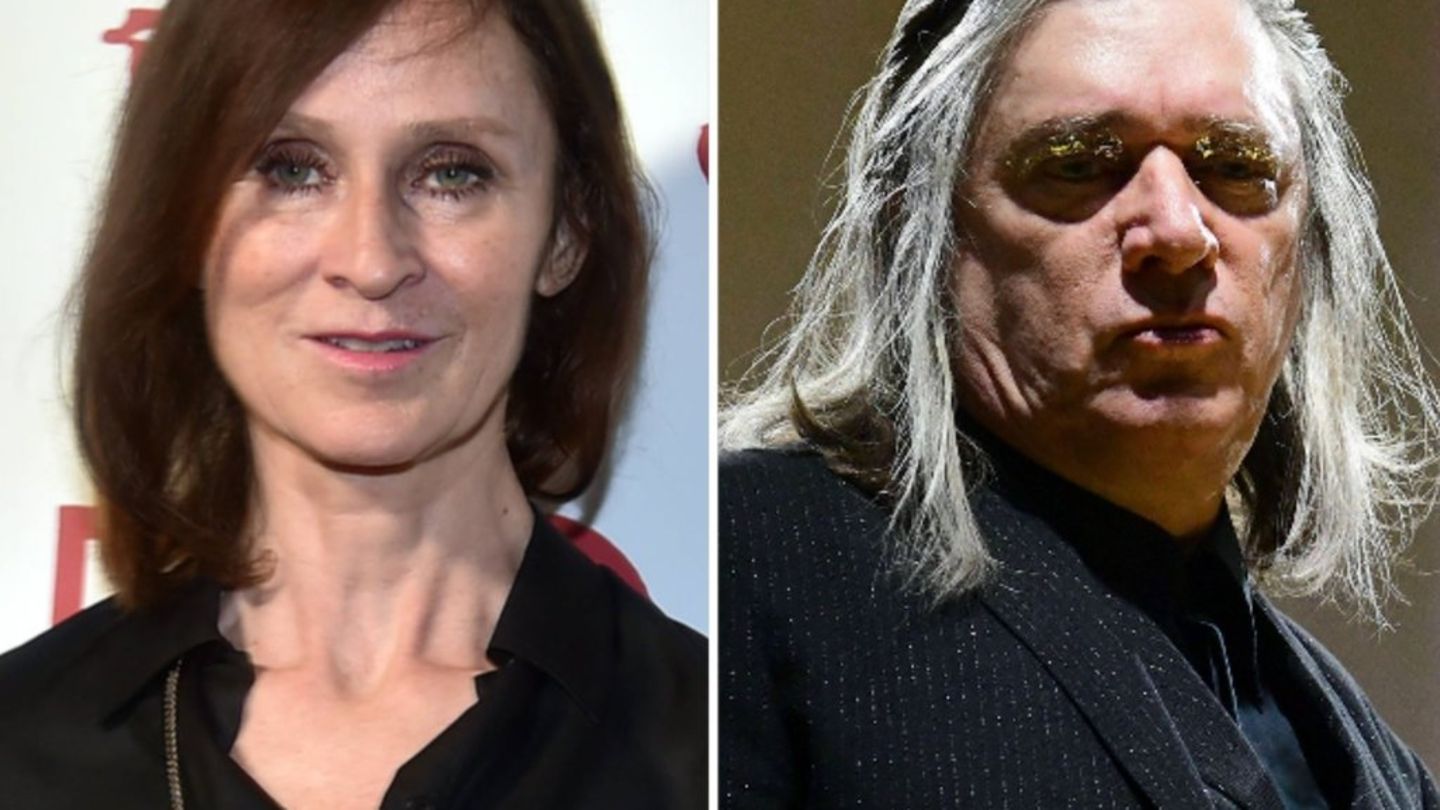
,regionOfInterest=(1261,855)&hash=e879372454f5da1784427df1856a0f824dc570a49f8fda6851b1bad811a83a50#)
,regionOfInterest=(1547,686)&hash=b66dc644b96ce2da5914c5b24190ddc83749eafb6a4ffd34f65935615c8eb7d3#)