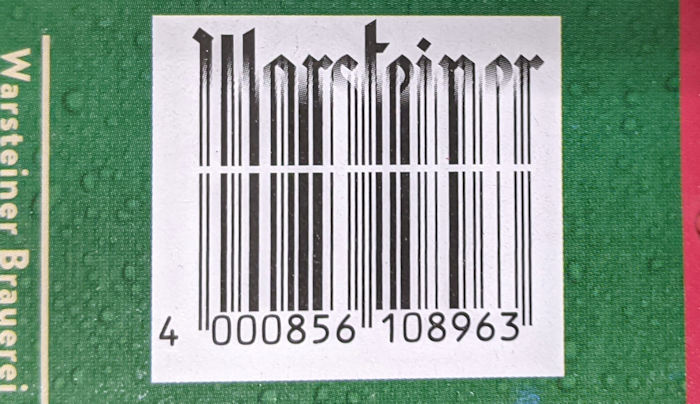Narrative der Urgeschichte: Zwischen Mythos und Wissenschaft | Wunderkammer der Kulturgeschichte
In Leif Inselmanns zweiteiliger Blogreihe "Narrative der Urgeschichte" widmet er sich den Fragen "Trieben Steinzeitjäger Pferde über Klippen?" und "Lebten Neandertaler besonders gefährlich?". Weiterlesen →

Narrative der Urgeschichte – so heißt die Artikelreihe auf Leif Inselmanns Blog Wunderkammer der Kulturgeschichte, die am vergangenen Samstag ihre Fortsetzung bekommen hat. In dieser Serie räumt Leif mit gängigen Mythen über die Frühzeit des Menschen auf. Zwei Beiträge gibt’s bisher, in die wir nachfolgend einen kurzen Blick werfen.
Lebten Neandertaler besonders gefährlich?
vom 03. Mai 2025
War das Leben der Neandertaler wirklich brutaler, rauer und gefährlicher als das unserer direkten Vorfahren? Diesem Thema geht Leif im zweiten Beitrag seiner Reihe nach. Das Bild vom ‚groben‘ Neandertaler hält sich:
Lange Zeit wurde der Neandertaler (Homo neanderthalensis) als wilder und primitiver Vorläufer des modernen Menschen dargestellt: Wo der Homo sapiens durch Verstand und Innovation brillierte, habe sich der robust gebaute Neandertaler durch Zähigkeit und rohe Kraft hervorgetan.
Auswertungen von Funden schienen dies zu stützen:
Doch galt es nach wie vor als gut belegt, dass Neandertaler offenbar gefährlicher lebten als unsere eigenen Vorfahren: Davon zeugen sollen ihre Knochen, vor allem Schädel, an denen sich auffällig oft Spuren schwerer Verletzungen finden.
Die Studie Patterns of Trauma among the Neandertals von Berger/Trinkaus aus 1995 verglich anhand von Fossilien stichprobenartig die Verletzungsmuster von Neandertalern mit den moderner Menschen:
Mit einer Prävalenz von Kopf-Hals-Traumata von nicht weniger als 30‒40 % scheinen männliche Neandertaler demnach einen besonders riskanten Lebensstil gepflegt zu haben. Viel zitiert wurde seitdem vor allem Berger/Trinkaus‘ Beobachtung, dass die Neandertaler-Population ein vergleichbares und ähnlich hohes Verletzungsmuster aufweise wie heutige amerikanische Rodeo-Reiter. Im Gegensatz zum intelligenteren Homo sapiens, der Fernwaffen aus sicherer Entfernung bevorzugte – so die mehr oder weniger explizite Schlussfolgerung – habe der Neandertaler sich mit Stoßspeeren auf unmittelbare Tuchfühlung zu gefährlichen Großtieren begeben, was regelmäßig schwere Verletzungen nach sich zog.
2018 gab es an der Uni Tübungen eine Studie, die
erstmals eine populationsstatistische Auswertung an einer großen Zahl Fossilien von Neandertaler und paläolithischen Homo sapiens sowohl mit als auch ohne Verletzungen vor[nahm], um das Vorkommen von Kopf- und Halstraumata auf einer repräsentativen quantitativen Ebene miteinander zu vergleichen.
Dies änderte die Sicht:
Anders als bei der Stichprobe von Berger/Trinkaus (1995), wo eine sehr kleine Anzahl Neandertaler-Fossilien mehreren holozänen und neuzeitlichen Homo-sapiens-Populationen gegenübergestellt wurde, zeigte sich nun also kein deutlicher Unterschied zwischen beiden Arten mehr. Dies galt auch dann, wenn man die Faktoren Geschlecht, Sterbealter und Erhaltungszustand der Fossilien einberechnete.
Leif schlussfolgert:
Zweifellos zeugen die vorliegenden Fossilien von einem Leben in der Altsteinzeit, das oft genug gefährlich und entbehrungsreich sein konnte – auch wenn sich aus verheilten Traumata erschließen lässt, dass beide Arten ihre Angehörigen pflegten und selbst schwere Verletzungen mitunter noch lange überleben konnten. Dass Neandertaler dabei nennenswert gewalttätiger oder risikofreudiger gewesen wären als ihre „modernen“ Cousins, geht aus den vorliegenden Daten aber nicht hervor.
Hier entlang geht’s zum vollen Artikel:
Trieben Steinzeitjäger Pferde über Klippen?
vom 24. April 2023
Ein dramatisches Bild: eine Horde wilder Pferde, die in panischem Galopp in den Abgrund stürzt – gejagt von urzeitlichen Menschen mit Fackeln und Speeren. Dieses Motiv ist in der Paläo-Kunst allgegenwärtig, nicht zuletzt dank des tschechischen Illustrators Zdeněk Burian. Aber: Hat sich das wirklich so abgespielt?
Das Bild von Steinzeitmenschen, die Pferde jagen, indem sie diese über einen Abhang treiben, gehört zweifellos zu den wirkmächtigsten Narrativen der populären Steinzeit-Rezeption.
Der Ursprung davon liegt in Frankreich:
Bereits 1866 wurden durch den Historiker Adrien Arcelin und den Geologen Henry de Ferry erste steinzeitliche Funde am Roche de Solutré gemacht. Unter anderem kamen bei den Ausgrabungen in einer altsteinzeitlichen Schicht zahlreiche Knochen von Tieren zutage, die offenbar von den Menschen des Eiszeitalters erlegt worden waren. Pferde machen hierbei rund 94 % der Faunenreste aus. Nach einer Erhebung Stand 1989 handelte es sich um die Überreste von mindestens 83 Tieren, wobei nur ein Bruchteil der mutmaßlichen Ausdehnung der Fundstelle überhaupt ausgegraben wurde.
Ein Roman war es, der diese Funde mit der Abgrundjagd in Verbindung brachte:
Diese tauchte erstmals 1872 in dem Roman Solutré ou les chasseurs de rennes de la France centrale („Solutré oder die Rentierjäger Zentralfrankreichs“) auf, den der Ausgräber Arcelin unter dem Pseudonym Adrien Cranile verfasste. Die Rekonstruktion des Jagdgeschehens basierte hierbei maßgeblich auf dem ethnographischen Vergleich mit der Bisonjagd, wie sie von Ureinwohnern Nordamerikas bezeugt ist. Von jenem Roman aus verbreitete sich die Darstellung in populären Darstellungen der Altsteinzeit und wurde bereits im 19. Jahrhundert zu einem der beliebtesten Motive der Paläo-Kunst.
Was sagt die heutige Forschung dazu?
Entgegen der ungebrochenen Beliebtheit des Sujets in der Kunst spielt die These der Abgrundjagd in der heutigen Forschung keine Rolle mehr. Tatsächlich entspricht sie weder dem bekannten Verhalten von Pferdeartigen, noch hält sie einem Abgleich mit den archäologischen Funden stand.
Aus den Knochenfunden lässt sich schließen:
Anhand der Vollständigkeit und Verteilung der Knochen ist davon auszugehen, dass die Tiere nicht über eine größere Strecke bewegt, sondern vor Ort getötet und geschlachtet worden sind. Ansonsten, sollte man meinen, hätten die Jäger die Tiere grob schon am Ort der Tötung zerteilt und die schwersten Knochen und fleischarme Stücke zurückgelassen, anstatt komplette Kadaver bis ins Jagdlager zu schleppen und erst dort auszunehmen.
Auch die Faunenreste selbst stützen die Hypothese einer Abgrundjagd nicht: In diesem Fall wären umfangreiche Knochenbrüche durch den tödlichen Sturz zu erwarten. Auch wenn sich solche nicht ganz sicher von postmortalen Frakturen (etwa durch Aasfresser oder das Aufbrechen zum Erreichen des Knochenmarks) unterscheiden lassen, so sind derartige Brüche unter den gefundenen Knochen doch insgesamt sehr selten.
Somit heißt es:
Ob die Praxis einer Abgrundjagd für Pferde oder andere Tiere an anderen Orten in der Altsteinzeit jemals Anwendung fand, lässt sich zwar prinzipiell nicht ausschließen, aktuell aber ebenso wenig belegen.
Zum kompletten Beitrag:
Zum Thema:
- Artikel: Leif Inselmann über eine Oster-Kontroverse in der altorientalistischen Forschung: „Glaubten die Babylonier an Tod und Wiederauferstehung des Gottes Marduk?“, GWUP-Blog vom 22.04.2025
- Blog: Wunderkammer der Kulturgeschichte
Hinweis:
- Falls ihr Ideen, Anregungen oder Empfehlungen habt bzw. selbst ein Gastkapitel für den GWUP-Blog schreiben möchtet, kontaktiert uns unter: blog@gwup.org.
- Wenn ihr noch nicht im Skeptischen Netzwerk angemeldet seid, möchten wir euch herzlich dazu einladen. Dort finden GWUP-Mitglieder und Interessierte eine Plattform für Diskussionen und Austausch rund um skeptische Themen:



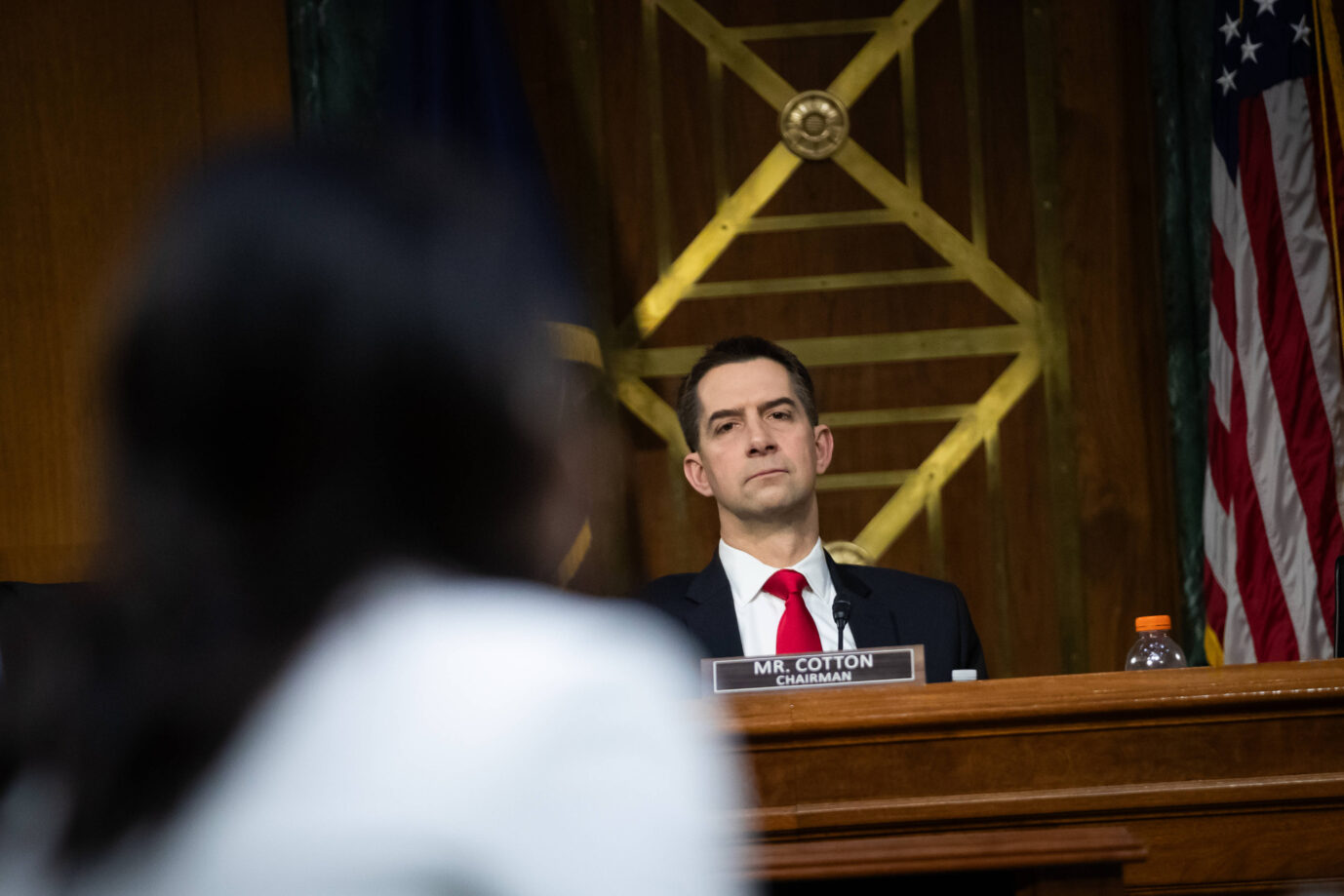
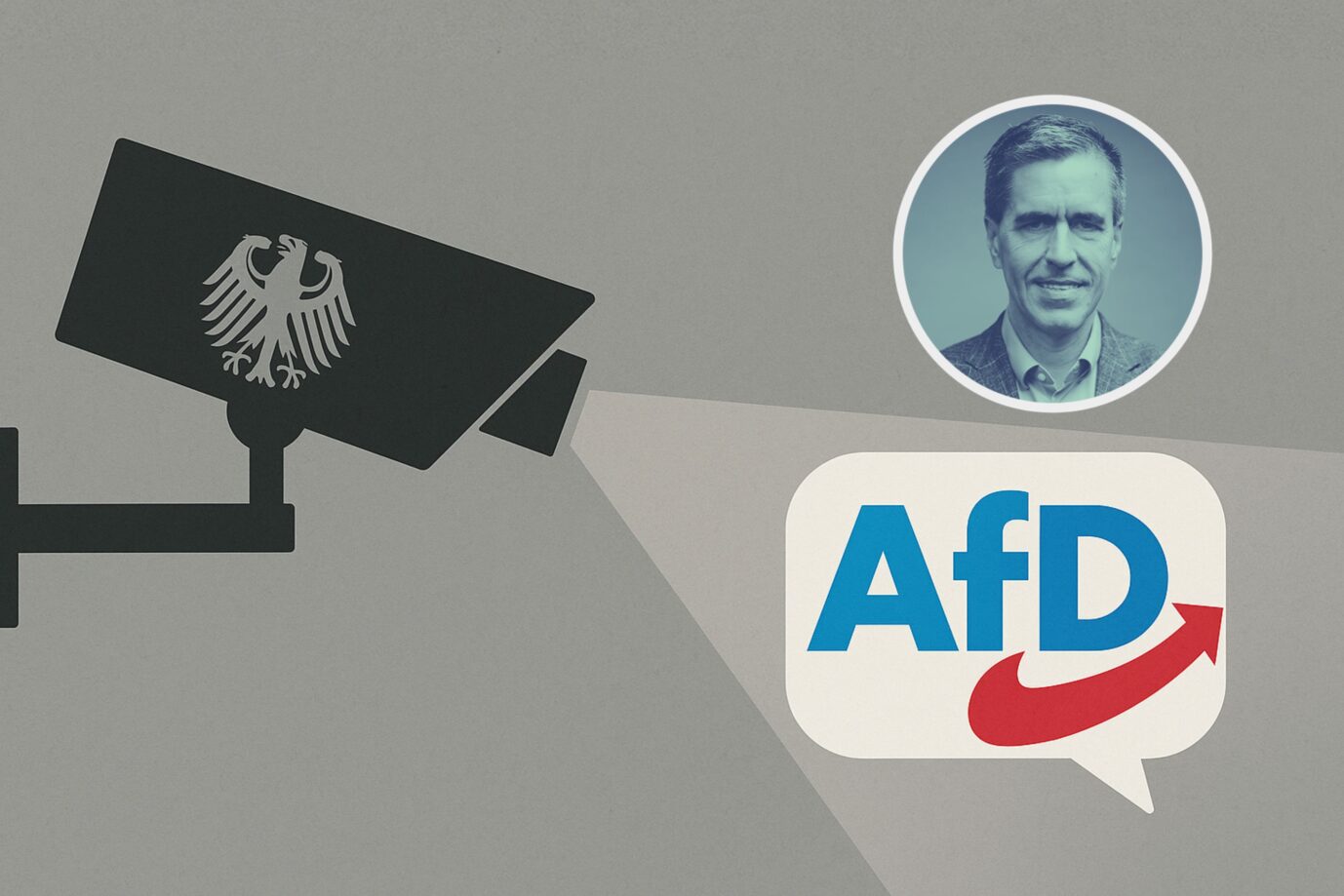








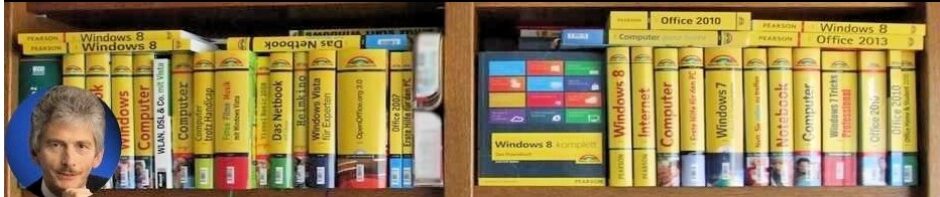
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fd/dc/fddc8fa7722e061a8a7ef4069fcc919d/0124514428v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0e/d2/0ed29d17a762cb690a41956daf7acaee/0124568503v1.jpeg?#)


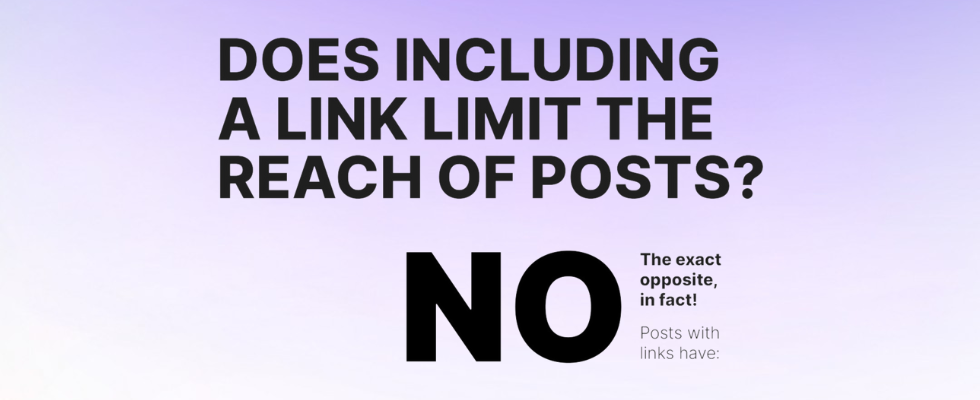





,regionOfInterest=(947,707)&hash=49b89cd6ce7bb49eb8b371420b8b92f210fcb630abea8a2ea147cc52ab10461d#)
,regionOfInterest=(971,633)&hash=fdb9b1ba44837b0295fe4d60b8159eaee1ef71626cb063c6f4c5dec59ab57708#)
,regionOfInterest=(472,352)&hash=45e63acebee17452210d0eb2b970d303ac07ac1a2af9426d7187553083c38747#)