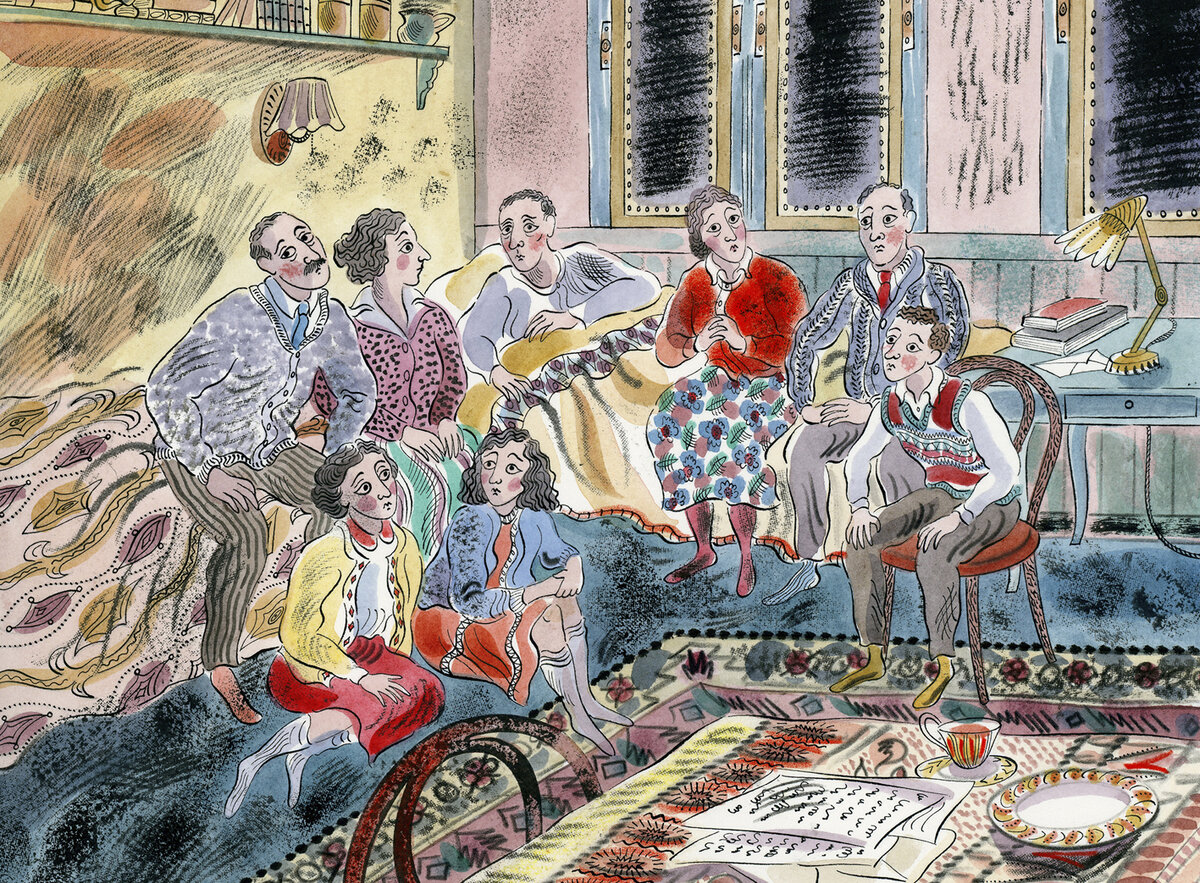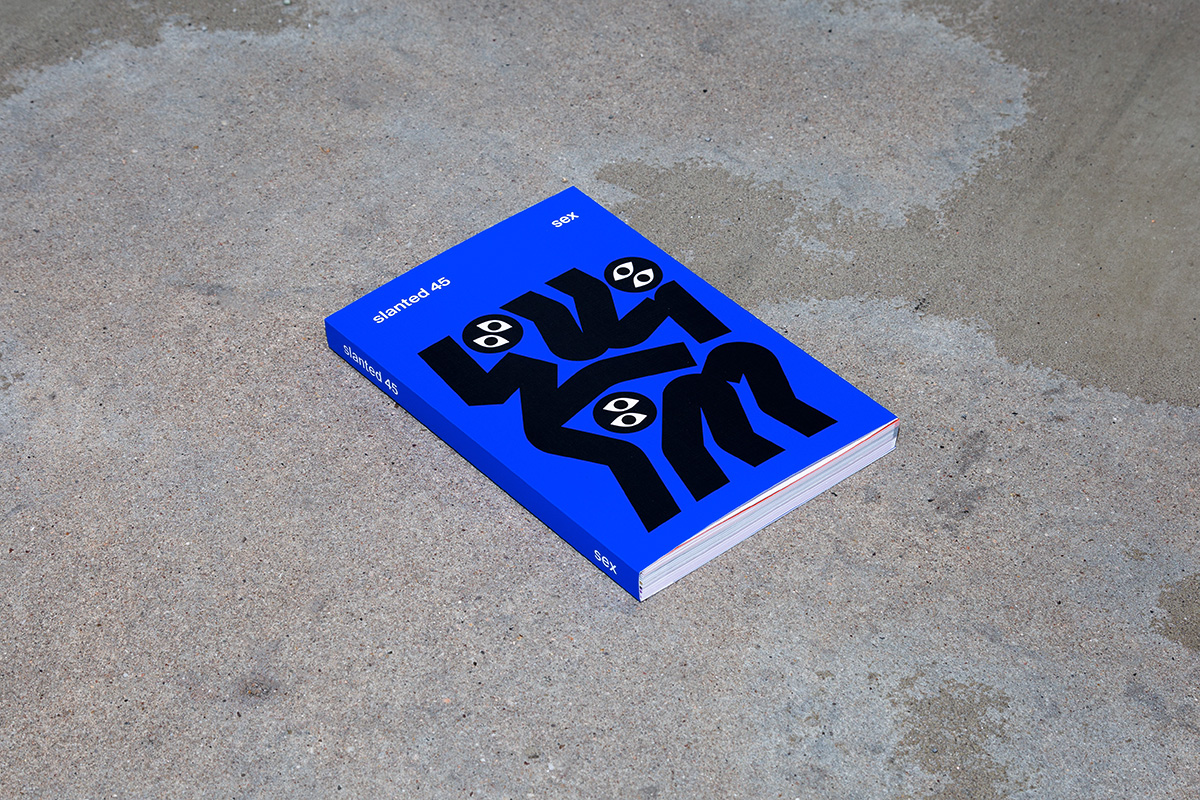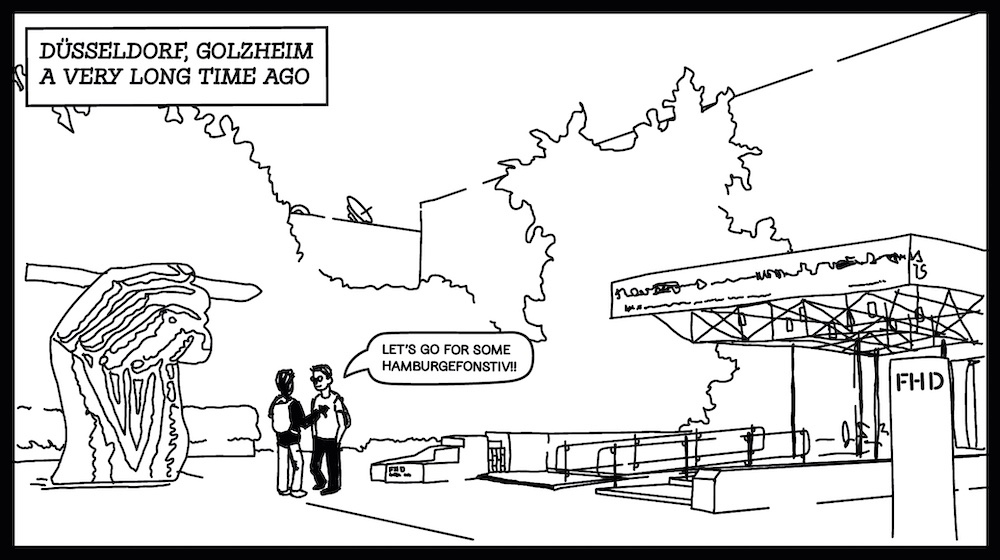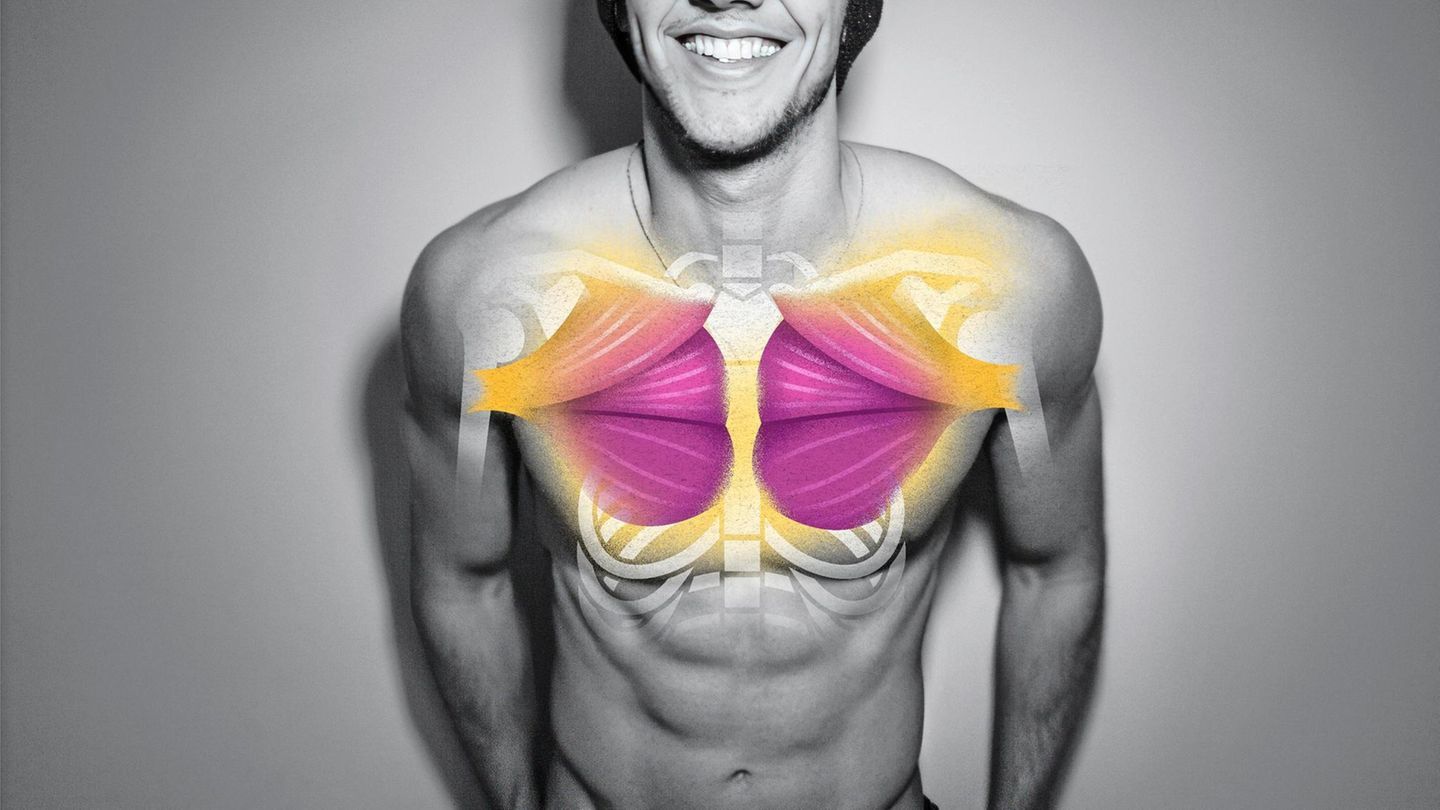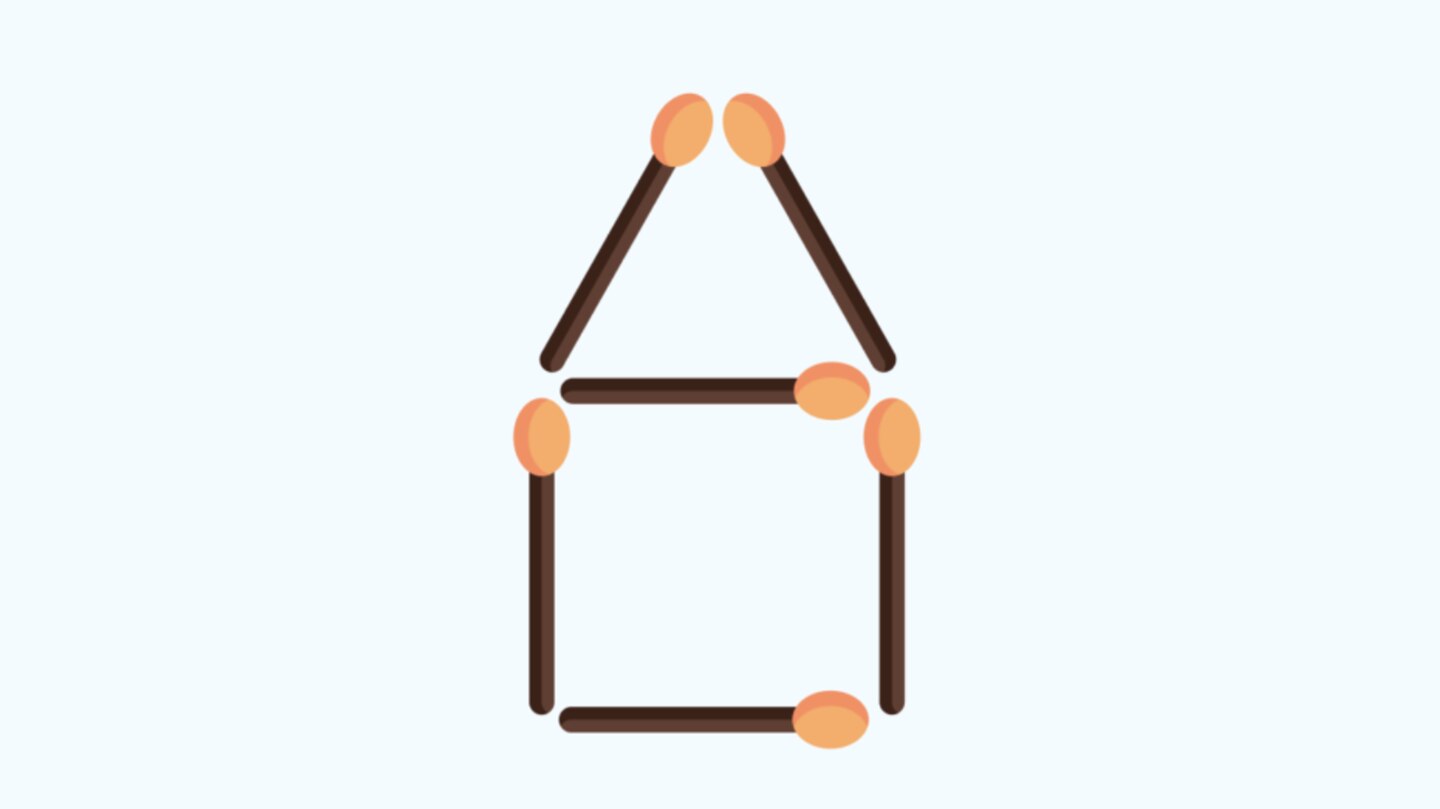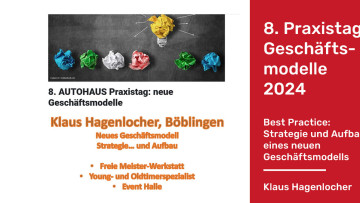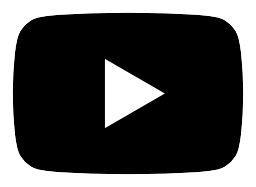Mountainbiken Freies WEGERECHT: Volksbegehren in Österreich gestartet
Das österreichische Volksbegehren "Mountainbiken Freies WEGERECHT" möchte das Mountainbiken auf dem bestehenden Wald-Wegenetz legalisieren.


Ein „Mountainbike-Paradies“, das kein freies Wegerecht für Mountainbiker im Wald kennt? Diesen Widerspruch möchte ein österreichisches Volksbegehren auflösen. Der Vorschlag: Radfahren soll im Wald auf bestehenden und geeigneten Wegen auf eigene Gefahr erlaubt sein.
[toc]
Mountainbiken Freies WEGERECHT
Seit dem 22. April 2025 können österreichische Bürger ihre Unterstützungserklärung für das Volksbegehren „Mountainbiken Freies WEGERECHT“ einreichen. Momentan befindet sich das Gesuch noch im Einleitungsverfahren. Sind mindestens 8.969 Unterstützer nachgewiesen, kann das sogenannte Eintragungsverfahren beginnen, bei dem mindestens 100.000 Unterschriften gesammelt werden müssen. Ziel des Begehrens ist es, das bestehende Wegenetz des Waldes für Radfahrer zu öffnen und die Gesetzeslage aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Im 14-seitigen Dokument zum Volksbegehren werden sieben Problemstellungen des Status Quo behandelt, darunter Haftungsfragen, Naturschutz, Tourismus und Konflikte mit der Nutzergruppe Jagd. Mit dem Vorschlag zur Änderung des Forstgesetzes möchten die Unterzeichner diese Probleme lösen und Mountainbiken auf den österreichischen Trails legalisieren.
Ein Unterzeichnen des Volksbegehrens ist sowohl bequem online per ID Austria als auch bei jedem Gemeindeamt möglich. Weiterführende Links findet ihr hier: www.oesterreich.gv.at
Den Text zum Volksbegehren könnt ihr hier selbst nachlesen:
Der Vorschlag im Detail
Das Volksbegehren fordert eine Gesetzesänderung im österreichischen Forstgesetz hin zu einem freien Wegerecht für Radfahrer. Daher ist es von zentraler Bedeutung, wie die zu öffnenden Wege definiert werden. Geht es nach den Unterzeichnern des Begehrens, soll folgende Definition in das Forstgesetz aufgenommen werden:
Für das Befahren mit dem geeigneten Fahrrad (Mountainbike) gelten ausschließlich bereits angelegte und verfügbare Wege, die der forstlichen Nutzung dienen oder als ausreichend breite Wege für Erholungszwecke genutzt werden. Ausreichend breit sind sie dann, wenn sie bei Benutzung für den geübten Radfahrer und für andere Nutzer Platz bieten, um sich gefahrlos zu begegnen. Es gilt für Radfahrer die nachrangige Nutzung gegenüber Fußgängern. Wer neue Wege anlegen möchte, darf dies ausschließlich mit Einwilligung des Eigentümers.
Den Initiatoren ist bewusst, dass es verschiedene Einwände gegen eine Öffnung des Wegenetzes für Radfahrer gibt, und präsentiert entsprechende Argumente bzw. Lösungen. So dämmt der Vorschlag etwa Befürchtungen ein, dass Waldeigentümer für Mountainbike-Unfälle auf ihrem Boden haften müssen. Nach Einschätzung der Initiatoren existiert bereits eine ausreichende Haftungsabsicherung, die zusätzlich durch den Passus ergänzt werden könne, dass die Nutzung der Waldwege mit dem Rad generell auf eigene Gefahr erfolgt.
Zudem wird unter anderem argumentiert, dass eine Inklusion von Mountainbikern auf dem bestehenden Wegenetz die touristischen Ziele des Landes besser widerspiegele. So warb etwa die ehemalige Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Elisabeth Köstinger, 2019 mit dem Slogan „You like it? Bike it!“ für den Mountainbike-Tourismus im Land – ein Werbespruch, der von der Szene im Angesicht der aktuellen Gesetzeslage als absurd abgetan wurde.
Hinter dem Volksbegehren steht Gerald Simon sowie eine weitere, namentlich nicht genannte Person. Simon hatte bereits 2007 versucht, mithilfe einer Bürgerinitiative die gesetzliche Regelung in Hinsicht auf das Mountainbiken zu ändern – allerdings ohne Erfolg, denn das Gesuch versandete nach seiner Einreichung im Nationalrat. Hier äußert er sich selbst zum aktuellen Volksbegehren:
Volksbegehren in Österreich
Wenn ein bundesweites Volksbegehren in Österreich 100.000 Stimmen oder mehr sammelt, wird es dem Nationalrat vorgelegt, der dann innerhalb spezieller Ausschüsse über das Anliegen berät. Nach spätestens fünf Monaten muss ein entsprechender Bericht dem Nationalrat vorgelegt werden, danach wird im Plenum des Nationalrats öffentlich über das Volksbegehren diskutiert. Ob das Anliegen des Volksbegehrens schlussendlich auch gesetzlich umgesetzt wird, liegt im Ermessen der Abgeordneten – das erfolgreiche Sammeln von mindestens. 100.000 Stimmen resultiert nicht automatisch in einer Gesetzesänderung.













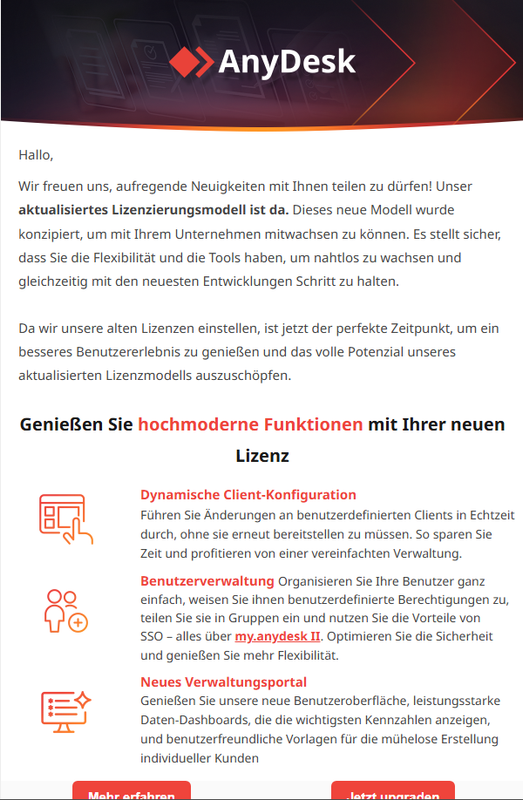
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ab/4e/ab4e5bf9d5b3634797e75b288292a32e/0122087407v1.jpeg?#)


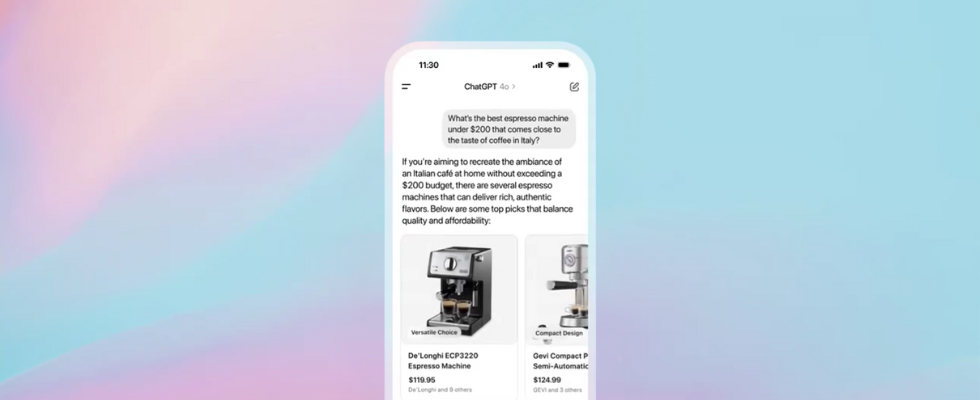
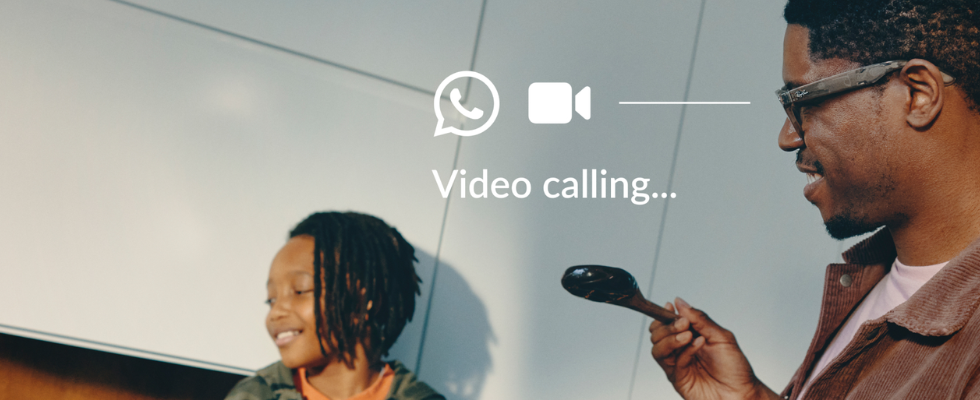


:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d5/d0/d5d02c4f6e269699961f516f2a58d6be/0124386294v1.jpeg?#)



,regionOfInterest=(1481,1038)&hash=789cee2ea70c15a4a50941154a087fc713c69da50b2e6f909fe1e814d28d59ec#)
,regionOfInterest=(228,148)&hash=0d63269a9a622c67d70809ed9769ec80c5b4f4340022d73e2b119915ce310da5#)



![Mit Bavaria One zum Mars statt mit der Bahn nach Berlin? [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)