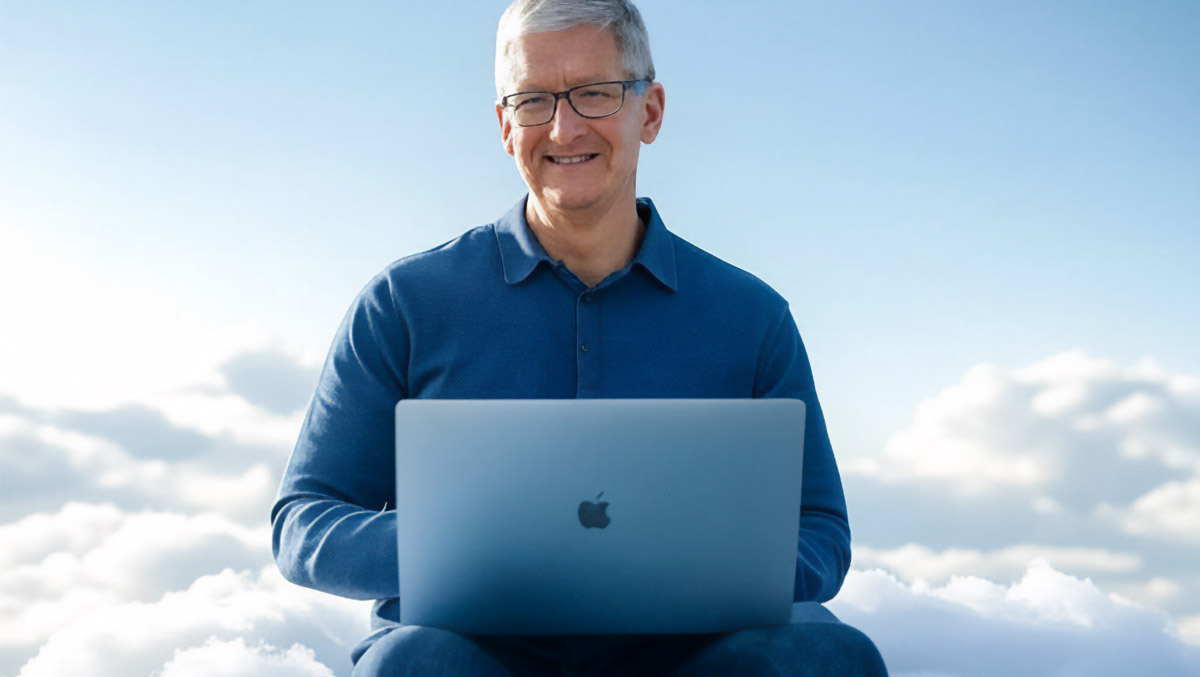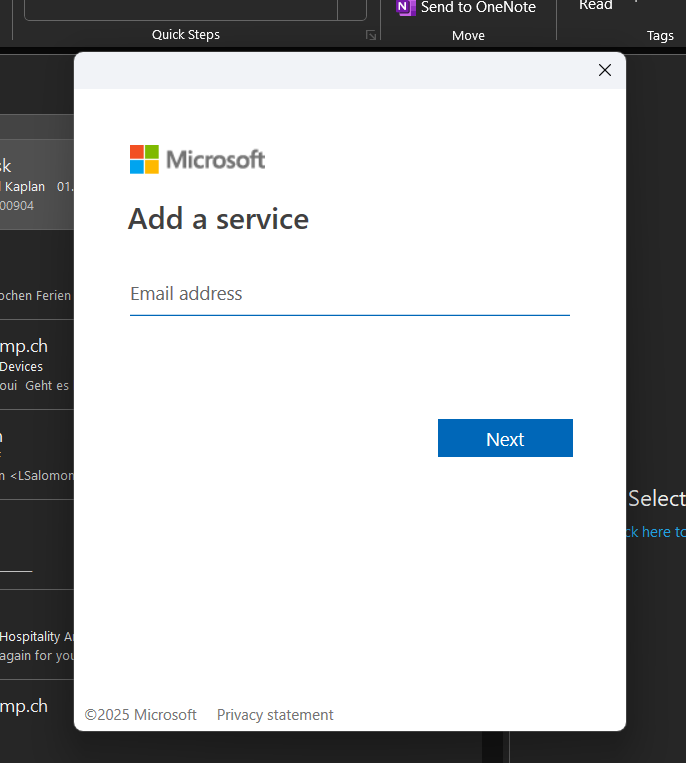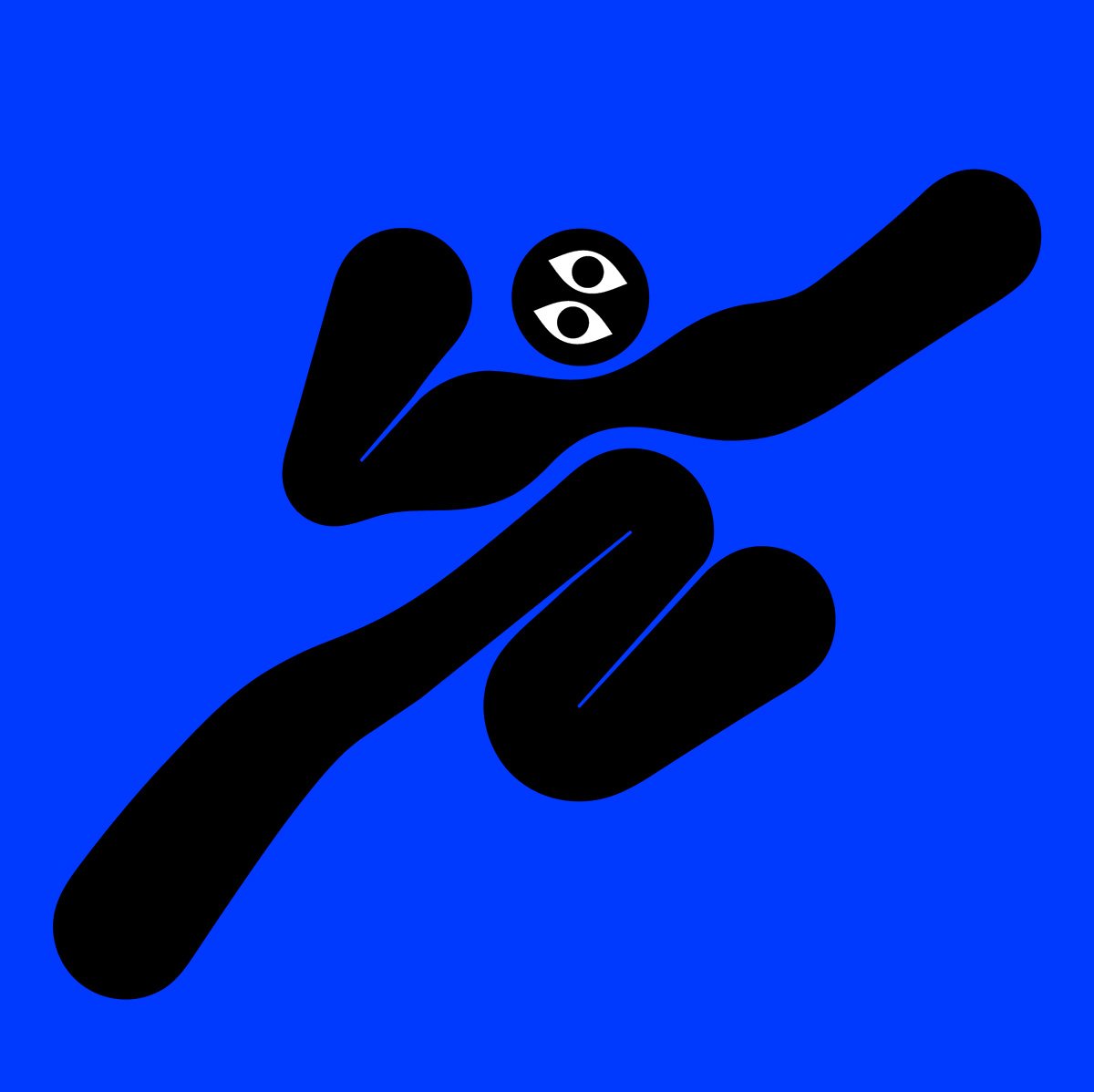Meinung: Prostatakrebs: Kein Urologen-Finger mehr im Hintern? Gut so!
Die Früherkennung von Prostatakrebs soll nicht mehr standardmäßig durch Abtasten erfolgen, sondern durch PSA-Tests und weitere Untersuchungen. Eine überfällige Entscheidung.

Die Früherkennung von Prostatakrebs soll nicht mehr standardmäßig durch Abtasten erfolgen, sondern durch PSA-Tests und weitere Untersuchungen. Eine überfällige Entscheidung.
Die neue Ärzteleitlinie zu Prostatakrebs, wonach der Tast-Test auslaufen und der PSA-Test gestärkt werden soll, ist angesichts der Datenlage überfällig: Kein Test auf Prostatakrebs ist inzwischen so gut erforscht wie die PSA-Untersuchung im Blut. Der diagnostische Wert des Tastens mit dem Zeigefinger im Hintern ist dagegen mau, wie zuletzt wieder eine große internationale Übersichtsstudie belegte. Dementsprechend ist es zu begrüßen, wenn Männer in Zukunft sinnvollere Früherkennung beim Arzt angeboten bekommen. Die sollte außerdem laut Leitlinienentwurf stärker auf den einzelnen Mann zugeschnitten sein.
Der Leitlinienentwurf unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Urologie könnte für Männer ab 45 Jahren ganz neue Regeln zur Krebsfrüherkennung auf den Weg bringen. Nicht mehr empfohlen wird nämlich die unangenehme Tastuntersuchung, bei der ein Urologe seinen Zeigefinger in den Enddarm des Patienten einführt, um Geschwüre der Prostata zu ertasten. Bisher ist diese Untersuchung für Männer ab 45 Jahren Standard und wird von gesetzlichen Kassen als Früherkennung bezahlt. Dabei ist sie ungenau und erkennt Tumoren erst, wenn sie schon ziemlich groß sind – das heißt: unter Umständen zu spät für eine schonende und erfolgreiche Therapie.
Erhöhter PSA-Wert kann auf Prostatakrebs hinweisen
Statt Abtasten soll Männern ab 45 Jahren künftig – nach einer Beratung – ein PSA-Test im Blut angeboten werden. Ein erhöhter PSA-Wert kann auf Prostatakrebs hinweisen. Bisher muss der Test allerdings (außer bei konkretem Krebsverdacht) aus der eigenen Tasche bezahlt werden und schlägt mit rund 50 Euro zu Buche. Das könnte sich mittelfristig durch die neue Leitlinie ändern. Sie dürfte auch den Druck auf den Gemeinsamen Bundesausschuss erhöhen. Das Gremium, entscheidet darüber, welche Leistungen – also auch welche Früherkennungsmethoden – die gesetzliche Krankenversicherung erstattet. Zwar könnte sich eine Entscheidung über den PSA-Test auf Kassenkosten statt der Tastuntersuchung mutmaßlich noch Jahre hinziehen, angeschoben ist sie aber nun immerhin.
Das PSA oder Prostata-spezifische Antigen ist ein Eiweiß, das in der Prostata gebildet wird und die Samenflüssigkeit verdünnt, damit die Spermien gut zur Eizelle kommen. Es zirkuliert auch im Blut, weil die Prostata von vielen Adern durchzogen ist. Um den PSA-Wert zu bestimmen, wird in der Arztpraxis Blut aus dem Arm entnommen und im Labor auf das PSA-Protein untersucht. Bisher gilt meist ein Wert unter drei Nanogramm (Milliardstel Gramm) pro Milliliter Blut als unauffällig. Bei zwei Messungen von mehr als vier Nanogramm oder wenn der Wert ansteigt, wird oft eine sogenannte Nadelbiopsie vom Darm aus gemacht: Dabei werden mit kleinen Hohlnadeln etwa zehn Gewebestückchen aus der Prostata gestanzt, und die Zellen dann unter dem Mikroskop auf Krebs untersucht.
Auch der PSA-Test ist nicht perfekt
Nun ist auch der PSA-Test nicht perfekt. Viele Faktoren können den Blutwert erhöhen, ohne dass jemand an Krebs erkrankt wäre: ein Samenerguss, Entzündungen der Prostata und sogar Fahrradfahren. Das führt leider oft zu unnötigen und schmerzhaften Gewebeentnahmen und weiteren Untersuchungen. Zudem verursacht ein erhöhter PSA-Wert Sorgen, wenn man sich plötzlich als möglicher Krebs- oder gar Todeskandidat fühlt.
Was die Sache noch verkompliziert: Selbst wenn bei weiteren Untersuchungen tatsächlich Krebs gefunden wird, muss längst nicht jeder Mann mit Prostatakarzinom behandelt werden. Manche Tumoren wachsen so langsam, dass sie selbst im hohen Alter keine Probleme verursachen. Man stirbt mit ihnen, nicht an ihnen. Urologen nennen sie liebevoll "Haustierkrebs", weil der Körper sie wie ein zahmes Tier beherbergt. Andere fallen wie ein Raubtier über ihren Wirt her, bilden Metastasen in anderen Teilen des Körpers und können einen Mann in kurzer Zeit umbringen. Wer ein "Haustier" in sich trägt und wer ein "Raubtier", ist anfangs kaum vorherzusehen. Was dazu führt, dass immer wieder Männern die Prostata entfernt wird – mit möglichen Nebenwirkungen wie bleibender Impotenz oder Inkontinenz – bei denen das gar nicht nötig war.
Daher wurde in der Vergangenheit oft erbittert um Nutzen und Schaden des PSA-Tests gestritten. Die einen sahen darin die einzig funktionierende Früherkennung, andere argumentierten, der Bluttest würde viel Geld kosten und Männer, die weder Diagnostik noch Behandlung benötigten, zu Krebspatienten abstempeln. Selbst der Entdecker des PSA-Proteins, der US-Krebsforscher Richard Ablin, sprach sich noch 2013 vehement gegen eine PSA-Routineuntersuchung aus.
Verhindert ein PSA-Screening Krebs-Tode?
Doch inzwischen wurden weitere große Studien zur wohl relevantesten Früherkennungsfrage abgeschlossen: Verhindert ein flächendeckendes PSA-Screening tatsächlich Prostatakrebs-Todesfälle? In der großen europäischen ERSPC-Studie ließen sich Zehntausende Männer über Jahre Blut für PSA-Tests abnehmen. Dabei wurde ihre Krankengeschichte über mehr als 15 Jahre verfolgt – mit dem Ergebnis, dass ein PSA-Screening offenbar einige Krebstodesfälle verhindern kann. Von 1000 gescreenten Männern starben in der Zeit drei weniger am Prostatakarzinom. Auf jeden verhinderten Todesfall kamen allerdings 14 Männer mit "Überdiagnose": Bei ihnen wurde nach einem PSA-Test ein "zahmer" Prostatakrebs diagnostiziert, der unentdeckt nie Probleme gemacht hätte. Diese Männer hatten also Nachteile durch den Test – allerdings keine tödlichen.
Vielen anderen könnte ein PSA-Test die Sorge nehmen: Er liefert gute Hinweise, wie hoch das Risiko für Prostatakrebs in den nächsten Jahren ist: Neuere Daten der großen deutschen Probase-Studie an mehr als 20.000 Männern belegen, dass Mann mit sehr niedrigem PSA-Wert höchstwahrscheinlich für Jahre auf der sicheren Seite ist: Danach hatten Männer, die mit 45 Jahren einen PSA-Wert unter 1,5 Nanogramm pro Milliliter hatten, nur ein sehr niedriges Risiko, in den nächsten fünf Jahren am Prostatakarzinom zu erkranken. Mittelhoch war die Gefahr bei einem Wert bis unter drei Nanogramm, hoch bei drei oder mehr.
Diesen Unterschieden soll auch die neu entworfene Leitlinie Rechnung tragen: Männer mit PSA-Wert unter 1,5 Nanogramm sollen künftig alle fünf Jahre zur Blutkontrolle kommen, Männer mit einem Wert bis drei Nanogramm alle zwei Jahre. Und wer mehr als einmal über drei Nanogramm liegt, soll weiter untersucht werden: Es wird zum Beispiel nach Krebs in der Familie gefragt, die Prostata per Ultraschall vermessen und eventuell ein MRT (Kernspin) der Prostata veranlasst. Ein MRT kann weitere Hinweise liefern, ob es sich um einen gefährlichen Tumor handelt. Erst dann käme die Nadel-Biopsie zum Einsatz.
Mit PSA-Test und zusätzlichen Untersuchungen statt Finger-Abtastung könnte das Risiko für den einzelnen Patienten genauer berechnet werden – bevor radikale und unter Umständen unnötige Behandlungen wie eine OP mit Entfernung der Prostata folgen. So besteht die Hoffnung, dass mehr gefährliche Tumoren entdeckt und weniger irrelevante übertherapiert werden. Insofern ist die Überarbeitung der ärztlichen Leitlinie ein Fortschritt. Bleibt zu hoffen, dass die gesetzlichen Kassen darauf reagieren.













:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c9/69/c9699a0efca29827ea7699d9a7475533/0124072195v2.jpeg?#)