Entfremdung, Resonanz und Musik [Gesundheits-Check]
Musik kann das Denken ausschalten, überwältigen, Gemeinschaft stiften, wo eigentlich gar keine ist. Denken, Besinnung und Musik können aber auch zusammengebracht werden, so dass Musik sensibel für das Verbindende zwischen uns macht. Gestern gab es in der evangelischen Münchner Himmelfahrtskirche eine solche Veranstaltung: „Demokratie in drei Akten – eine musikalisch-philosophische Reise mit Hartmut Rosa“. Dazu…
![Entfremdung, Resonanz und Musik [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)
Musik kann das Denken ausschalten, überwältigen, Gemeinschaft stiften, wo eigentlich gar keine ist. Denken, Besinnung und Musik können aber auch zusammengebracht werden, so dass Musik sensibel für das Verbindende zwischen uns macht. Gestern gab es in der evangelischen Münchner Himmelfahrtskirche eine solche Veranstaltung: „Demokratie in drei Akten – eine musikalisch-philosophische Reise mit Hartmut Rosa“.
Dazu gab es drei Gesprächsrunden mit dem Soziologen Hartmut Rosa, befragt von seinem früheren Doktoranden Robert Jende, jeweils eingeleitet von der Pfarrerin Stephanie Höhner. Im Kern ging es darum, was Demokratie ausmacht und was sie damit zu tun hat, gehört zu werden und zuzuhören. Zwischen den Gesprächsrunden: Musik – Orgel und Schlagzeug.

Ich muss vorausschicken, dass ich von Hartmut Rosa selbst noch nichts gelesen habe, ihn nur aus der Sekundärliteratur kenne. Es kann also sein, dass ich seine Position da und dort etwas eigenwillig wiedergebe.
Rosa hat dafür plädiert, Politik weniger als „Kampf“ zu sehen, in dem sich der eine gegen die andere oder umgekehrt durchsetzen will. Explizit hat er sich gegen das Politikverständnis von Carl Schmitt ausgesprochen, der das Wesen des Politischen bekanntlich in der Unterscheidung zwischen Freund und Feind sah. Bei Carl Schmitt steht das im Kontext eines Konzepts der „Politischen Theologie“, wenn man so will, einer Personalisierung des Unterschieds zwischen Gut und Böse. Indem der Mensch im Paradies vom Baum der Erkenntnis dieses Unterschieds gegessen hat, hat er seine Unschuld und sein sorgloses Dasein verloren, wie Pfarrerin Höhner in einer ihrer Vorreden noch einmal vorgetragen hat. Allerdings ist er wohl auch erst so zum Menschen geworden, der selbst Sorge für sein Leben trägt, zu tragen hat, und moralisch urteilsfähig ist, mündig geworden ist. Die Vertreibung aus dem Paradies, die man evolutionstheoretisch ganz unreligiös als Entwicklung der Reflexionsfähigkeit des instinktsicheren Tiers sehen kann, hat auch ihre positiven Seiten.
Hartmut Rosa hat in seinen Statements die Vorstellung einer „Anrufbarkeit“ stark gemacht, der Offenheit gegenüber dem, was der Andere sagt. Darauf beruhe seiner Ansicht nach die Möglichkeit des Politischen, der gemeinsamen Gestaltung dessen, was der Einzelne nicht kann, Straßen bauen oder Schulen betreiben beispielweise. Diese „Anrufbarkeit“, Rosa sprach biblisch auch vom „hörenden Herz“, der Fähigkeit, sich berühren zu lassen, würde durch geeignete Räume gefördert. Das könne der Eindruck des Gebirges sein, oder des Meeres, oder eben auch einer Kirche, die einen zunächst einmal still werden lässt, zum „Auf-Hören“ bringt.
Eins der letzten Bücher von Hartmut Rosa trägt den Titel „Demokratie braucht Religion“. In diese Richtung dachte auch schon der Jurist Wolfgang Böckenförde, dessen berühmtes Diktum, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht gewährleisten könne, von Pfarrerin Höhner auch zitiert wurde. Darin steckt viel Einsicht in die Freiheitsproblematik, ich zitierte diese Sentenz auch gerne, aber man muss aufpassen, dass man sie nicht überstrapaziert. Natürlich reproduziert der liberale Staat, indem er alle zur Mitwirkung aufruft, jedem – zumindest pro forma – eine Stimme gibt, performativ die Voraussetzungen, von denen er lebt, ein Stück weit. Das unterscheidet ihn ja gerade von Diktaturen aller Art.
Dem „hörenden Herzen“ hat Rosa unseren Alltag gegenübergestellt. Hier würden wir oft nur funktionieren, nur Vorgaben vollziehen, bei denen wir uns nicht mehr besinnen müssen. Man hätte hier fragen können, warum das nicht eine Rückkehr ins verlorene Paradies ist, oder ob es eine verfehlte Form einer Rückkehr in ein Dasein ohne Zweifel über Richtig und Falsch ist. Jedenfalls sprach er hier ein Grundmotiv der Soziologie der Moderne an, etwas marxistisch gesprochen der Entfremdung des Menschen in einer hochgradig systemrationalen, funktional differenzierten Welt. Ein Gefühl der Verbundenheit mit der Welt kann man in der Tat eher im Gebirge heraufbeschwören als beim Autofahren nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung.
Allerdings frage ich mich, ob das „hörende Herz“, so wichtig es ist, die ganze Antwort darauf ist, oder ob das in der Tradition der Romantik eine utopische Vorstellung einer ungebrochenen Einheit mit der Welt ist, der Geborgenheit in einem Kosmos, die mit der Menschwerdung des Menschen unwiederbringlich verloren ging und die es aus der Außenperspektive für den Hasen, der vom Fuchs gefressen wird, auch nie gab. Fast meint man – dagegen würde sich Hartmut Rosa vermutlich vehement verwehren – hier ein Echo der Zivilisationskritik rechter Soziologen wie Hans Freyer oder Arnold Gehlen zu vernehmen. Deren große Hoffnung war der Nationalsozialismus, und der konnte ozeanische Gefühle zwar provozieren, aber wie man weiß, nicht zum Guten der Menschheit. Vielleicht muss man doch etwas mehr Marx wagen, etwas mehr klassentheoretisch gewendeten Carl Schmitt? Einen besseren Arbeitsschutz, mehr bezahlbaren Wohnraum oder eine menschenwürdigere Pflege wird man jedenfalls nicht dadurch bekommen, gemeinsam mit Leuten wie Elon Musk im Gebirge zu wandern. Deren „Solutionismus“ sieht auch ganz anders aus.
Dass man nicht einer Meinung sein muss, dem würde Hartmut Rosa natürlich wieder zustimmen. Die kritische Auseinandersetzung ist der Boden der Gemeinsamkeit, nicht die Gefolgschaft, oder der zum Selbstzweck überhöhte Konsens. Insofern war es eine interessante, anregende Veranstaltung, mit guter Musik: Hartmut Rosa an der Orgel, Robert Jende am Schlagzeug. Vielleicht wäre das auch mal was für den Deutschen Soziologentag. Und es war ein überzeugendes Beispiel dafür, dass sich Kirche nicht aus der Politik heraushalten soll, und zwar vor allem da nicht, wo es den politischen Apparat stört.















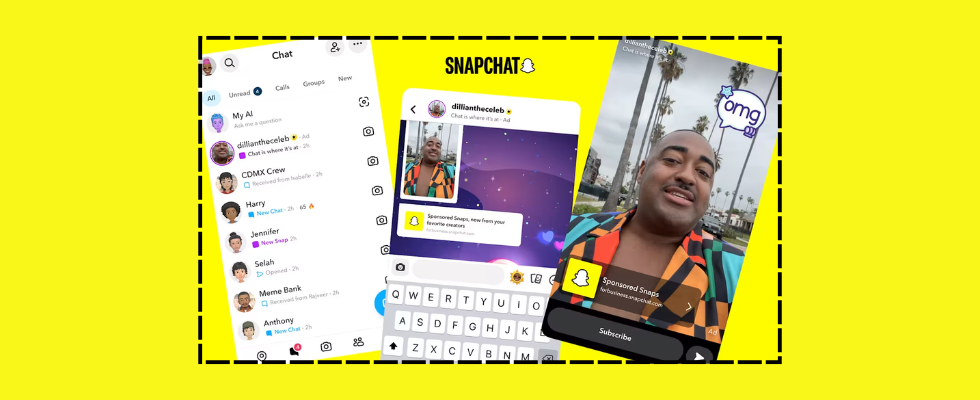
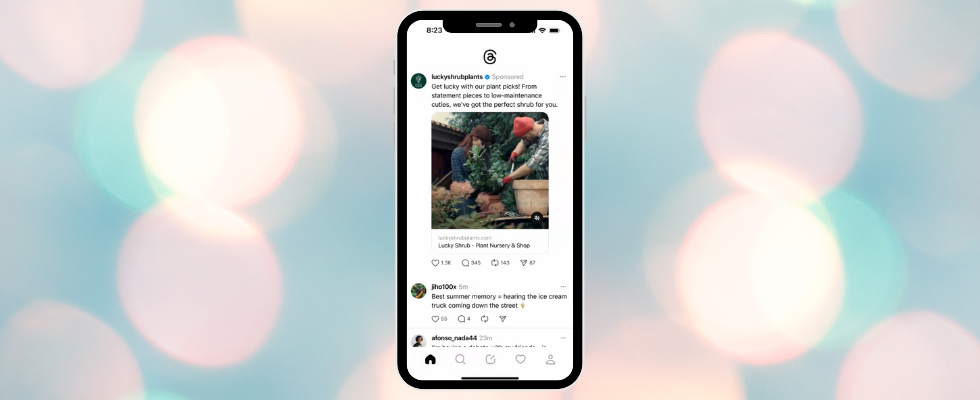
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/f4/c4f4a3c873e25da77e5e9eaa6b7789cb/0122088267v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/9c/8d9cb4d105e8311e66c07a34fdf5e1cf/0124569131v1.jpeg?#)












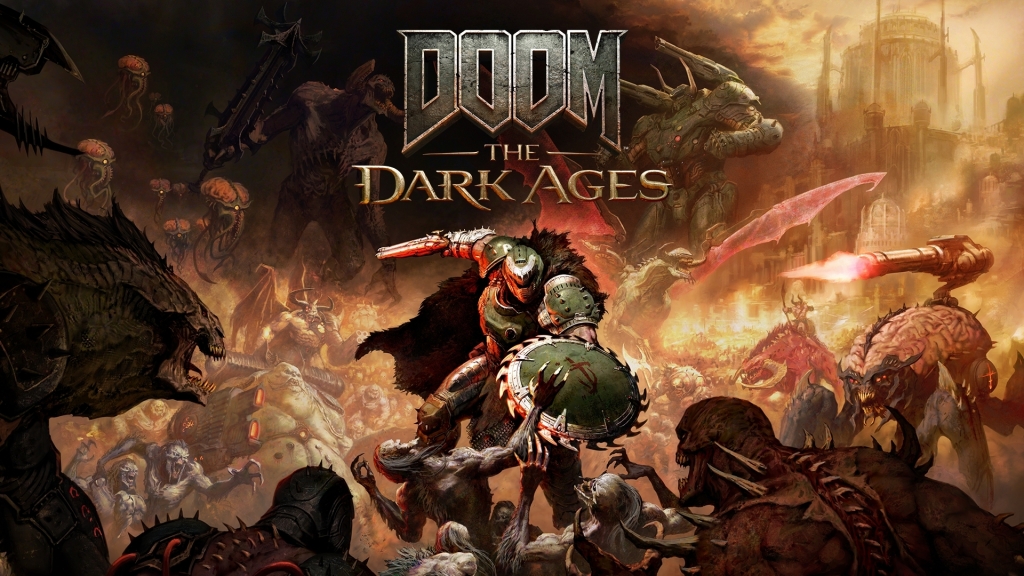

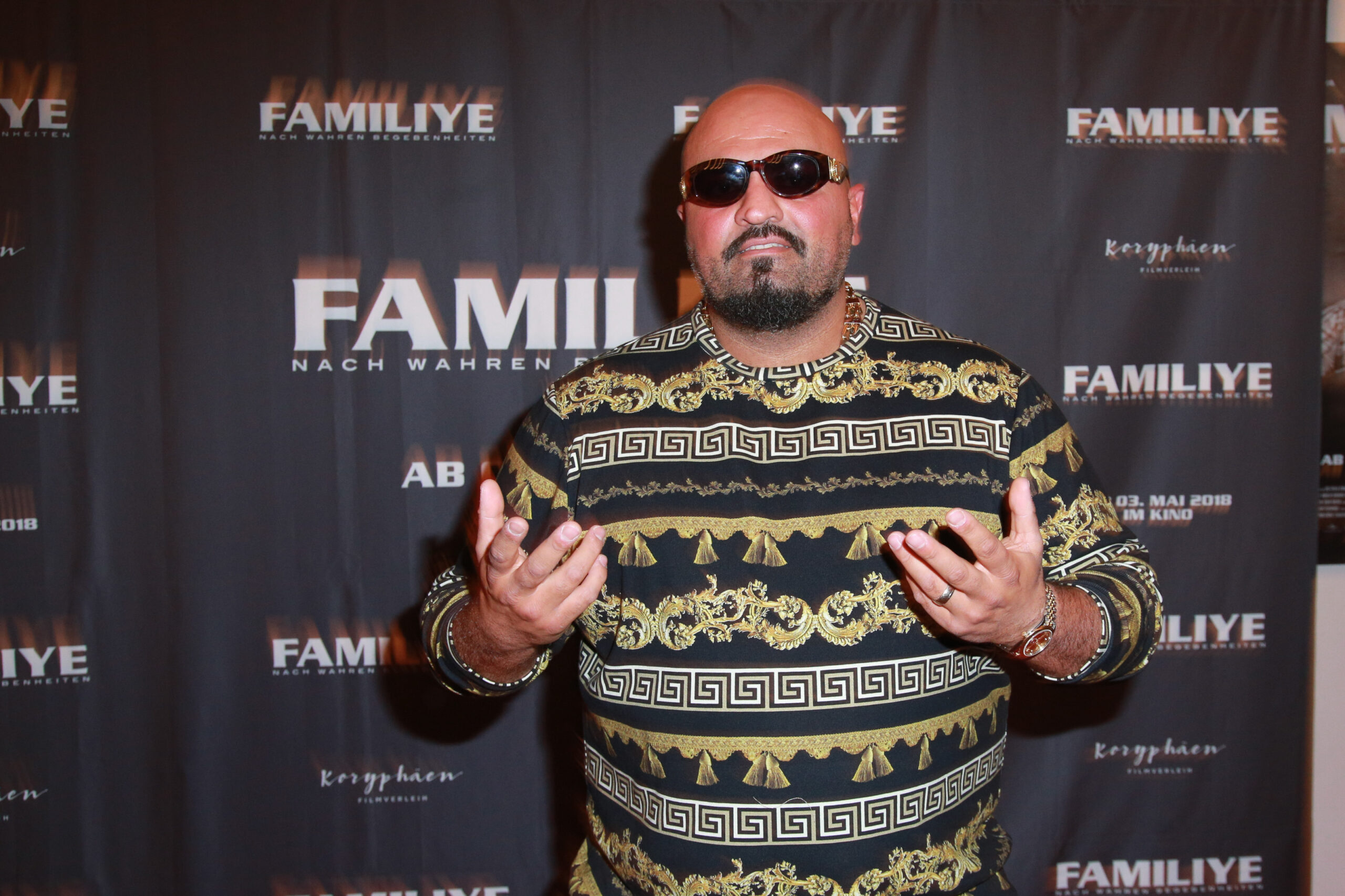
























:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/f7/82f7502738559a9f90e4f689011807aa/0124597099v1.jpeg?#)





