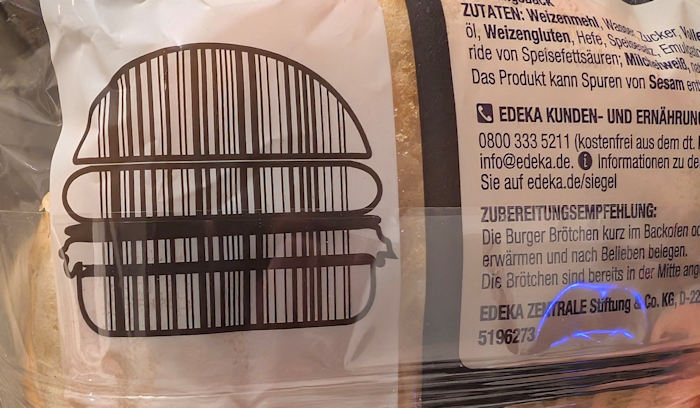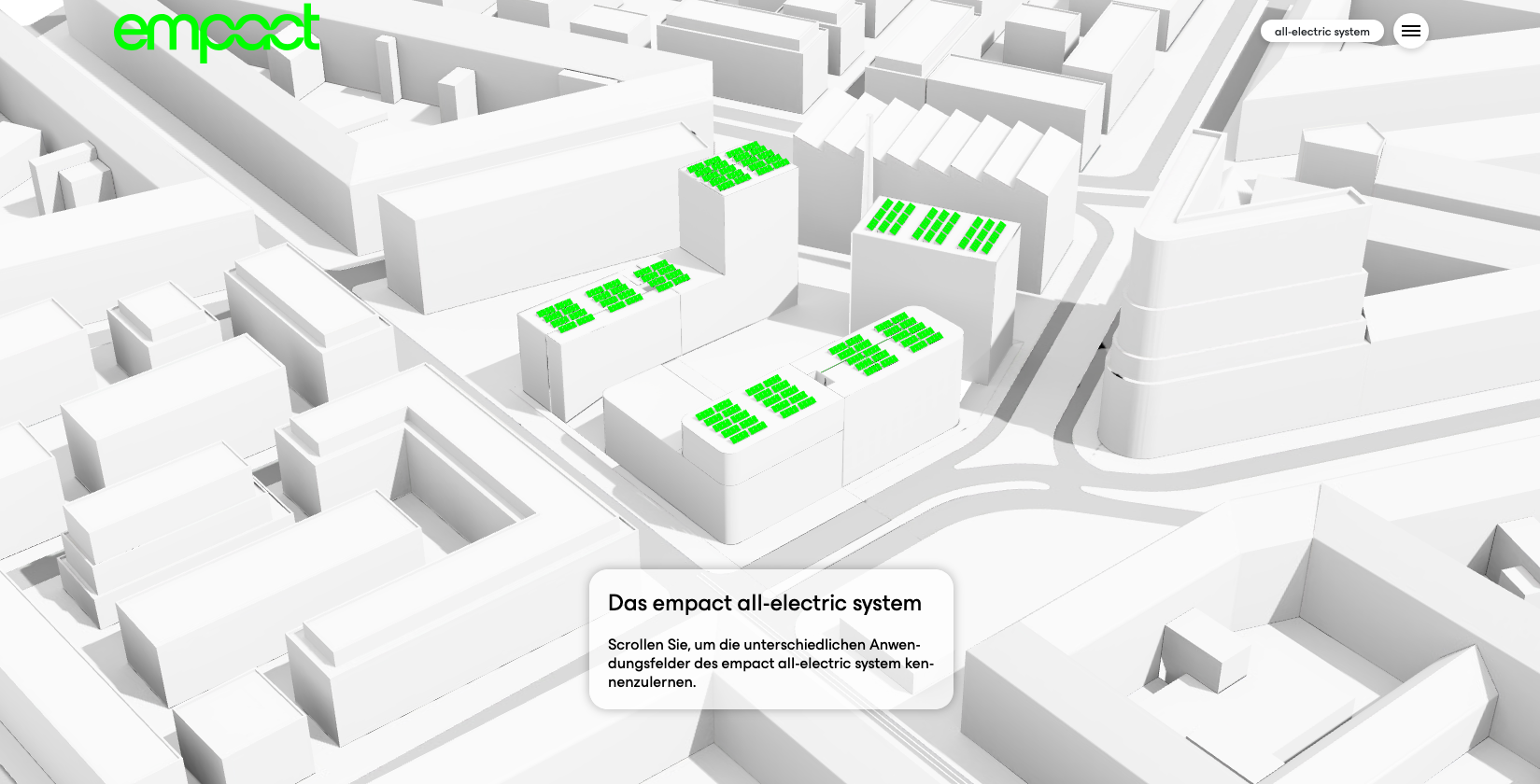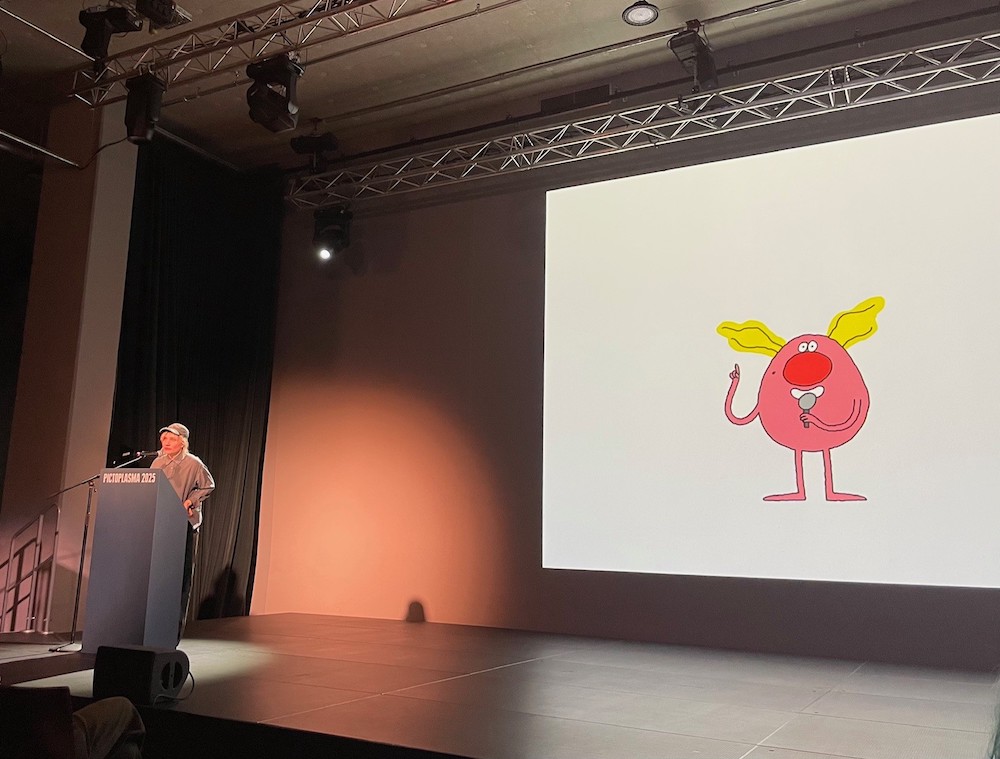4-Tage-Woche: Warum ich an meinem freien Tag bewusst nichts Produktives mache
"Ach, du hast eine Vier-Tage-Woche? Was machst du denn an deinem freien Tag?" Warum unsere Autorin diese Frage nicht mehr hören kann und was das Problem daran ist, dass wir jede Sekunde unseres Lebens mit etwas (vermeintlich) Produktivem füllen müssen.

"Ach, du hast eine Vier-Tage-Woche? Was machst du denn an deinem freien Tag?" Warum unsere Autorin diese Frage nicht mehr hören kann und was das Problem daran ist, dass wir jede Sekunde unseres Lebens mit etwas (vermeintlich) Produktivem füllen müssen.
Neulich nannte die österreichische ÖVP-Politikerin Johanna Mikl-Leitner es auf einer Podiumsdiskussion "asozial", wenn gesunde Menschen sich zugunsten ihrer Work-Life-Balance gegen einen Vollzeitjob entscheiden. "Wenn jemand Teilzeit arbeitet, habe ich großes Verständnis", so ihre Meinung, "und das soll er auch, wenn er oder sie Kinder oder ältere Menschen zu betreuen hat. Aber nicht, wenn es ein gesunder Mann ist oder eine gesunde Frau, denn das ist asozial."
Und mit der Meinung ist sie nicht allein. Immer wieder hört und liest man, dass es aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und des Fachkräftemangels unser aller Pflicht sei, so viel zu arbeiten wie nur möglich. Dem gegenüber steht aber der Trend, dass viele Menschen lieber nicht in Vollzeit arbeiten wollen, wenn sie es finanziell nicht müssen – und zwar völlig unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder anderweitig mehr Zeit für Care-Arbeit brauchen. Einfach nur für sich selbst – verrückt.
Ein Tag ohne Produktivitätsdruck
Zu diesen Menschen gehöre ich auch. Ich habe weder Kinder, noch muss ich aktiv im Alltag jemanden pflegen – und ich arbeite trotzdem nur 80 Prozent und habe eine Vier-Tage-Woche. Ich arbeite auch nicht nebenbei an einem anderen Projekt, schreibe kein Buch oder baue ein Tiny House. Ein Ehrenamt hatte ich mal, aktuell mache ich an meinem freien Tag aber meistens einfach nichts.
Klar, manchmal nutze ich den Tag für Ärzt:innentermine oder andere organisatorische Dinge, um die Arbeitstage zu entzerren. Manchmal treffe ich Freund:innen oder gehe einkaufen. Aber in der Regel versuche ich, mir an meinem freien Tag nichts vorzunehmen und einfach nur das zu machen, worauf ich Lust habe.
Denn damit ich meinen Job an den anderen vier Tagen in der Woche ordentlich erledigen kann, muss es mir gut gehen und ich muss einigermaßen ausgeruht sein. Mir die Pausen zu gönnen, die ich brauche, ist also Voraussetzung dafür, dass ich danach wieder produktiv sein kann.
Auch wenn unsere auf Leistung und Status fixierte Gesellschaft uns gern etwas anderes suggeriert: Nicht alle Menschen haben jeden Tag exakt gleich viel Energie zur Verfügung. Menschen sind unterschiedlich, körperlich und psychisch können Personen gänzlich verschiedene Voraussetzungen mitbringen. Und ob jemand nebenbei vielleicht mit den Gedanken bei einem kranken Familienmitglied ist oder eine psychische Erkrankung hat, wissen wir womöglich gar nicht.
Wieso können Menschen also nicht mündig für sich selbst entscheiden, wie viel sie arbeiten möchten und können? Wieso muss aus diesem privaten Thema ein Politikum gemacht und Einzelpersonen vorgeworfen werden, sie seien "asozial", weil sie für ihr Leben eine Entscheidung treffen, mit der sie langfristig glücklicher und gesünder sind?
Der Fachkräftemangel liegt nicht in der Verantwortung von Einzelnen
Dabei finde ich es eher asozial, die Verantwortung für ein offensichtlich nicht (mehr) funktionierendes System den einzelnen Menschen zu übertragen. Wenn es nicht genug Arbeitnehmende gibt, ist das nicht die Schuld der Personen, die in Teilzeit arbeiten – völlig egal, aus welchem Grund –, sondern ist Aufgabe der von uns gewählten Politiker:innen, denen wir die Verantwortung für unser Land übertragen haben.
Dass der Rentenbeginn der Babyboomer-Generation auf dem Arbeitsmarkt eine Lücke hinterlässt, kam nicht wirklich überraschend – darauf hätte man sich vorbereiten können. Und es ist auch nicht die Schuld der aktuell arbeitenden Generationen, dass sie aus weniger geburtenstarken Jahrgängen stammen. Also warum sollte ich ein krankes System damit unterstützen, dass ich so viel arbeite, dass es mir damit schlechter geht und ich mein Leben weniger mag?
Natürlich leben wir in einer Solidargemeinschaft, und jede Person darin trägt ein Stück Verantwortung für die Gemeinschaft. Dafür zahlen wir alle Steuern, Beiträge zur Krankenkasse, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung (als kinderlose Person zahle ich in Letztere natürlich auch gerne mehr ein als Menschen mit Kindern).
Aber dass Menschen ihre persönlichen Lebensentscheidungen vorgeworfen werden und ihnen gesagt wird, sie seien "asozial", weil sie durch ihre niedrigere Arbeitszeit auch kleinere Beiträge ins System zahlen, finde ich absurd. Ist denn auch schon meine Entscheidung für den Journalismus asozial, weil klar war, dass ich niemals so viel Geld verdienen werde wie eine Anwältin oder ein Programmierer? Oder werde ich erst dann asozial, wenn ich mich entscheide, nicht die 40 Vollzeitstunden zu arbeiten, sondern auf 20 Prozent Lohn zu verzichten (die bei einem Onlineredakteurinnen-Gehalt ehrlicherweise ohnehin nicht ausreichen, um das System zum Einsturz zu bringen)?
Wenn Care-Arbeit instrumentalisiert wird
Ich arbeite grundsätzlich gern und bin dankbar, einen Job zu haben, der mir Spaß macht und in dem ich mich kreativ ausleben kann (und zum Beispiel solche Texte schreiben darf). Aber ich mag die Aktivitäten, mit denen ich meine Freizeit gestalte, mindestens genauso gerne. Und nur weil sie nicht das sind, was unsere Leistungsgesellschaft als produktiv ansieht, ist es trotzdem mein Recht als Person (und Steuerzahlerin), mir so viel davon zu nehmen, wie ich mir leisten kann (und selbstverständlich weiß ich, dass es ein Privileg ist, dass mir das finanziell überhaupt möglich ist).
Das Paradoxe ist ja: Mir wird vorgeworfen, dass ich in Teilzeit arbeite, obwohl ich weder Kinder habe noch tägliche Pflegearbeit für Angehörige leisten muss. Menschen, die das tun, werden wiederum in unserem System in der Regel ignoriert, ihre Care-Arbeit als selbstverständlich angesehen. Das heißt, um Menschen wie mir die Schuld am Fachkräftemängel und an der Wirtschaftskrise zu geben, darf die Care-Arbeit gern als Argument herhalten. Wenn es aber darum geht, etwas für die Personen (also in der Regel Frauen) zu tun, die durch Kinder- und Angehörigenbetreuung weniger erwerbsarbeiten können, hebt die Politik ganz schnell die Arme und will kein strukturelles Problem erkennen können.
Politiker:innen (egal, ob in Österreich, Deutschland oder den USA) könnten ihre Energie ja auch dafür aufwenden, die aktuellen (patriarchalen) Strukturen aufzubrechen und das System zu verändern, sodass alle Menschen von ihrem Einkommen leben können und Care-Arbeit endlich als Arbeit verstanden wird. Und dann, völlig verrückte Idee in einer Demokratie im 21. Jahrhundert, könnten wir es den Menschen vielleicht sogar selbst überlassen, ihre eigenen Lebensentwürfe zu wählen und zu entscheiden, was und wie viel sie arbeiten möchten.















:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bd/71/bd71b63f73a9c62dd79baa96f419dc77/0124416835v1.jpeg?#)

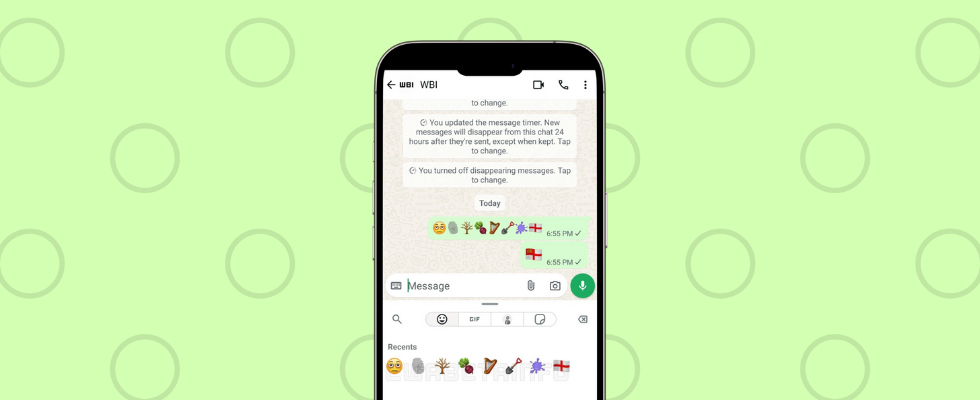
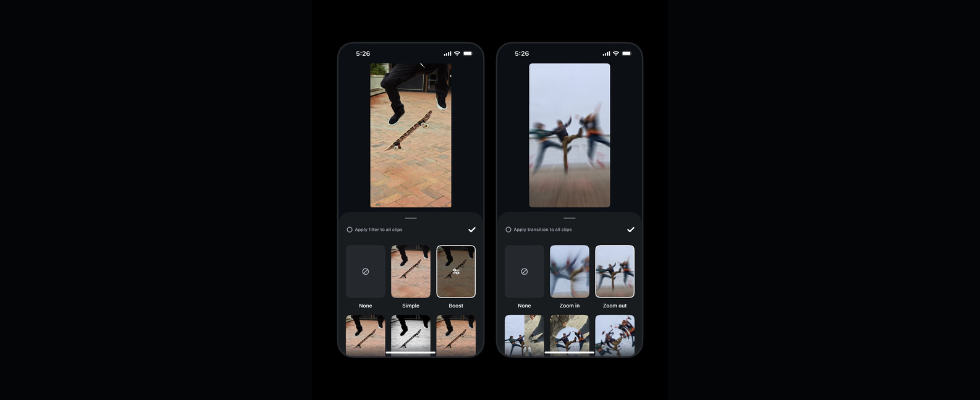








![Papst Donald und die KI [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)