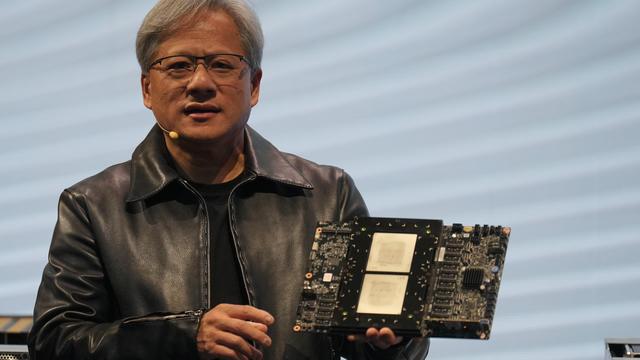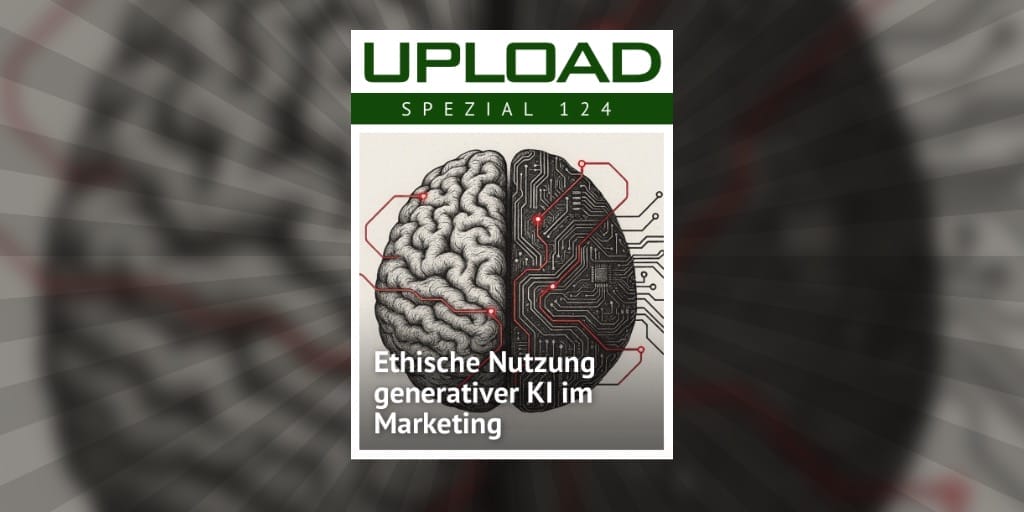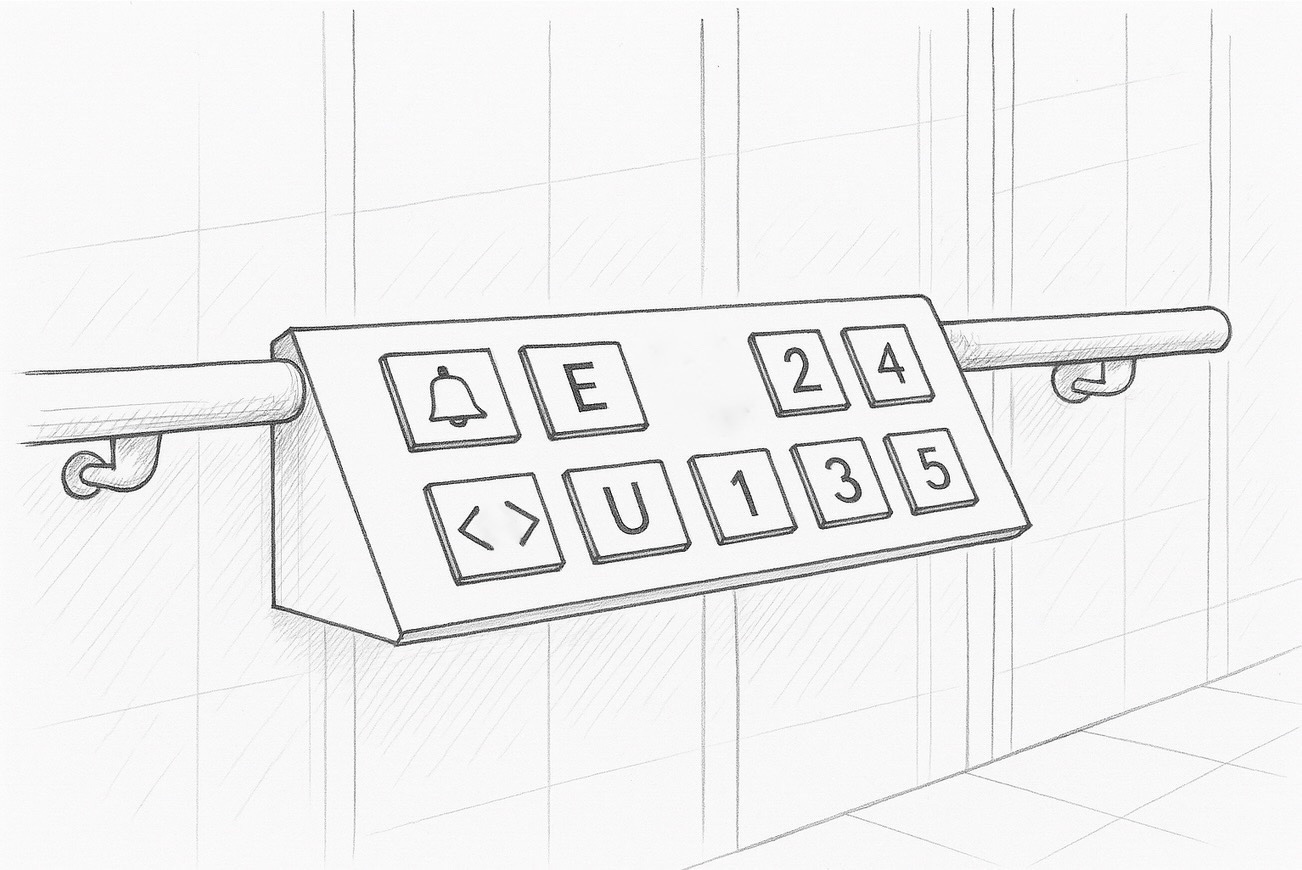Zinsentscheid: Warum Sparer wegen Donald Trump weniger Zinsen bekommen
Die Europäische Zentralbank wird noch diese Woche die Leitzinsen weiter senken. Das ist aus Sicht von Verbrauchern eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich

Die Europäische Zentralbank wird noch diese Woche die Leitzinsen weiter senken. Das ist aus Sicht von Verbrauchern eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich
Nach rund einem Monat ist die Wachstumseuphorie für Europa schon wieder verflogen. Statt deutschem Finanzwumms dominiert Donald Trumps Zollhammer das Geschehen an den Kapitalmärkten. Damit hat sich auch die Hoffnung zunächst verflüchtigt, Europa werde von steigenden deutschen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung einen Wachstumsschub erhalten. Stattdessen droht Europa und Deutschland nun eine Rezession wegen der Zollpolitik von US-Präsident Trump, die hierzulande insbesondere bei Rechtspopulisten Unterstützung findet.
Noch zu Jahresbeginn waren viele Ökonomen davon ausgegangen, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um drei Prozent wachsen wird – und da war schon eingerechnet, dass die USA ihre Zollsätze etwas anheben und damit den Welthandel erschweren. „Die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen und der Eskalation zwischen den USA und China stellt diese Entwicklung infrage“, betont Jens Eisenschmidt, Europa-Chefvolkswirt von Morgan Stanley. „Infolgedessen ist zu erwarten, dass Investitionen zurückgehalten werden und die Unternehmen eine defensive Haltung einnehmen.“
Zölle lösen Rezession aus
Eisenschmidts Kollege Sven Jari Stehn von Goldman Sachs hat vor diesem Hintergrund seine Wachstumsprognose für Europa gesenkt und rechnet für dieses Jahr mit einer Stagnation der Eurozone. „Wir erwarten nun für den Rest des Jahres fast kein Wachstum mehr und sehen die Wirtschaft der Eurozone am Rande einer technischen Rezession“, betont der Europa-Chefvolkswirt.
Als technische Rezession gilt eine Situation, in der eine Volkswirtschaft zwei Quartale in Folge schrumpft. Erst im Zeitraum 2026/27 könnte das Wachstum wieder anziehen, und zwar „auf der Grundlage einer expansiveren Finanzpolitik“. Der deutsche Finanzwumms könnte also doch noch seine Wirkung entfalten.
„Hatte die Europäische Zentralbank auf ihrer letzten Sitzung im März eine Zinspause noch nicht vollkommen ausgeschlossen, wird sie nun von der neuen handelspolitischen Realität eingeholt“, sagt Ulrike Kastens, Europa-Volkswirtin der DWS. „Durch die deutliche Anhebung der Zölle auf europäische Exporte in die USA und die damit verbundene Unsicherheit sind die Abwärtsrisiken für die Konjunktur 2025 deutlich gestiegen.“ Vor dem von Trump als „Tag der Befreiung“ titulierten Tag der Verkündung hoher Zollsätze hatte die EZB signalisiert, dass sie im April die Zinsen unverändert lassen werde.
Zinssenkung gilt als gesetzt
Vor diesem Hintergrund wird EZB unter Führung ihrer Präsidentin Christine Lagarde am kommenden Donnerstag über ihre Geldpolitik entscheiden. Für den Markt ist die Sache ganz klar: Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wird laut LSEG-Daten mit rund 99 Prozent beziffert und gilt damit als gesetzt. Dies wäre dann die sechste Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte, womit der als Leitzins fungierende Einlagensatz auf 2,25 Prozent sinken würde.
Damit aber nicht genug: Aktuell preist der Markt laut LSEG-Daten zwei weitere Zinssenkung der EZB um jeweils 25 Prozent in diesem Jahr ein, und zwar auf 2,0 Prozent im Juni und 1,75 Prozent im September. Für den Zeitraum bis September 2026 signalisieren die Terminmärkte einen Leitzins von 1,6 Prozent, es könnte also noch eine weitere Senkung geben.
Nun orientiert sich die EZB nicht primär am Wachstum und hat anders als die US-Notenbank auch nicht das Mandat zur Ankurbelung der Konjunktur. Ihr Auftrag heißt Preisstabilität und die sieht sie bei einer Inflationsrate von 2,0 Prozent als gegeben an. Dieser Wert ist nahezu erreicht, denn im März lag die Euro-Inflationsrate nur noch bei 2,2 Prozent. Die Kernrate, welche schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, lag noch bei 2,4 Prozent.
Inflation könnte zu stark fallen
Nach Eisenschmidts Einschätzung wird die EZB sich aber „wahrscheinlich davor hüten, ein deutliches Signal an den Markt zu senden, dass sie die Zinssenkungen abgeschlossen hat: Ein Hinweis darauf, dass die Zinssätze immer noch als restriktiv angesehen werden, wird wahrscheinlich in der Erklärung verbleiben.“ Mit anderen Worten: Angesichts der niedrigeren Inflationsrate und vor allem der sinkenden Inflationserwartungen könnte der EZB-Leitzins bald zu hoch sein und zur Folge haben, dass die Inflation unterschießt, also deutlich unter das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank sackt.
Neben der schwachen Konjunktur wegen Trumps Zolleskapaden dürften weitere Faktoren für eine niedrigere Euro-Inflation in nächster Zeit sprechen. Beides sind Nebeneffekte der US-Politik: billigeres Öl und ein stärkerer Euro. Der Ölpreis war jüngst wegen der Aussicht auf eine sinkende Nachfrage unter 60 Dollar gefallen, während sich der Euro in den vergangenen beiden Wochen um rund 6 US-Cent auf 1,14 Dollar verteuerte. Weil viele Einfuhren in Dollar abgerechnet werden, darunter auch die meisten Energieimporte, drückt ein stärkerer Euro die Inflation.
Disinflationärer Impuls aus China
Hinzu kommt die Perspektive, eines „vermehrten Angebotes von eigentlich für die USA bestimmten Gütern“, wie Kastens erläutert. „Mit Blick auf die Zukunft sind weitere Abwärtsrisiken für die Euro-Inflationsaussichten zu erwarten, da ein disinflationärer Impuls aus China, welches seine Waren zu einem niedrigeren Preis auf den europäischen Märkten absetzen will, sowie niedrigere Energiepreise und die Aufwertung des Euro zu erwarten sind“, sagt Michael Krautzberger, Chefanlagestratege für Rentenmärkte bei Allianz Global Investors.
Aus Sicht von Privatanlegern ist die voraussichtlich weiter nachlassende Teuerung also eine gute Nachricht. Ihr steht aber entgegen, dass in Folge der sinkenden Leitzinsen die Zinsen auf Bankeinlagen weiter sinken werden. Zugleich werden Trumps Zölle auch in Deutschland Jobs kosten, was politisch jenen nützen könnte, die ausgerechnet diese Politik öffentlich rechtfertigen.
Letztlich gibt es aber auch noch eine gute Nachricht für die Eurozone, meint Ökonom Eisenschmidt: „Die Geldpolitik hat Spielraum, um den Wachstumsschock abzufedern, den wir für wahrscheinlich halten.“