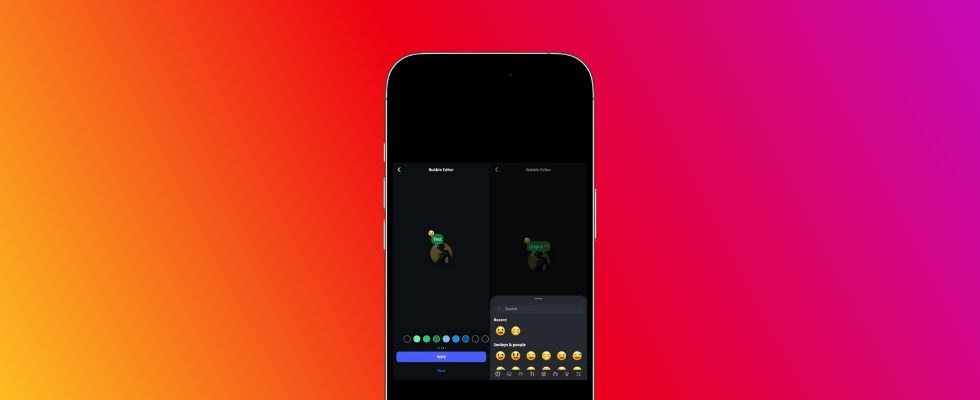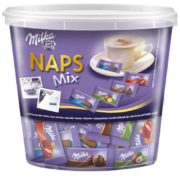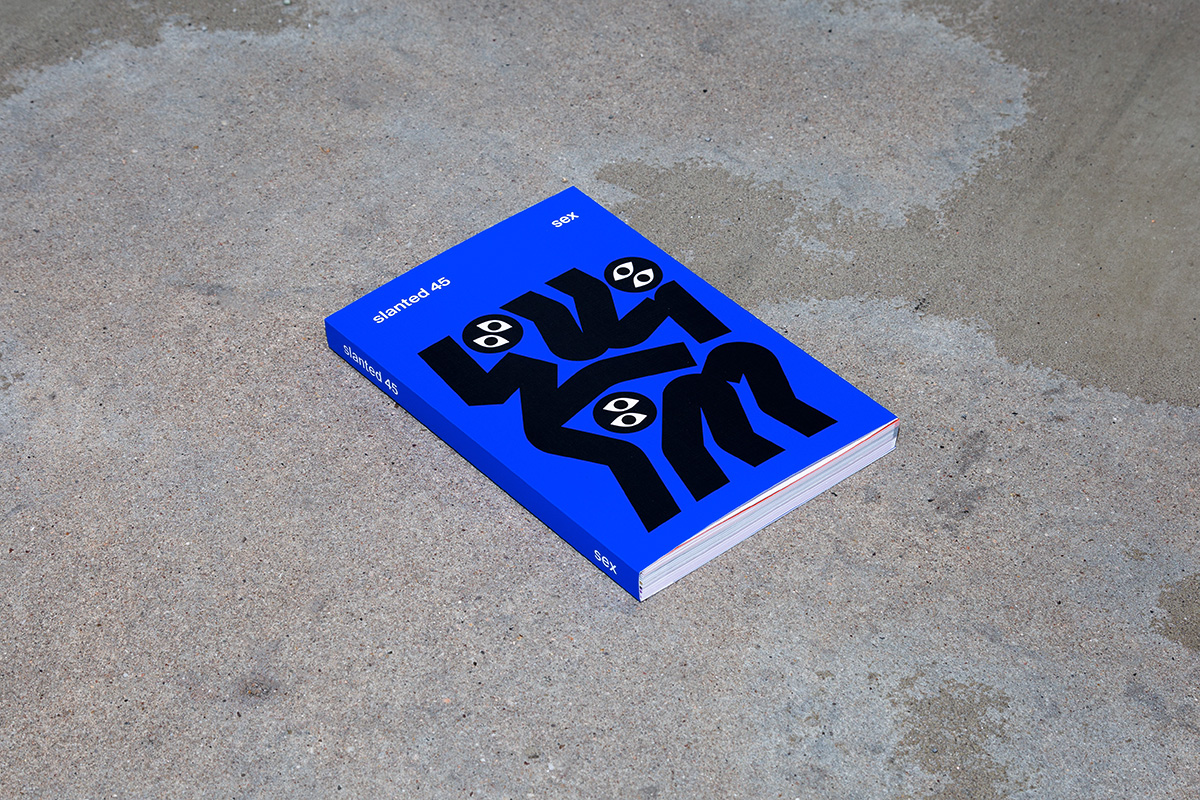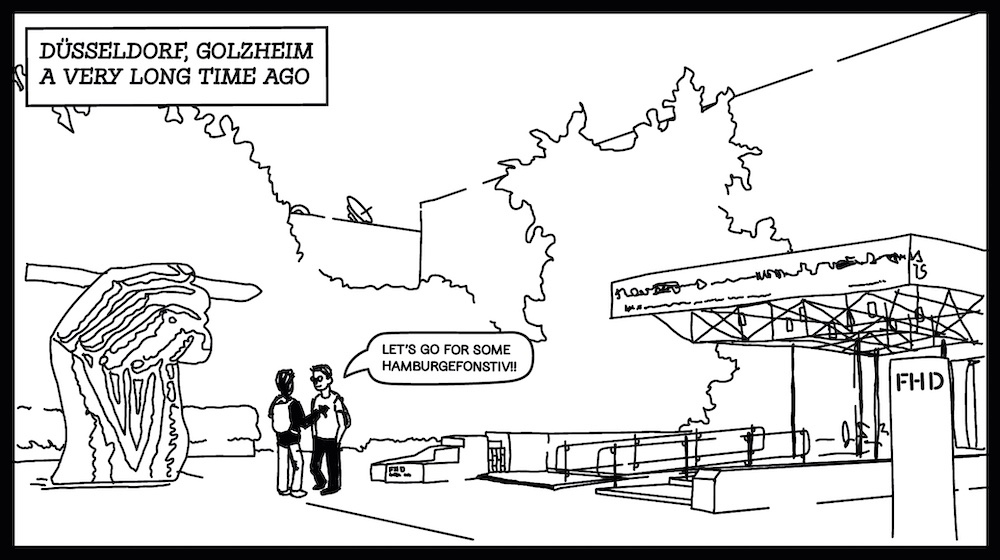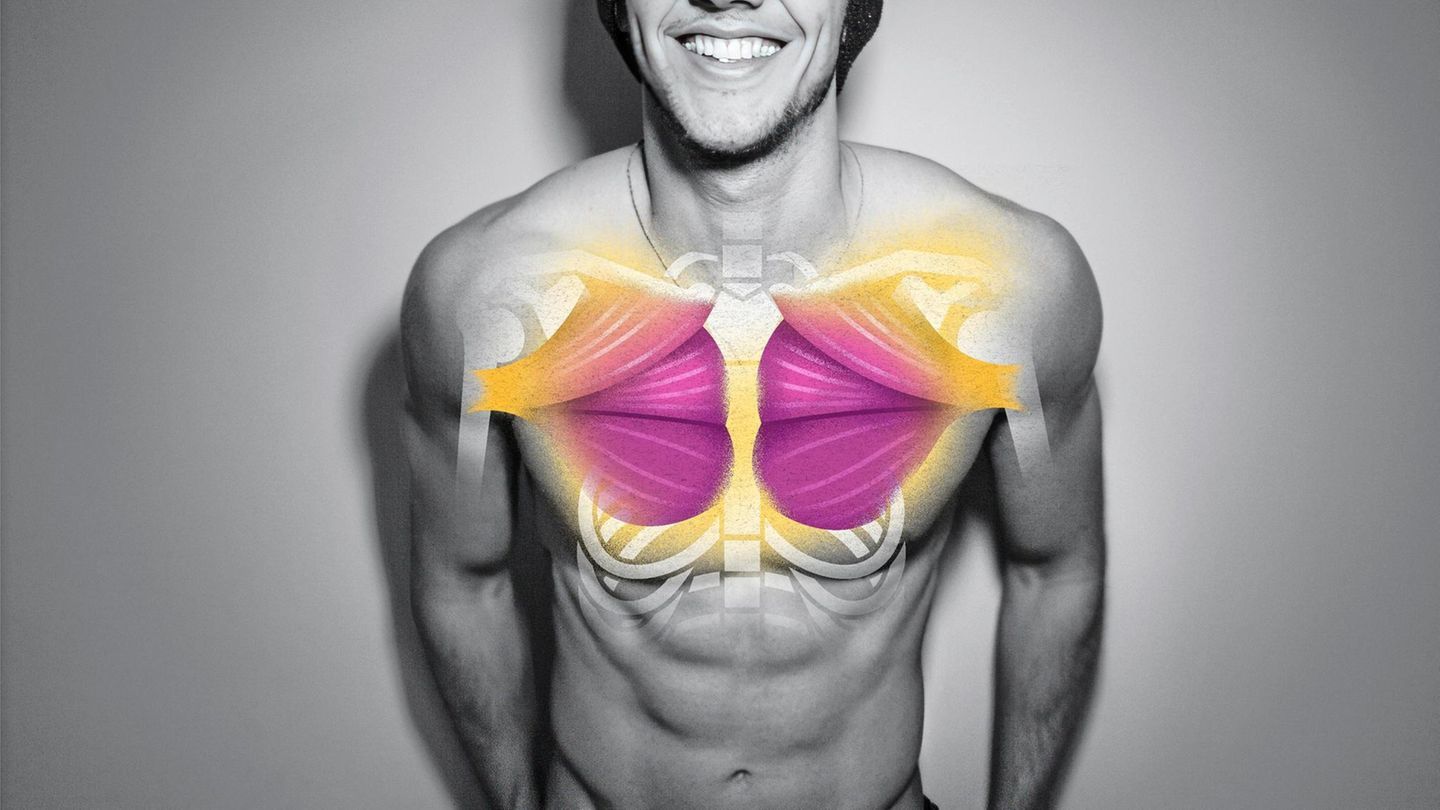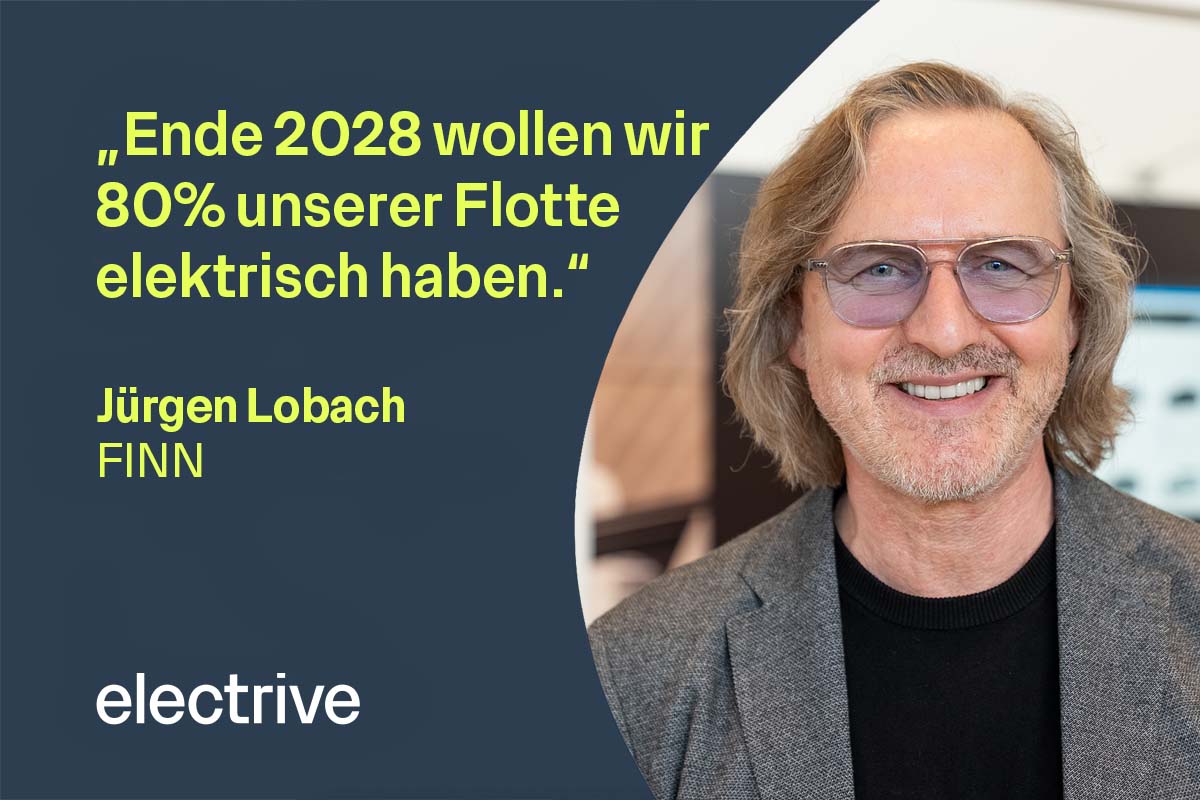Trumps Zölle: „China wird als Exportmarkt immer unattraktiver“
Unter dem Druck der US-Zölle rückt China näher an Europa heran. IW-Ökonom Jürgen Matthes erklärt, wie die EU und Deutschland damit umgehen sollten und warum sie die eigenen Interessen vernachlässigen dürfen

Unter dem Druck der US-Zölle rückt China näher an Europa heran. IW-Ökonom Jürgen Matthes erklärt, wie die EU und Deutschland damit umgehen sollten und warum sie die eigenen Interessen vernachlässigen dürfen
Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist ein Problem für die deutsche Wirtschaft. China bietet sich derweil als vermeintlich verlässlicher Partner an. Wie bewerten Sie das?
JÜRGEN MATTHES: China sieht im Zoll-Chaos von Trump eine Chance, dass Deutschland und Europa sich wieder annähern. Einige EU-Länder lassen sich nur allzu gern von Trump in die Arme Chinas treiben. Da müssen wir aber sehr vorsichtig sein, denn: Die Probleme, die wir im Handel, aber auch politisch mit China haben, lösen sich durch den von Trump angezettelten Handelskonflikt nicht in Luft auf.
Die Volksrepublik entwickelt sich also nicht zu einem attraktiveren Handelspartner?
China tut zwar wieder ein wenig mehr für sein eigenes Wachstum. So hat Peking den Konsum etwas angekurbelt und europäischen Firmen wieder mehr den roten Teppich ausgebreitet, – das aber nur, weil die chinesische Wirtschaft schwächelt. Hinzu kommt: Die Drohgebärden gegenüber Taiwan und im Südchinesischen Meer werden eher mehr als weniger. Auch die Gefahr, dass China uns von kritischen Importen abschneidet, ist nicht verschwunden. Hinzu kommt: China wird als Exportmarkt immer unattraktiver. Deutschland hat in den vergangenen beiden Jahren rund 16 Prozent weniger Waren nach China exportiert.

© PR
Woran liegt das?
Das liegt zum einen an der schwächelnden konjunkturellen Nachfrage in China in letzter Zeit. Aber auch daran, dass China Importe immer mehr durch heimische Produkte ersetzen will. Zudem bedienen deutsche Firmen den dortigen Markt zunehmend mit Produktion vor Ort und weniger mit Exporten: in China für China heißt das Prinzip. Damit wollen sie sich unabhängiger von Konflikten in der Handels- und Geopolitik machen, spielen damit aber China in die Hände. Das Problem für uns aktuell: Trump verstärkt diese Tendenz noch, weil er den Handelskrieg mit China noch sehr viel weiter verschärft.
Wie wichtig ist der Handel mit China für Deutschland?
Das Bild ist hier gespalten. Die Bedeutung Chinas für unseren Export hat zuletzt stark abgenommen. Im Jahr 2020 war China noch das zweitwichtigste Exportzielland für uns, im Jahr 2024 reichte es nur noch für Rang 5. Wir exportieren inzwischen mehr Waren nach Polen als nach China. Aber auf der Importseite bleibt China mit großem Abstand der wichtigste Partner. Da hat sich deutlich weniger bewegt. Im vergangenen Jahr ging der Wert der Importe aus China zwar leicht zurück, aber wegen sinkender Preise haben wir mengenmäßig sogar rund 8 Prozent mehr eingeführt. Importseitiges De-Risking sieht anders aus.
Die deutsche Wirtschaft macht Druck. In China tätige Unternehmen fordern die Bundesregierung auf, die Volksrepublik nicht länger als Gegner, sondern wieder mehr als Partner zu sehen. Wie gefährlich wäre so eine Kehrtwende?
Deutsche Unternehmen in China wittern durch Trumps aggressive Zollpolitik Morgenluft und wollen die Situation für sich nutzen. Und China bewegt sich durchaus auf sie zu und baut einige Hemmnisse für sie ab. Die deutsche Politik bringt diese Situation aber in einen Interessenkonflikt. Denn China wird sich nicht fundamental verändern. Der Systemkonflikt bleibt und auch Chinas Subventionspolitik verzerrt weiterhin den internationalen Wettbewerb zulasten deutscher Produktion.
Und wie soll die neue Bundesregierung darauf reagieren?
Die deutsche Politik muss klar abwägen: Was ist im Interesse des heimischen Standorts und was ist im Interesse der heimischen Firmen? Wenn die Interessenlage gleich ist: wunderbar. Sollte das nicht der Fall sein, müssen die Standortinteressen ganz klar im Vordergrund stehen. Dass momentan immer mehr in China für China produziert und weniger dorthin exportiert wird, geht tendenziell zu Lasten der heimischen Beschäftigung. Das kann nicht im Interesse des Standorts Deutschland sein.
Kommt Peking Europa denn in der aktuellen Situation entgegen?
Ja, in ganz kleinen Trippelschritten. Wir sehen Annäherungsversuche nicht nur bei den Investitionsbedingungen in China, sondern auch mit Blick auf die Sanktionen gegenüber europäischen Parlamentariern. Die könnten eventuell bald zurückgenommen werden. China geht diese Schritte auf Europa zu, weil es den europäischen Markt braucht, um seine Wachstumsziele zu erreichen. Dafür ist es auf steigende Exporte angewiesen. Trumps Zollkrieg mit China bedroht diese Strategie jedoch. Denn die USA haben im letzten Jahr Waren im Wert von 440 Mrd. US-Dollar aus China importiert. Ein Großteil davon wird nicht mehr in den USA verkauft werden können, wenn Trump die Zölle auf chinesische Einfuhren nicht sehr deutlich wieder senkt. Das setzt China stark unter Druck.
Wäre es denn aus wirtschaftlicher Sicht für die EU clever, den Annäherungsversuchen Chinas offen gegenüber zu sein?
Ja, absolut. Europa sollte dieses Momentum jetzt für seine eigen Ziele nutzen. Aber wir müssen uns sehr genau überlegen, an welchen Stellen wir von China Entgegenkommen fordern. Hier geht es weniger um eine Verbesserung der Investitions- und Geschäftsbedingungen in China. Das macht Peking schon aus Eigeninteresse von allein. Wir sollten vielmehr darauf schauen: Was bringt dem europäischen und dem deutschen Standort sowie den heimischen Arbeitsplätzen ganz konkret einen Vorteil?
Woran denken Sie dabei?
Drei Bereiche stehen dabei für mich vorn auf der Liste. Eine Yuan-Aufwertung, fairere Wettbewerbsbedingungen und mehr Technologietransfer in Bereichen, in denen wir gegenüber China zurückgefallen sind. Fangen wir hinten an: Chinesische Unternehmen investieren in den letzten Jahren ab und zu in der EU in neue Fabriken – etwa für die Produktion von Batterien oder E-Autos. In diesen Bereichen sind sie inzwischen technologisch vorn. Aber meist bauen sie hier nur die Zulieferteile zusammen. Auch die chinesische Regierung will einen Technologietransfer in aller Regel verhindern, obwohl das selbst ein zentraler Teil ihrer Entwicklungsstrategie für China war. Daher sollte die EU nun China zu zweierlei drängen: erstens, dass chinesische Firmen hier mehr investieren und zweitens, dass der Technologietransfer jetzt auch in die umgekehrte Richtung geht. Wenn das nichts fruchtet, könnten wir im Übrigen auch über entsprechende Vorschriften nachdenken.
Und wie könnte China faire Wettbewerbsbedingungen garantieren?
China sollte die vielen Subventionen im eigenen Land abbauen. Denn diese verzerren den internationalen Wettbewerb, wenn chinesische Unternehmen ihre Produkte ins Ausland verkaufen. Dass Peking dazu bereit ist, halte ich allerdings nicht für besonders wahrscheinlich. Schließlich müsste China dafür sein ganzes System umkrempeln. Trotzdem gehört eine solche Forderung zwingend mit auf die Liste.
Und was hat es mit der Yuan-Aufwertung auf sich?
China sollte seinen Wechselkurs gegenüber dem Euro aufwerten. Seit 2020 hat der Yuan aus deutscher Sicht real um rund 20 Prozent gegenüber dem Euro abgewertet. Das liegt daran, dass bei uns die Erzeugerpreise seit 2020 um rund 40 Prozent gestiegen sind, in China aber kaum. Parallel zu diesen stark gestiegenen deutschen Kostennachteilen stieg unser Handelsbilanzdefizit mit China massiv an. Würde China seinen Wechselkurs wie den Euro flexibel auf Angebot und Nachfrage reagieren lassen, hätte der Yuan in Reaktion auf das steigende Handelsbilanzdefizit deutlich aufgewertet. Das ist aber nicht passiert, weil China seinen Wechselkurs politisch steuert. Das bedeutet einen massiven Kostennachteil für deutsche Firmen im Wettbewerb mit China – zu Hause, in Europa und auf dem Weltmarkt. Daher ist die Yuan-Aufwertung gegenüber dem Euro für mich aktuell wohl die wichtigste Forderung.
Chinas Exporte in die USA dürften stark sinken. Die Befürchtung: Die Volksrepublik wird nicht nur Deutschland, sondern auch Europa mit chinesischen Produkten überschwemmen. Ist diese Angst berechtigt?
China muss sich jetzt auf die Suche nach neuen Absatzmärkten machen. Schließlich wollen die betroffenen Unternehmen vermeiden, dass ihre Geschäfte zusammenbrechen und sie schließen müssen. Genauso wird die chinesische Regierung viele Hebel in Bewegung setzen, um Arbeitslosigkeit in Firmen zu verhindern, die stark auf den US-Markt angewiesen sind. Chinesische Unternehmen haben bei der Umlenkung ihrer Exporte sicher zunächst die asiatischen Nachbarländer im Blick, zum Teil auch Lateinamerika. Aber auch der europäische Markt wird wohl mit chinesischen Produkten geflutet werden. Denn weil die EU-Staaten wie die USA hoch entwickelte Industrieländer sind, sind EU-Kunden den US-Abnehmern wohl ähnlicher als Käufer in den Schwellenländern.
Wie kann die EU gegen dagegen vorgehen?
Wenn nun tatsächlich mehr Produkte importiert werden oder chinesische Unternehmen versuchen, ihre Waren zu Niedrigpreisen auf den europäischen Markt zu bringen, müssen wir genau beobachten, in welchen Bereichen das passiert.Wenn es sich um Produkte handelt, für die wir keine eigene Produktion haben, können wir von den Vorteilen eines Überangebots profitieren und uns über die dadurch niedrigeren Preise freuen. Wenn jedoch heimische Produktionsbetriebe existieren und die günstigen Importe aus China diese bedrohen, müssen wir uns überlegen, wie man dem entgegenwirkt. Die EU könnte gegen unfaire Warenströme vorgehen, indem sie Handelschutzmaßnahmen wie Antidumpingzölle oder Importbeschränkungen einführt.
Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.