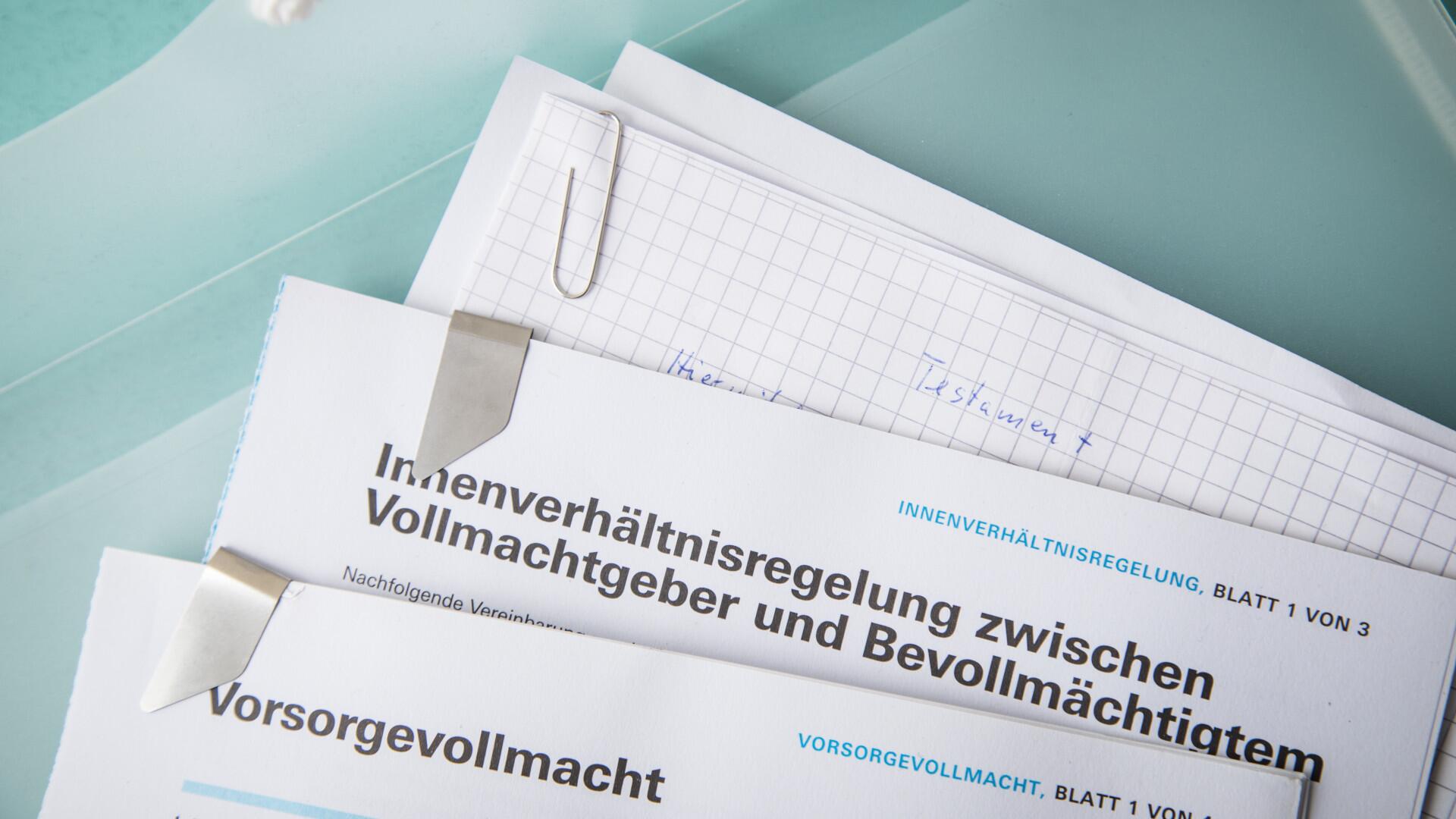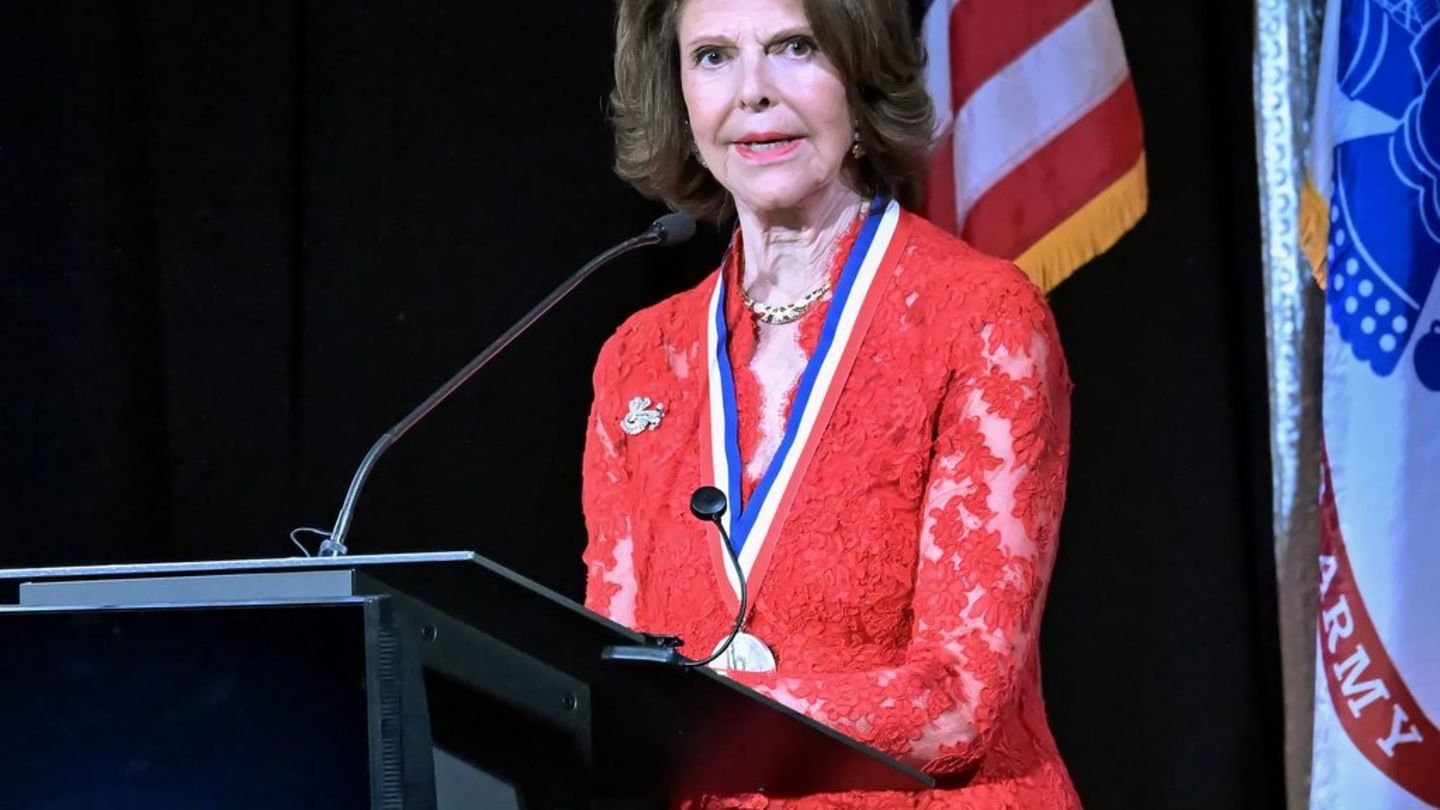Therapie als Konfliktgrund: "Ich muss ja eine schlimme Mutter gewesen sein"
Negative Kindheitsprägungen können uns bis ins Erwachsenenalter belasten. Wie wir konstruktiv mit unseren Eltern zu schwierigen Kindheitserfahrungen ins Gespräch kommen können – ohne vorwurfsvoll zu werden.
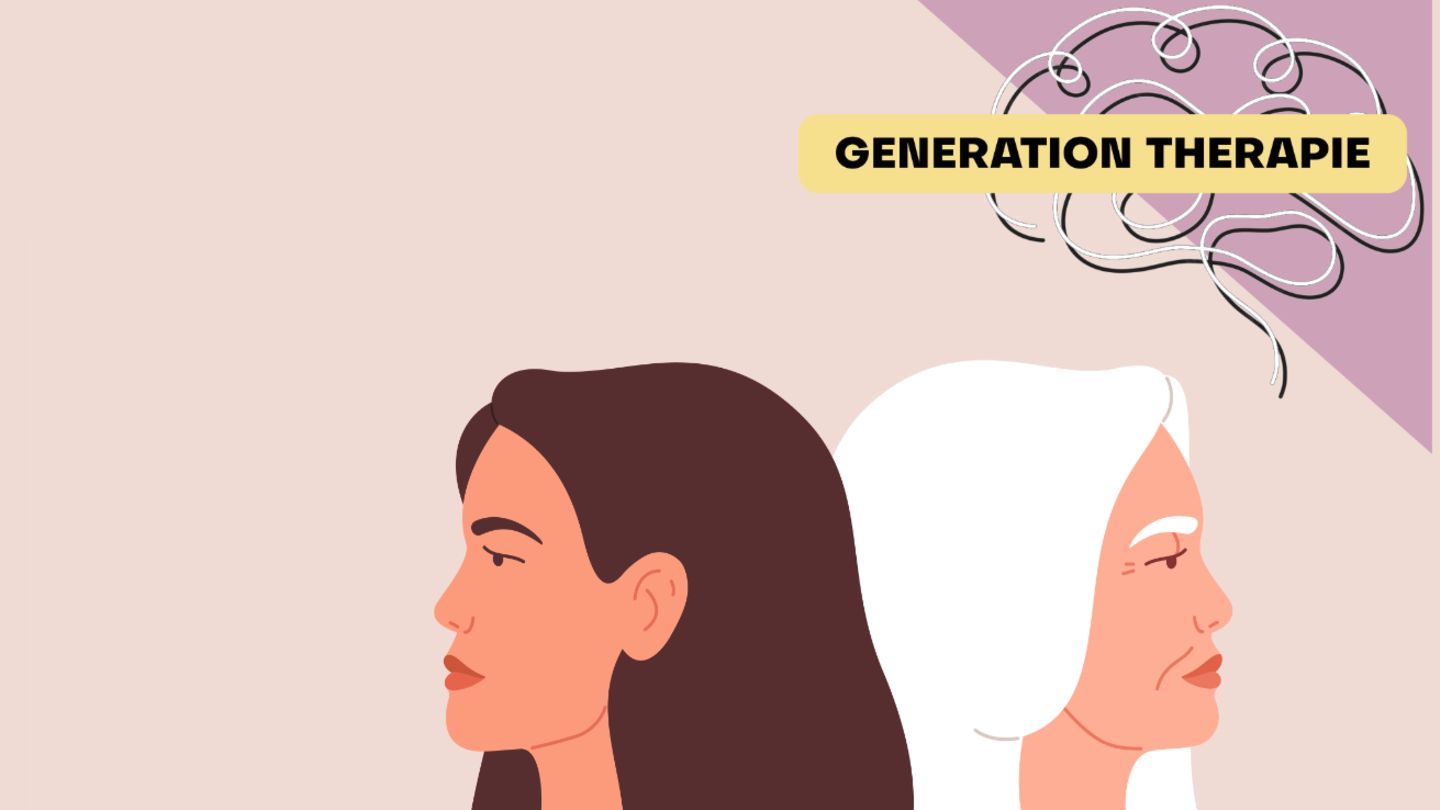
Negative Kindheitsprägungen können uns bis ins Erwachsenenalter belasten. Wie wir konstruktiv mit unseren Eltern zu schwierigen Kindheitserfahrungen ins Gespräch kommen können – ohne vorwurfsvoll zu werden.
Wenn wir unsere Kindheit als Fundament betrachten, als Basis, die uns im späteren Leben stützt, können uns negative Erfahrungen in jungen Jahren ganz schön ins Wanken bringen – auch noch als Erwachsene. Das betrifft offensichtliche Traumata wie ein schwerer Verlust oder Misshandlungen. Aber auch wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kann uns das prägen. Das Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit etwa, oder das nach einem gesunden Umgang mit Emotionen.
So wie bei Jenny*, Einzel- und Scheidungskind; den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend hat sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter verbracht. Häufige Umzüge und wechselnde Partner der Mutter, die mal bei ihnen lebten, mal nicht, sorgten dafür, dass Jenny sich als Kind selten sicher gefühlt und kaum Stabilität erlebt hat. Stattdessen hat sie früh gelernt, ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse hintanzustellen und sich anzupassen.
Lernen wir in der Kindheit nicht, unsere Gefühle richtig zu erkennen, zu benennen und auf eine gesunde Art und Weise zu regulieren, kann das im Erwachsenenalter zu Problemen in unseren Beziehungen führen. Im Idealfall machen wir uns diese ungesunden Muster dann bewusst und arbeiten daran – vielleicht allein, in schwierigeren Fällen oder bei einer psychischen Erkrankung womöglich mithilfe einer Therapie.
Es kann schwierig sein, mit den Eltern über psychische Themen zu sprechen
Versuchen wir dann aber, unseren Eltern zu erklären, dass bestimmte Vorkommnisse in unserer Kindheit (oder der Umgang mit diesen) dazu geführt haben, dass wir heute psychische Probleme haben, fühlen sie sich oft angegriffen. "Viele Eltern reagieren verunsichert, wenn sie erfahren, dass ihr Kind therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt – oft aus Angst oder aus dem Gefühl heraus, versagt zu haben", erklärt dazu Prof. Dr. med. Petra Beschoner, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin und Ärztliche Leiterin der Akutklinik Bad Saulgau.
Außerdem gebe es häufig eine Diskrepanz in der Wahrnehmung: "Eine Kindheit, die für das Kind von Unsicherheit und Vernachlässigung geprägt war, kann von den Eltern als völlig 'normal' empfunden worden sein."
Therapie verliert Stück für Stück ihr Stigma – zum Glück
Gerade dann, wenn die Eltern eigene Erfahrungen aus der Kindheit mit sich herumtragen, die nie aufgearbeitet wurden. Jennys Mutter etwa hat einige Jahre ihrer Kindheit im Heim verbracht, ihr Vater war alkoholkrank und ist früh gestorben, die Mutter war überfordert und kaum verfügbar.
Während in früheren Generationen wie der von Jennys Mutter mentale Gesundheit und vor allem Therapie ein großes Tabu waren, wird die Psyche heute glücklicherweise als Teil einer ganzheitlichen Gesundheit gesehen und die Psychotherapie – langsam, aber sicher – als legitime Behandlungsmöglichkeit. Es sprechen immer mehr Menschen offen darüber, dass es ihnen nicht immer gut geht oder dass sie therapeutische Angebote in Anspruch nehmen, um bestimmte Erfahrungen zu verarbeiten oder Tools zu erlernen, mithilfe derer sie gesünder mit ihren Emotionen umgehen können.
So auch Jenny, die den Kreis der psychischen Erkrankungen, des Verdrängens von Emotionen und der Instabilität endlich durchbrechen wollte. Ihrer Mutter davon zu erzählen, war allerdings alles andere als leicht.
Warum Parentifizierung das Problem häufig verstärkt
"Viele Erwachsene möchten mit ihren Eltern über belastende Kindheitserfahrungen sprechen, doch oft ist die Hürde groß", bestätigt Prof. Beschoner. "Häufig fürchten Betroffene, ihre Eltern zu belasten oder in ihnen Schuldgefühle auszulösen – besonders, wenn sie früh gelernt haben, für das emotionale Wohl ihrer Eltern verantwortlich zu sein." Das nenne sich Parentifizierung.
Dieses Phänomen kennt auch Jenny: Ihre Mutter sei die einzige Konstante in ihrer Kindheit gewesen. "Dadurch standen wir uns immer sehr nah – vielleicht sogar zu nah." Ihr sei es im Rahmen der Therapie schwer gefallen, sich so weit zu distanzieren, dass sie überhaupt erst anerkennen konnte, dass bestimmte Dinge in ihrer Kindheit nicht optimal gelaufen seien. "Geschweige denn, dass ich es übers Herz gebracht hätte, meiner Mutter diese Gefühle zuzumuten."
Doch auch für Eltern sei ein solches Gespräch herausfordernd, so Prof. Beschoner. Viele hätten nie gelernt, über Gefühle zu sprechen, und halten an Glaubenssätzen wie "Man muss stark sein" oder "Früher ging es doch auch ohne Therapie" fest. "Hinzu kommt oft soziale Scham: Das Eingeständnis, dass in der Familie nicht alles gut lief, kann als Makel empfunden werden", erklärt die Psychotherapeutin.
Jenny hat sich trotz aller Sorgen getraut und offen mit ihrer Mutter über ihre Therapie gesprochen: "Um meine Mutter und unsere Beziehung nicht zu belasten, habe ich ihr zwar erzählt, dass ich eine Therapie mache, mir aber vorgenommen, keine Details mit ihr zu teilen." Aber ihre Mutter habe von sich aus immer wieder gefragt, vermutlich eben genau aus der Angst, was Jenny erzählen könnte und vor allem: was die Therapeutin ihr über ihre Kindheit "einreden" könnte.
"Na, ich muss ja eine schlimme Mutter gewesen sein"
Hin und wieder habe sie dann sogar einen konstruktiven Austausch mit ihrer Mutter gehabt, erzählt Jenny. In guten Momenten habe diese die Situation recht reflektiert betrachten können. An einen Satz erinnert Jenny sich besonders gut: "Wenn ich mir meine Themen früher angeschaut hätte, müsstest du heute vielleicht nicht die Therapie machen", sagte ihre Mutter einmal.
In anderen Momenten aber wurde sie eher ungehalten. "Na, ich muss ja eine schlimme Mutter gewesen sein, wenn es dir jetzt wegen mir nicht gut geht", polterte die Mutter manches Mal. Gefolgt von: "Dann müsste ich ja auch psychisch krank sein, denn meine Kindheit war ja viel schlimmer als deine."
Objektiv betrachtet war ihre Kindheit im Heim und mit alkoholkrankem Vater vermutlich stärker traumatisierend als die ständigen Umzüge, wechselnden Partner und generell fehlende Beständigkeit, denen Jenny in ihrer Kindheit ausgesetzt war. Aber mit einer solchen Aussage spricht die Mutter ihrer Tochter ihre Wahrnehmung und ihre Gefühle ab. Wie kann man in einer derart verfahrenen Situation konstruktiv ins Gespräch kommen?
Einander auf Augenhöhe begegnen – und Ambivalenz aushalten
Die Therapeutin Prof. Beschoner rät: "Hier kann es helfen, zunächst die Sichtweise der Mutter zu erfragen: 'Warum war das damals so? Wie hast du dein Leben gemeistert?' Ein Gespräch auf Augenhöhe kann die Tür für ein gegenseitiges Verständnis öffnen." Doch nicht immer seien Eltern bereit, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Manche müssen aus Selbstschutz an ihrer eigenen Interpretation festhalten. In solchen Fällen gilt es, die eigene Wahrnehmung nicht infrage stellen zu lassen – auch wenn der Elternteil es anders sieht."
Zu verstehen, was die Eltern zu den Menschen gemacht hat, die sie sind, könne heilsam sein, erklärt die Expertin. "Es bedeutet nicht, eigenes Leid zu relativieren – sondern, es in einen größeren Zusammenhang einzuordnen." Ein Schlüssel dafür sei die Fähigkeit, Ambivalenz auszuhalten: Man kann gleichzeitig traurig und wütend über eigene Verletzungen sein – und dennoch Mitgefühl für die Eltern empfinden.
Mit dieser Ambivalenz lässt es sich allerdings häufig nicht leicht leben. In der Praxis, also im Alltag, lassen sich einzelne Emotionen in diesem Gefühlscocktail – Wut, Trauer, Angst, Ungeduld, Frust, Mitgefühl, Liebe, Schuld – gar nicht so leicht trennen. "Wenn es gelingt, gemeinsam zu erkennen, dass belastende Kindheitserfahrungen kein Zeichen von persönlichem Versagen sind, sondern oft generationsübergreifende Prägungen widerspiegeln, kann das zu mehr Mitgefühl für sich selbst und für die Eltern führen."
Selbstwirksamkeit: Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen
Darin übt sich auch Jenny. In der Therapie lernt sie, ihre Gefühle anzunehmen und sie vor allem auch mal ihrer Mutter zuzumuten. Anders als ihrer Mutter ist es ihr mit Ende 30 inzwischen gelungen, sich ein stabiles Zuhause zu schaffen und eine zehnjährige, gesunde Beziehung zu führen. All das, was sie in ihrer Kindheit nicht erfahren und kennengelernt hat.
Letztlich sind Jenny und wir alle als Erwachsene für uns selbst verantwortlich. "In der Therapie geht es nicht darum, Schuldige zu finden, sondern Zusammenhänge zu verstehen", sagt Prof. Beschoner dazu. "Wer schwierige Kindheitserfahrungen anerkennt, ohne sich darin zu verlieren, kann lernen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen." Das bedeute nicht, die Vergangenheit schönzureden – sondern den eigenen Schmerz ernst zu nehmen und gleichzeitig die Kraft zu entwickeln, im Hier und Jetzt gut für sich selbst zu sorgen.
* Name von der Redaktion geändert




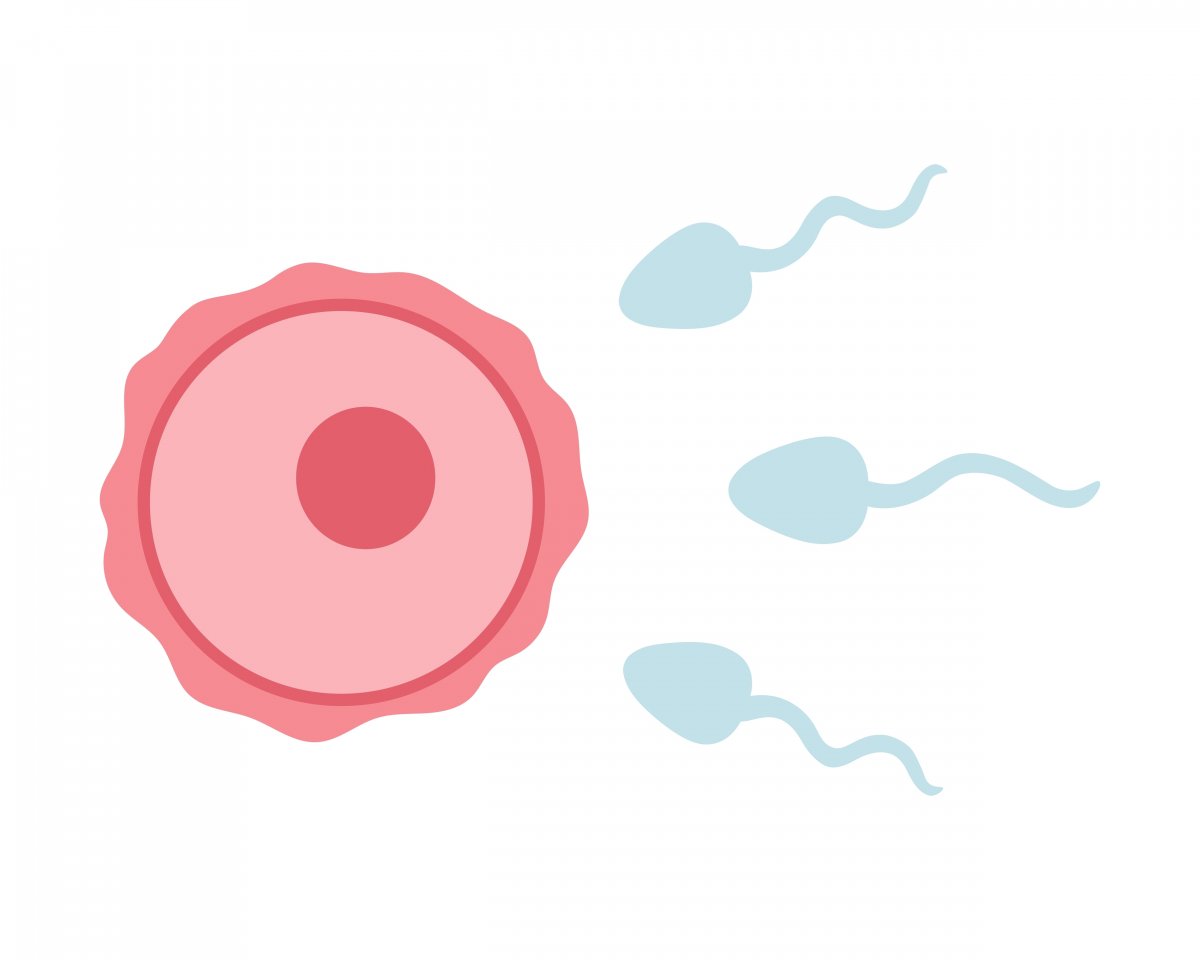











:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/13/ec13751e08dc47e78920c9b83b7d26d9/0123842412v2.jpeg?#)








,regionOfInterest=(1385,1002)&hash=1e8bd3f8af4265c3dfcd1dbf50b3cb150b21a6d0b584ae17ec831b57879dda92#)
,regionOfInterest=(890,570)&hash=62cf6fa3029d03dc568d12fd815d7f8fae2bc44c5eccdfd9f1aa45eb0e36e5c2#)