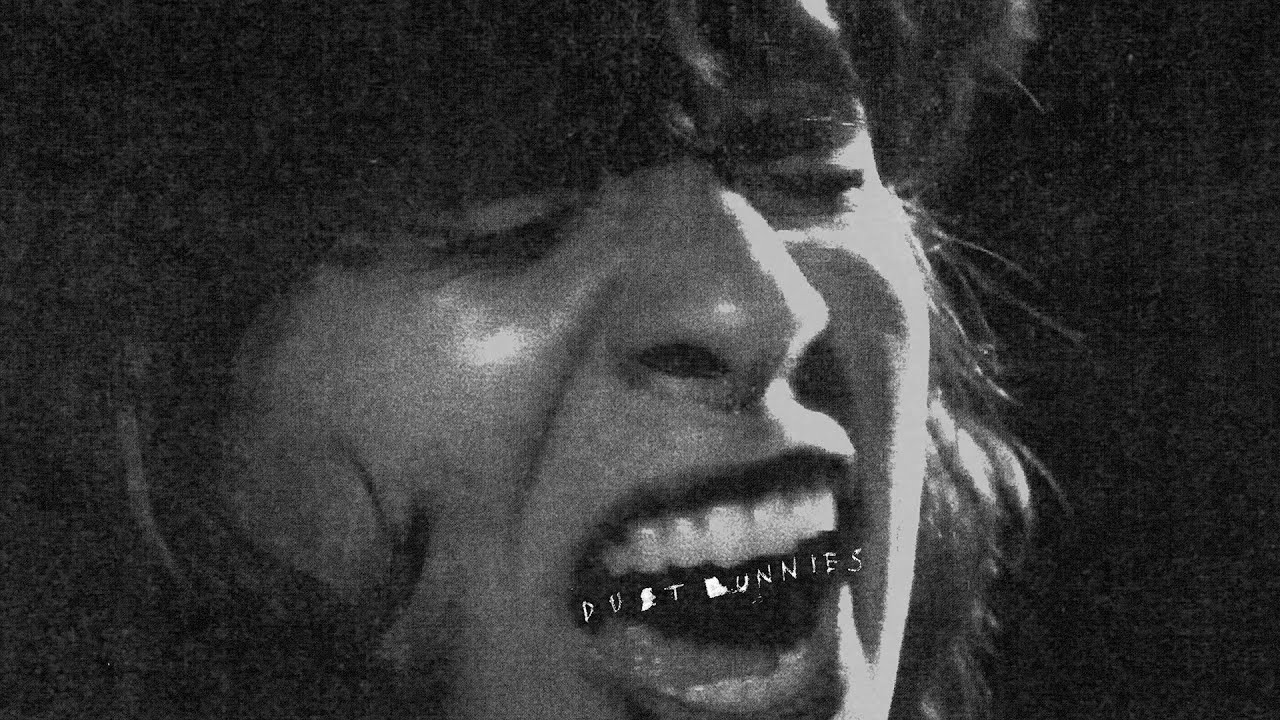Langzeitstudie: Nach 20 Jahren Beobachtung steht fest: Auch Vögel schließen Freundschaften
Dreifarben-Glanzstare pflegen außergewöhnliche Beziehungen, helfen einander. Nun sind sich Forschende sicher: Sie schließen sogar so etwas wie Freundschaften

Dreifarben-Glanzstare pflegen außergewöhnliche Beziehungen, helfen einander. Nun sind sich Forschende sicher: Sie schließen sogar so etwas wie Freundschaften
Menschenaffen tun es, Elefanten, Delfine, Hunde und Katzen auch: Sie schließen Freundschaften und unterstützen einander. Neuerdings zählen auch Dreifarben-Glanzstare zu den Tieren, die ausgewählte Beziehungen zu Artgenossen eingehen, mit denen sie nicht verwandt sind. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam, nachdem es das Verhalten des Dreifarben-Glanzstars 20 Jahre lang akribisch dokumentiert hat. Und die Forschenden haben auch eine Theorie, was die Tiere antreibt. Die Ergebnisse sind in der renommierten Fachzeitschrift "Nature" erschienen.
Die Vögel mit dem leuchtenden blau-rot-grünen Federkleid leben und brüten in Ostafrika in Kolonien von bis zu 60 Tieren. Dass eng verwandte Individuen einander bei der Aufzucht der Küken im harschen Savannenklima helfen, war schon länger bekannt. Solches Verhalten ist im Tierreich weit verbreitet. Indem sie nahen Verwandten helfen, sichern die Unterstützer letztlich auch den Fortbestand ihrer eigenen Gene. Hinter dem Altruismus steckt also eine gute Portion Eigennutz.
"Freunde" füttern die Jungen und verteidigen das Nest
Diese Form des Altruismus schließt die Hilfsbereitschaft zwischen nicht verwandten Individuen aus, könnte man meinen. Doch die Forschenden haben beobachtet, dass einzelne Dreifarben-Glanzstare einige Anstrengungen unternehmen, um auch ausgewählten Individuen zu helfen, mit denen sie nicht verwandt sind. Sie füttern zum Beispiel deren Junge oder verteidigen das Nest.
Für diesen seltenen Einblick war ein beträchtlicher Aufwand nötig: Die Forschenden beobachteten mit der Unterstützung von Studierenden zwischen 2002 und 2021 in Kenia neun Schwärme über 40 Brutperioden hinweg. Dabei dokumentierten sie das Verhalten einzelnder Tiere, beringten sie und nahmen DNA-Proben von 1175 Individuen, um den Verwandtschaftsgrad zwischen Vögeln zu bestimmen, die häufig miteinander interagierten.
Hilfst du mir, helfe ich nächstes Mal dir
Und weil sie die Vögel so genau beobachteten, machten die Forschenden noch eine weitere überraschende Entdeckung: Die Tiere tauschten nach einer Brutperiode die Rollen. Hatte in einer Saison ein Star ohne eigene Brut dem anderen geholfen, war es in der nächsten umgekehrt. Am Ende profitierten beide davon, weil ihr Nachwuchs erheblich bessere Überlebenschancen hatte. Aber es setzt auch ein erstaunliches Maß an Vertrauen und Planung voraus.
Nach menschlichen Maßstäben definiert sich Freundschaft zu einem guten Teil über Gegenseitigkeit: Freunde tun einander Gefallen und bekommen dafür in der Regel irgendwann etwas zurück. Fachleute sind zwar generell zurückhaltend, das Verhalten von Tieren zu vermenschlichen. Dustin Rubenstein, einer der Studienautoren von der Columbia-Universität, ist sich laut Pressemitteilung dennoch sicher: "Viele dieser Vögel schließen im Laufe der Zeit Freundschaft."
Vor allem Immigranten bauen Freundschaftsbeziehungen auf
"In der Regel bilden Einwanderer, die in die Gruppe kommen, starke soziale Beziehungen zu nicht verwandten Individuen", erklärt Rubenstein gegenüber "Science Alert". "Diese Einwanderer haben keine Verwandten, denen sie bei der Fortpflanzung helfen könnten, sodass sie beim Eintritt in die Gruppe neue soziale Beziehungen aufbauen müssen."
Doch auch in der Kolonie geborene Tiere unterstützten "Freunde" – selbst dann, wenn es Verwandte gab, denen sie stattdessen hätten helfen können. Des Weiteren fiel auf, dass die Tiere durchaus wählerisch waren und anderen keineswegs beliebig halfen, sondern nur mit ausgewählten Individuen wechselseitige Beziehungen eingingen.
Wechselseitigkeit ist kein menschliches Privileg
"Stare sind auf Helfer angewiesen, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Sie können Verwandte rekrutieren, die von den Genen profitieren, die sie mit dem Nachwuchs teilen; oder sie können nicht verwandte Individuen rekrutieren, indem sie langfristige soziale Bindungen eingehen," fasst Rubinstein das Motiv für die Freundschaften zusammen. "Das ist einer der stärksten Beweise dafür, dass Wechselseitigkeit auch fernab des Menschen vorkommt."
Auch wenn dies längst nicht die erste Studie zu kooperativem Verhalten im Tierreich ist, ist sie in ihrer Dauer und Detailtiefe doch einzigartig. Julia Schroder, Verhaltensökologin am Imperial College London, die an der Untersuchung nicht beteiligt war, sagt in der Zeitung "Guardian" über die Publikation: "Sie hilft uns, Altruismus und seine Entwicklung besser zu verstehen, denn er gibt uns immer noch Rätsel auf."
Als Nächstes wollen die Forschenden herausfinden, wie die Star-Freundschaften entstehen, warum manche über Jahre halten – und andere wieder vergehen.







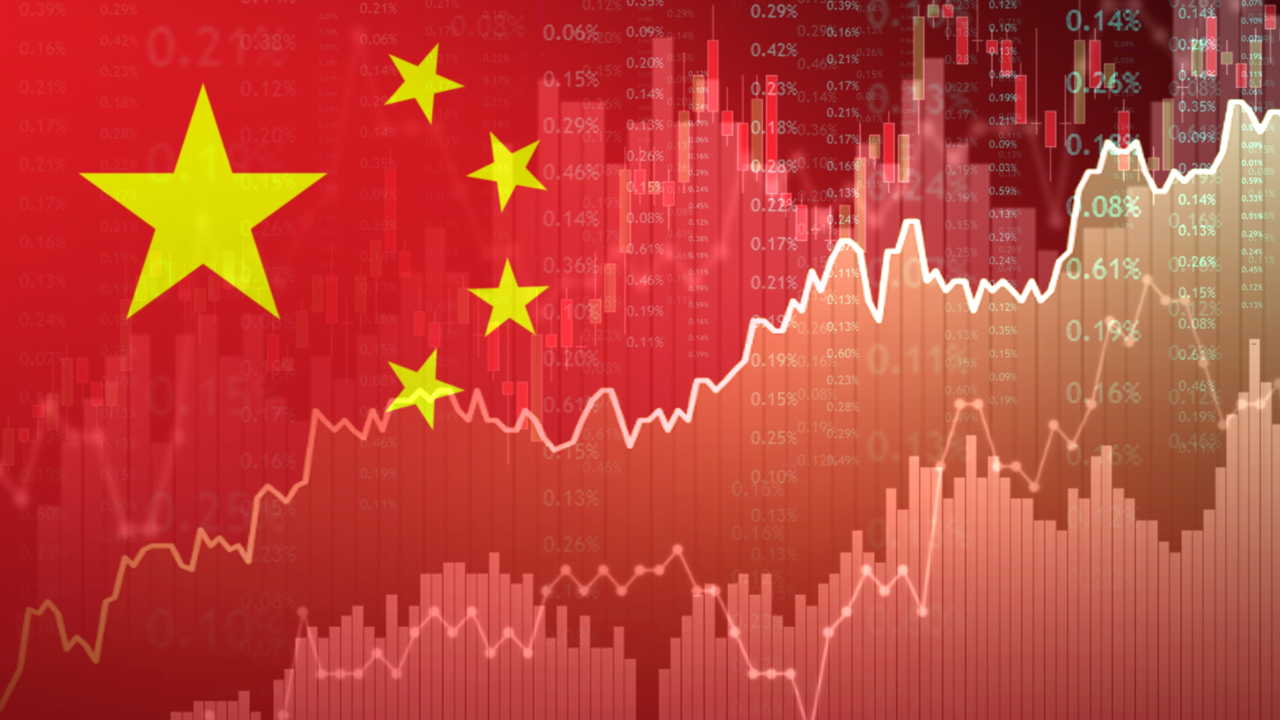







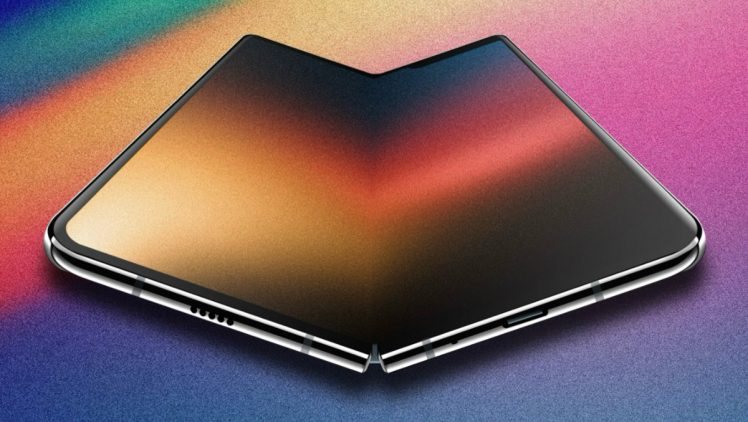







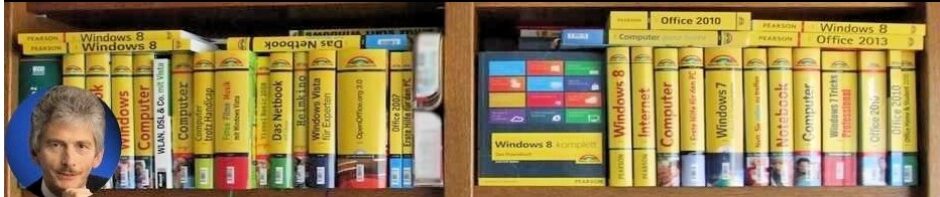
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/13/ec13751e08dc47e78920c9b83b7d26d9/0123842412v2.jpeg?#)