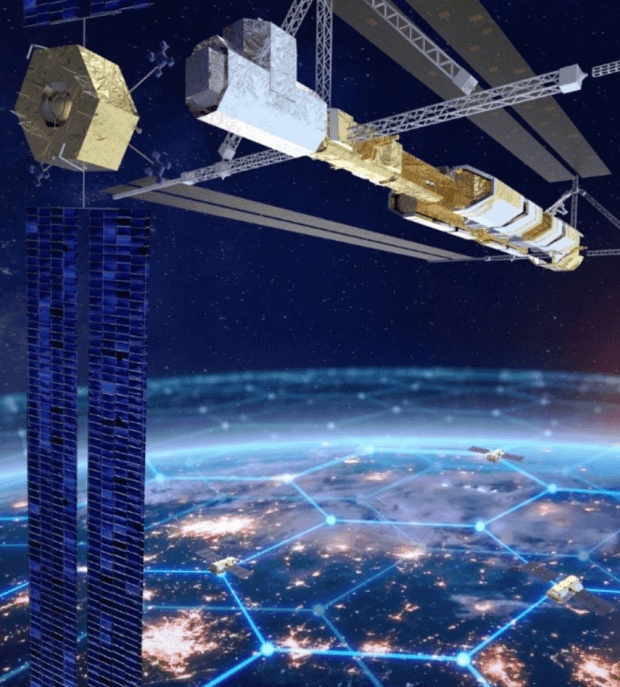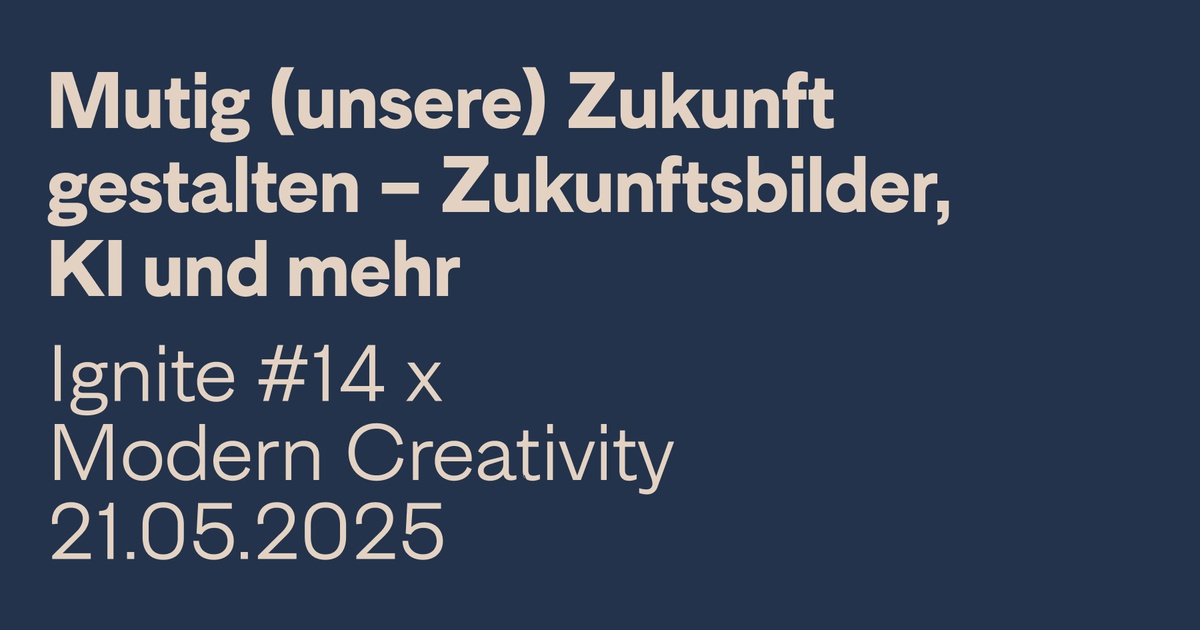Fußball in Berlin während der NS-Zeit: „Der Berliner Fußball war eine Stütze des Systems“
Als erster Regionalverband hat der Berliner Fußballverband seine Historie während der NS-Zeit aufarbeiten lassen. Die Studie zeichnet ein detailliertes Bild mit unbequemen Wahrheiten. Und möchte auch für die Gegenwart sensibilisieren.

Thomas Schneider, Sie und ein Team von Wissenschaftlern haben die Historie des Berliner-Fußballverbands (BFV) während der NS-Zeit untersucht. Wie kam es zu der Studie?
Den Anstoß dazu hat der Verband selbst gegeben. Der BFV ist der erste Landes- bzw Regionalverband, der sich des Themas annimmt und seine Vergangenheit während des NS-Regimes detailliert aufarbeiten lässt. Auch, wenn dabei selbstverständlich unschöne Wahrheiten über die eigene Geschichte zu Tage gefördert werden können. Natürlich sind die Landesverbände von ihren Möglichkeiten her ganz anders aufgestellt als ein Sportverband wie der DFB. Die Ressourcen sind deutlich geringer. Dass der BFV die Studie dennoch voller Überzeugung in Auftrag gegeben und die finanziellen Mittel bereitgestellt hat, verdient Anerkennung.
Welches Ziel verfolgt die Studie?
Einerseits natürlich die historische Aufarbeitung der eigenen Rolle während dieser Zeit. Andererseits, und dieser Punkt ist sehr wichtig, sollen aus dieser Studie auch Erkenntnisse und Handlungsableitungen für die Gegenwart gezogen werden. Doch das eine bedingt eben das andere. Mit einem klaren und informierten Bewusstsein darüber, was einmal war, kann man sehr viel besser auf die Gegenwart blicken. Und viele der Themen der Forschung sind hochaktuell: Antisemitismus, Ausgrenzung, das Erstarken des Rechtsradikalismus. Mit all diesen Themen ist auch der Fußball konfrontiert. Und beim BFV hat man glücklicherweise verstanden, dass man diesbezüglich aus der Vergangenheit lernen kann.
Wie gingen Sie also vor?
Als Landesverband ist der BFV sehr nah dran an der eigenen Basis. Neben dem ehrenamtlichen Präsidium gibt es in der Geschäftsstelle hauptamtliche Mitarbeiter. Diejenigen, die sich im Berliner Fußball engagieren, sind im Ehrenamt tätig und haben sich in ihre Ämter wählen lassen, in denen sie nun beispielsweise den Spielbetrieb oder die Schiedsrichterei organisieren. Und exakt diese Ebene dient auch als Fokus unserer Studie: Die Mikroebene des Berliner Fußballs und der Verbandsarbeit. Der BFV wollte erforschen lassen, inwiefern die neuen Regeln und Auflagen des NS-Regimes umgesetzt und von den Vereinen mitgetragen wurden. Wie Funktionäre oder Spieler sich in der Zeit ganz konkret im Fußballalltag verhalten haben. Ob der Verband zu dieser Zeit eine Stütze des Nazi-Systems war. Und auf Grund unserer Studie können wir nun sagen: Ja, das war er, auch wenn er „nur“ den Fußballsport organisierte. Und dabei ist wichtig zu wissen: Der Berliner Fußballverband hätte auch einfach sagen können: „Wieso denn eine Studie? Es gibt doch gar nichts zu erforschen!“.
Wie meinen Sie das?
Faktisch hat sich der Verband Brandenburgischer Ballspielvereine, wie er damals hieß, auf Druck des neuen Systems 1933 selbst aufgelöst. Fortan wurde der Verband als „Gau III“ bezeichnet und in den Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert. Erst 1949 wurde der BFV neugegründet. Aber: Es gab natürlich Kontinuitäten, was die handelnden Personen und die mitspielenden Vereine betraf. Wir wollten also wissen, inwiefern es bei den weiterhin aktiven Personen und Klubs zu Anpassungen an das Nazi-System kam. Wir wollten wissen, wie diese Akteure auf die immer strenger werdenden Vorgaben des Regimes reagiert haben. Um so genau wie möglich nachweisen zu können, wie sich der Berliner Fußball während dieser Zeit verhalten hat.
Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Wir haben schnell erkannt, dass es eine besondere Struktur für diese Studie braucht. Wir wollten keinen Wissenschaftler beauftragen, der dann im stillen Kämmerlein tüftelt und irgendwann seine Ergebnisse präsentiert. Wir haben die Struktur vielmehr unserem Forschungszweck – der Betrachtung der Mikroebene – angepasst. Wir wollten nicht nur den Verband als handelnde Organisationsstruktur in den Blick nehmen, sondern haben Unterthemen formuliert und dafür Wissenschaftler – in einem Fall ein Tandem – mit der Bearbeitung beauftragt. Wir haben uns gefragt: Welche Rolle spielten die Vereine? Sie mussten die Leitlinien des Verbands bzw. der Sportführung im NS-Staat, wie beispielsweise die Einführung des Arier-Paragraphen, ja schlussendlich umsetzen. Aber haben sie das auch wirklich gemacht? Welche Rolle spielten die einzelnen Menschen innerhalb der Vereine? Wer waren die überhaupt und welche Überzeugungen hatten sie? Und wie erging es den Opfern, also: den jüdischen Mitmenschen? Den Menschen, die in dieser Zeit vom Vereinsleben ausgeschlossen wurden. Wie haben sie darauf reagiert? Heute wissen wir: Während des Beginns des NS-Regimes haben sich kurzzeitig etliche jüdische Fußballklubs gegründet, die selbstverwaltet einen richtigen Spielbetrieb mit Ligasystem und Turnieren auf die Beine gestellt haben. Trotz großer Hürden, denn zu diesem Zeitpunkt war es unseren jüdischen Mitbürgern längst nicht mehr erlaubt, auf allen Plätzen Sport betreiben zu dürfen. Wenn der Hintergrund nicht so traurig wäre, könnte man fast sagen: Der jüdische Fußball in Berlin hat zu dieser Zeit eine Blütezeit erlebt. Auch wissen wir jetzt, dass vor den Olympischen Spielen 1936 sogar sogenannte „Begegnungsspiele“ zwischen jüdischen und arischen Mannschaften stattgefunden haben. So wollte das Regime kurz vor den Olympischen Spielen nach außen den Schein einer vermeintlich offenen Gesellschaft wahren.
Was haben Sie noch herausgefunden?
Ein Beispiel, das den BFV selbst betrifft: Wir wollten zum einen herausfinden, welche Hintergründe die handelnden Personen hatten. Waren sie schon länger Nazis? Wurden sie mit der Zeit welche? Und vor allem: Wie aktiv haben sie die Richtlinien des Regimes durchgesetzt und es damit letztendlich gestützt? Dabei sind wir auf einen konkreten Fall eines Gauführers gestoßen, der zu der Zeit nachweislich sehr aktiv dabei mitgeholfen hat, die Anpassungen der NS-Sportführung im Berliner Fußball umzusetzen. Später, nach der Wiedergründung des BFV 1945, war er noch lange im Berliner Fußball aktiv und genoss große Wertschätzung. Diese Ergebnisse haben wir dem BFV-Präsidium jüngst bereits präsentiert und ich bin froh, dass diese unbequeme Wahrheit seitens des Verbandes auf eine gute Aufnahme gestoßen ist. Dass durch diesen Erkenntnisgewinn eine Sensibilisierung dafür stattgefunden hat, dass ein Verbandsakteur, den wir mit unserem heutigen Wissen als Nazi benennen können, noch heute in Ehrungen des Verbandes steht. Wie der BFV mit dieser Erkenntnis nun umgeht, das muss allein er entscheiden. Das zu entscheiden oder zu bewerten, ist nicht der Job von uns Historikern. Unsere Aufgabe ist es, das nötige Wissen für eine Entscheidungsbildung bereitzustellen.
Wie reichhaltig war die Quellenlage für diese Arbeit?
Puh, schwierig! Denn die Vereine waren nicht verpflichtet, ein Archiv zu führen. Auch etwaige Vereinszeitschriften mussten nicht aufbewahrt werden. Dementsprechend war es die erste Herausforderung, die Vereine aus dieser Zeit zu identifizieren. Und die zweite war es zu schauen, ob zum Treiben der Vereine in dieser Zeit überhaupt Unterlagen vorliegen. In vielen Fällen war das nicht so. Wir mussten in den Teams, in denen wir die einzelnen Aspekte der Studie bearbeitet haben, also kreativ werden. Julian Rieck, der sich um das Thema Vereine gekümmert hat, kam so beispielsweise auf die Idee, die Polizeiarchive anzufragen. Denn zur NS-Zeit mussten die Klubs quasi alles, was sie im Verein verändert und angepasst haben, melden. Das Regime wollte genauestens darüber informiert werden, was sich in den Vereinen tut, um so nachvollziehen zu können, welcher der Vereine auch wirklich auf ihrer Linie waren.
Wie muss man sich die Änderungen ganz praktisch vorstellen?
Zu der Zeit waren die Spieler verpflichtet, vor und nach dem Spiel den Hitlergruß zu zeigen. Doch gab es durchaus auch Spieler, die sich dem widersetzten. Und die folglich Spielsperren aufgebrummt bekamen oder sogar aus den Vereinen ausgeschlossen wurden. Eine weitere Frage ist auch, wie rasch die Vereinsführer etwa den Arier-Paragraphen eingeführt haben – und ob sie dennoch weiterhin mit jüdischen Menschen befreundet waren oder ihnen womöglich sogar geholfen haben. Durch solch widersprüchliche Fälle wird das Bild dieser Zeit differenzierter. Weil wir dadurch wegkommen vom Denken in Kategorien, von wegen: Der war ein Mitläufer, der wiederum ein Systemling. Wir konnten stattdessen viel mehr herausstellen, dass auch der Berliner Fußball zu dieser Zeit ambivalent war. Aber auch im Verband selbst entdeckten wir obskure Persönlichkeiten.
Wen zum Beispiel?
Als der Fußballverband 1933 aufgelöst und vom Gau III ersetzt wurde, musste auch ein sogenannter Gau-Führer installiert werden. Das wurde Oskar Glöckler, ein strammer Nazi mit NSDAP-Vergangenheit. Der hat sich zwei weitere Leute an die Seite geholt, die ihn in der Leitung unterstützt haben. Wir fragten uns also: Holte Glöcker die zwei weiteren Führungskräfte dazu, weil sie auch Nazis waren? Nachweislich war das tatsächlich der Fall, beide waren alte Bekannte oder Parteigenossen. Der eine verließ den Verband jedoch bald wieder, der andere wurde wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung angeklagt. Und Glöckler selbst beging 1938 im Alter von 44 Jahren Selbstmord – er wurde nämlich als Hochstapler enttarnt. Er trug einen erfundenen Professorentitel und behauptete, ihm wäre im Ersten Weltkrieg ein eisernes Kreuz verliehen worden, was nicht stimmte. Und das entlarvt aus unserer Sicht auch, was für Typen das mitunter waren, die im NS-Regime entscheidende Positionen einnehmen konnten. Denn den Verband am Laufen gehalten, das haben die Leute, die eh schon da waren und die sportliche Expertise hatten. Auf der rein fachlichen Ebene, in der es um die alltägliche Organisation des Spielbetriebs geht, herrschte große personelle Kontinuität.


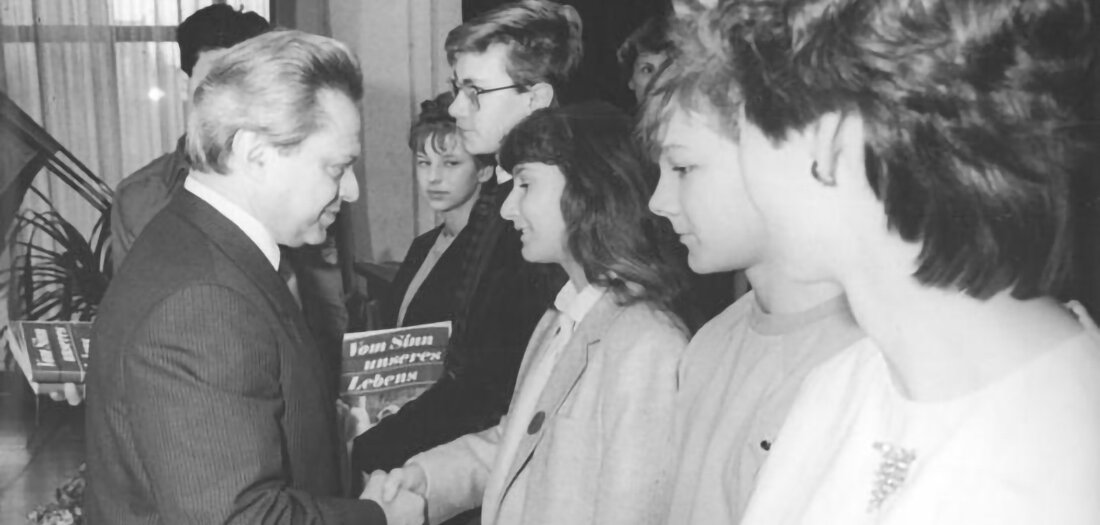

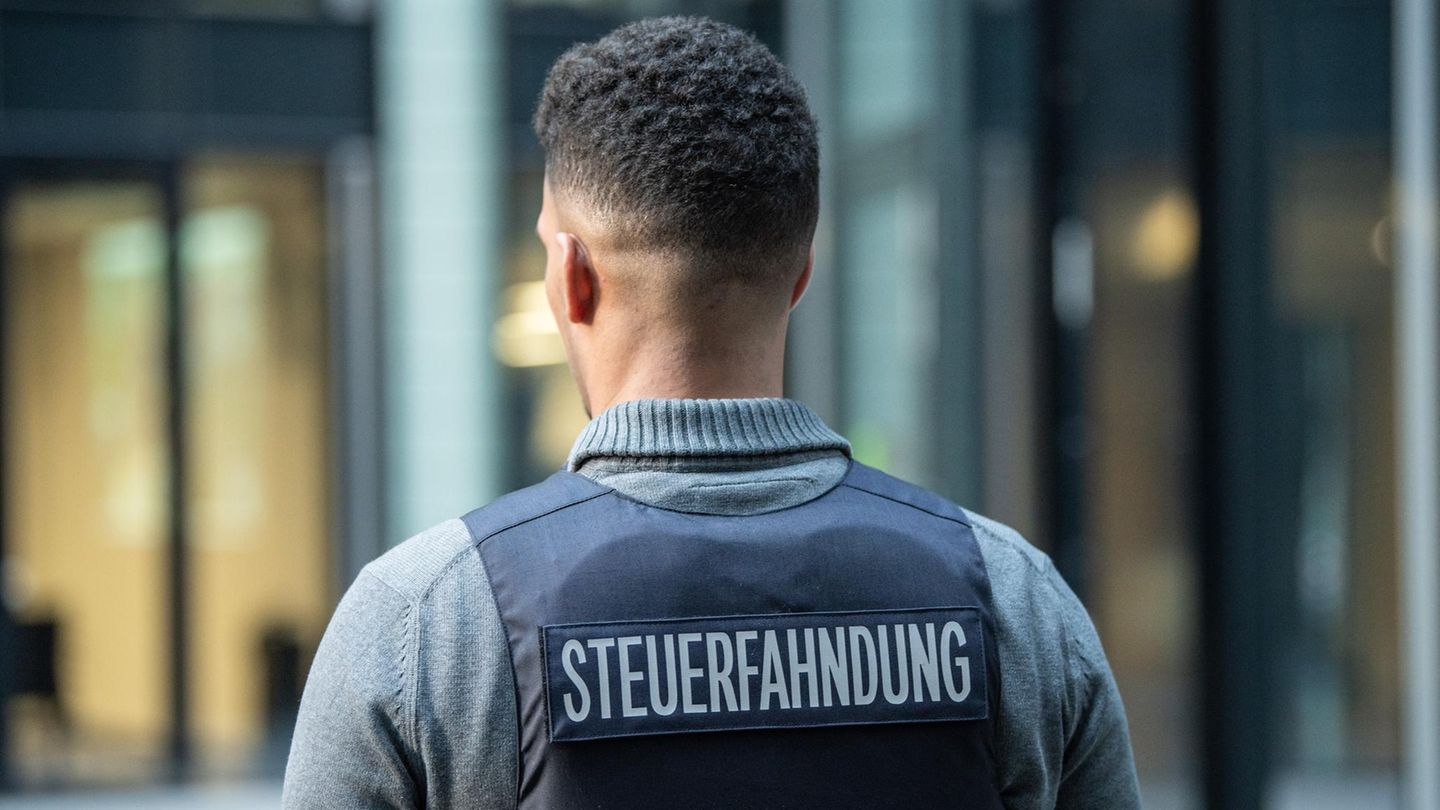








:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c5/f5/c5f5dc316fe9d11d9fd989ccbfd72ea7/0123465372v1.jpeg?#)

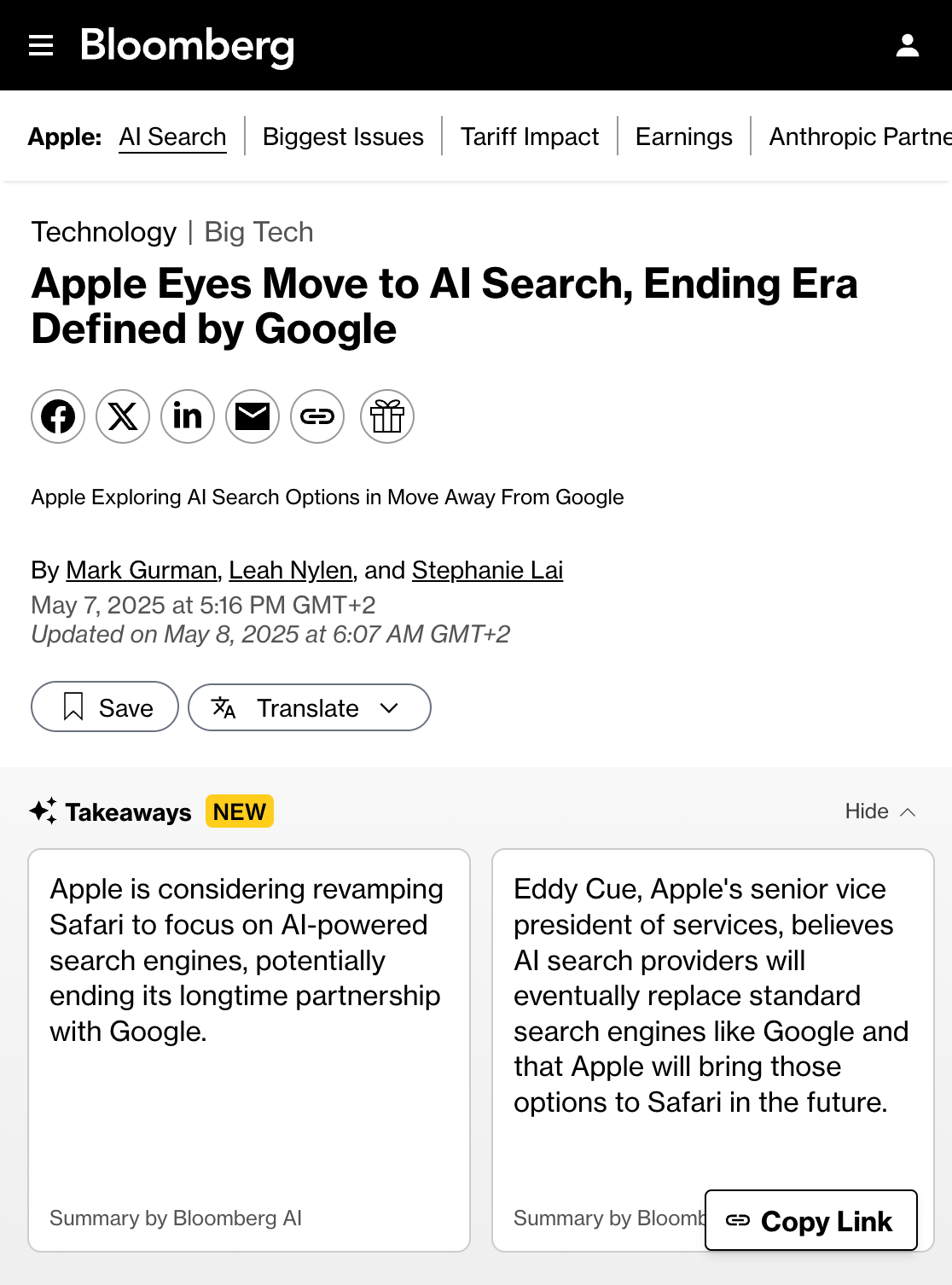
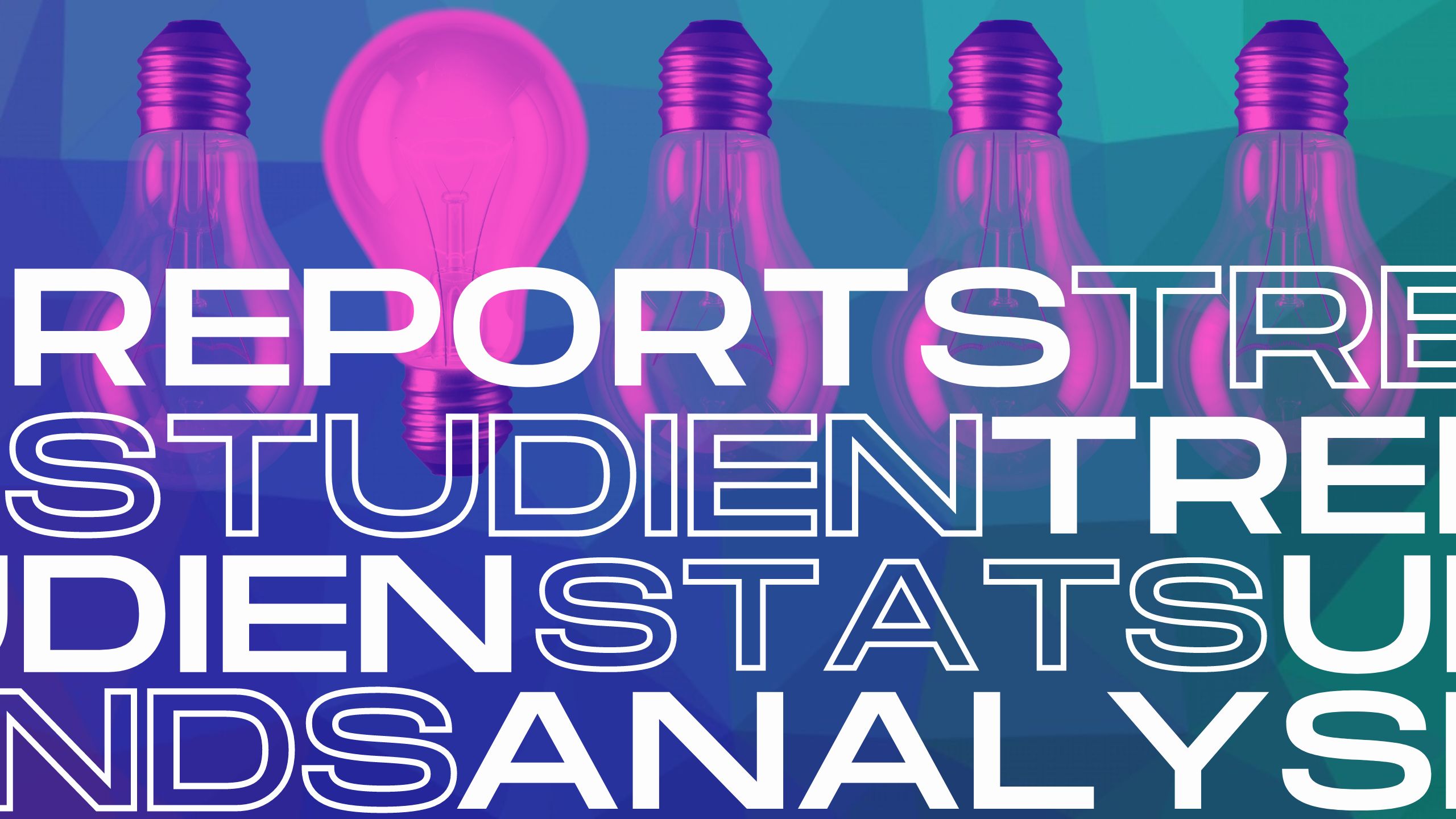


:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/84/07/8407a422002437a869ad1ee6a3890c0d/0124509317v2.jpeg?#)






,regionOfInterest=(1557,831)&hash=be787f91093ec9890fb801c7b7f07d2328c62f2842d9085e285f091320fda81b#)