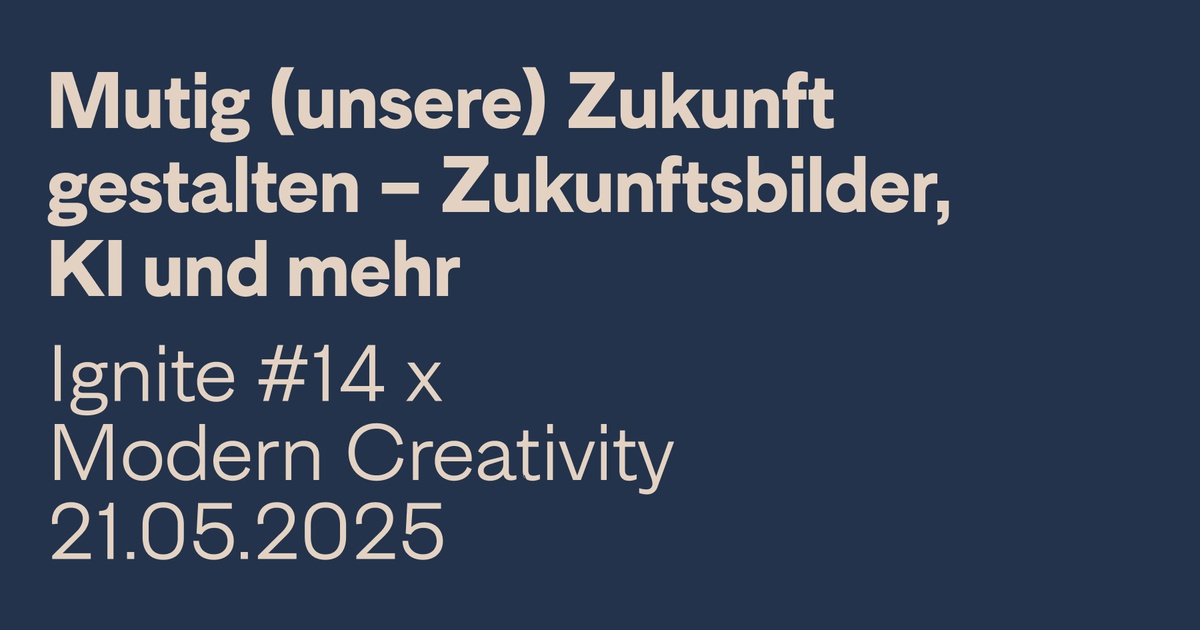Fahrdienste: Razzien gegen illegale Fahrten: Werden Uber, Bolt & Co. bald teurer?
Fahrdienste wie Uber und Bolt locken mit niedrigen Preisen, kämpfen aber auch mit illegalen Anbietern. Dagegen wollen jetzt Großstädte vorgehen – und die Fahrten teurer machen

Fahrdienste wie Uber und Bolt locken mit niedrigen Preisen, kämpfen aber auch mit illegalen Anbietern. Dagegen wollen jetzt Großstädte vorgehen – und die Fahrten teurer machen
Fahrdienstplattformen wie Uber, Bolt und Lyft sind nicht mehr aus dem städtischen Verkehr wegzudenken. Vor allem in Großstädten gelten sie als moderne Alternativen zu klassischen Verkehrsmitteln wie Taxi, Bus und Bahn. Das Versprechen: Mit nur wenigen Klicks gelangen Fahrgäste günstig und schnell an ihr Ziel, ohne lange Wartezeiten und komplizierte Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Doch es gibt eine Kehrseite: Geringe Gewinnmargen der Fahrdienstleister treiben einige Fahrer offenbar in die Illegalität, sagen Kritiker.
Razzien bei Fahrern von Uber, Bolt und Co.
Tatsächlich legen Erfahrungswerte der Behörden nahe, dass in deutschen Großstädten fast jeder vierte Mietwagen illegal unterwegs sein könnte. Im Januar hatten Ermittler bei einer Razzia in mehreren Bundesländern mehr als 100 Autos gepfändet und rund 1,8 Mio. Euro „eingefroren“. Die 30 Beschuldigten hatten laut dem „Hessischen Rundfunk“ als Subunternehmer Fahrten bei Uber und Bolt angeboten. Die Fahrer sollen allerdings nicht sozialversichert gewesen sein und keine oder nur gefälschte Personenbeförderungsscheine gehabt haben. Weil sie Umsatzsteuer mutmaßlich nicht abführten, sei ein Schaden in Höhe von 2 Mio. Euro entstanden.
Ein Grund für die illegalen Machenschaften könnten unterschiedliche Regelungen für Uber- und Taxi-Fahrer sein. Uber, Bolt und Lyft vermitteln Fahrten über ihre Apps und agieren dabei als Plattformen zwischen Fahrgästen und Fahrern. Um Uber-Fahrer zu werden, können Mietwagenfirmen Verträge mit den Plattformen abschließen; als Einzelperson muss man sich bei den Fahrdiensten registrieren und Dokumente wie einen Personenbeförderungsschein einreichen. Angestellt wird man nicht bei Uber direkt, sondern bei einem kooperierenden Subunternehmen. Mit einer Provision von 15 bis 30 Prozent des Fahrpreises verdienen die Fahrdienst-Plattformen ihr Geld. Die Fahrpreise sind oft deutlich niedriger als bei Taxis, da sie an keine festen Tarife gebunden sind.
Kritiker bemängeln, dass das System der niedrigen Preise in die Illegalität treibe: Fahrer würden nicht ordentlich versichert und bezahlt, Umsätze nicht angemeldet und Mietkonzessionen gefälscht. Aber stimmt das – und gibt es deshalb womöglich bald einen Mindestpreis für Uber-Fahrten?
Die Fahrdienste sagen: nein. Um die Wirtschaftlichkeit zu beweisen, hatte Uber eigens eine Studie beim Beratungsunternehmen IW Consult, einer Tochterfirma des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), in Auftrag gegeben. Die Untersuchung kommt auf eine angeblich sehr hohe Profitabilität des Mietwagengewerbes. Die Vermittlungsplattform Free Now als direkter Uber-Konkurrent und die Taxibranche zweifeln die Ergebnisse allerdings an und präsentieren eigene Berechnungen, die hohe Verluste des Fahrgeschäfts zeigen sollen.
Mindestpreis für Uber, Bolt und Co.?
Um illegale Fahrdienstleister von der Straße zu holen und gleichzeitig den fairen Wettbewerb zu sichern, denken Großstädte wie Frankfurt, Berlin und München über sogenannte Mindestpreise für Fahrten nach. Diese würden sich am Taxitarif orientieren, eine Uber-Fahrt dürfte damit merklich teurer werden. Uber behauptet in einem Statement, dass sich Fahrten in München mit einem Mindestpreis um durchschnittlich 12 Euro verteuern würden.
In Frankfurt macht die oppositionelle CDU-Fraktion Druck auf die Stadtverwaltung: „Wir fordern die Prüfung eines Mindestpreises, um zu wissen, auf welcher Basis wir überhaupt diskutieren“, sagt Frank Nagel, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Frankfurter Römer.
Dass solche Mindestpreise grundsätzlich möglich sind, hatte im Januar 2025 das Verwaltungsgericht Leipzig entschieden – sehr zur Freude der Taxiverbände. Diese fordern bereits seit langem Mindestpreise, um gegen die oft billigeren Mietwagen wettbewerbsfähig zu bleiben. „Das Taxigewerbe ist strukturell gefährdet“, sagt Andreas Maier, General Manager von Free Now, zu Capital. Free Now war selbst im Mietwagengewerbe aktiv, zieht sich aber nun nach eigenen Angaben zurück, weil es nicht profitabel sei. „Wenn es keine Taxis mehr gibt, kann das zu Problemen bei Schienenersatzverkehr oder beim Krankentransport führen. Wollen wir, dass diese Dinge künftig dereguliert und rein privat organisiert sind?“, warnt Maier.
Beim Ordnungsamt in Frankfurt ist man grundsätzlich offen für einen Mindestpreis, wenn „ein fachliches Gutachten nachgewiesen hat, dass der ÖPNV – zu dem auch der Verkehr mit Taxis gehört – ohne sie nicht mehr ordentlich funktionieren würde“. Die Behörde will jetzt ein sogenanntes Funktionsfähigkeitsgutachten durchführen lassen, das Angebot- und Nachfragesituation, Preisentwicklung und einen möglichen Verdrängungswettbewerb analysiert. Doch der Auftrag für das Gutachten dürfte erst Ende des Jahres vergeben werden, sagt Politiker Nagel.
Bolt: Geschäftsmodell durch Mindestpreis ernsthaft bedroht
Der Mindestpreis hilft laut Nagel im Kampf gegen illegale Fahrtanbieter. Seine Argumentation: Taxis müssen ihre Preise zwar an einem starren Tarif ausrichten, zahlen aber nur sieben Prozent Umsatzsteuer; sie dürfen an Taxiständen stehen und Busspuren benutzen. Für Mietwagen ist das verboten – dafür haben sie flexiblere Preise. Diese Unterschiede setzen Uber-Fahrer unter Druck, sagen manche. Um profitabel zu sein, bräuchten sie deutlich mehr Fahrten pro Stunde als ihre Taxi-Kollegen – oder die Unternehmen sparten eben auf illegale Weise. Zum Beispiel, indem Umsätze nicht angegeben, Mietkonzessionen gefälscht oder Fahrer illegal beschäftigt werden. „Das System der Mietwagen baut sehr stark auf einer hohen Auslastung“, sagt Maier vom Konkurrenten Free Now. „Wenn ich nun an den Preis rangehe, droht dieses System zu fallen.“
Die Plattformen Uber und Bolt sehen das grundsätzlich anders und wehren sich gegen einen Mindestpreis: Er helfe nicht im Kampf gegen die Illegalität, sondern schade den Uber-Nutzern. „Viele Haushalte werden darunter leiden, wenn Mobilität durch die Mindestpreise künstlich verteuert wird“, sagt Uber-Sprecher Oliver Fritz Capital. Auch Sven Ursinus, Head of Public Policy für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Bolt, warnt vor den Folgen der Mindestpreise: „Wenn die Preisflexibilität wegfiele, wäre in vielen Städten ernsthaft das Geschäftsmodell bedroht.“
Wie teuer wird die Uber-Fahrt?
Müssen also am Ende allein die Fahrgäste die Kosten für die höheren Fahrpreise tragen? Prinzipiell: ja. Der Frankfurter CDU-Politiker Nagel lässt das allerdings nicht als Argument gegen einen Mindestpreis gelten: „Wenn das Gutachten eine erhöhte Illegalität nachweist – und davon gehe ich aus – beruhen die derzeit niedrigen Fahrpreise lediglich auf der Missachtung geltender Gesetze – und sind damit rechtswidrig.“ Wenn das Gutachten keine nennenswerte Illegalität nachweise, dann gebe es überhaupt „keine Diskussion über einen Mindestpreis“. Denn dann handelten alle legal. Ein Mindestpreis wäre dann ein Eingriff in den Marktmechanismus zulasten der Konsumenten.
Grundsätzlich wäre Nagel eine andere Maßnahme lieber: mehr Kontrollen. „Nur wenn die Kontrollen nicht stichhaltig und ausreichend sind, dem Missbrauch kein Einhalt geboten wird, Sozialdumping stattfindet und die Situation nicht besser wird, soll der Mindestpreis als letztes Mittel dagegenhalten.“
Gegen illegale Uber-Fahrer: Datenabgleich mit Behörden
Sowohl Uber und Bolt als auch Free Now sagen, dass sie die ihnen vorliegenden Fahrerdaten mit den zuständigen Behörden abgleichen lassen würden. Wäre die Konzession ungültig, würden Polizei und Steuerbehörden eingeschaltet. Zwar prüfe auch ein geschultes Team bei Uber die Konzessionen, sagt Uber-Sprecher Fritz, aber endgültige Sicherheit bringe nur ein Datenabgleich.
Neben Frankfurt haben mehrere Kommunen so einen Abgleich vor, umgesetzt ist er bisher aber nur in Berlin. Dort werden die Daten seit Frühjahr 2024 wöchentlich überprüft – seitdem sind auf den Straßen der Hauptstadt fast 2000 genehmigte Autos weniger unterwegs.
Es gibt aber auch dabei Probleme: Die Kontrollen lassen sich beispielsweise umgehen, indem die Unternehmen in die Umlandgemeinden ausweichen, die nicht mehr Teil des Abgleiches sind. Ihre Fahrten könnten sie trotzdem in den Innenstädten machen.
Dagegen helfen würde wohl nur, den Datenabgleich bundesweit auszuweiten – was aber schwer umzusetzen ist. Schon jetzt scheitert es in manchen Kommunen an der Geschwindigkeit und der Digitalisierung. Dem Vernehmen nach wird noch mit Excel-Listen hantiert – und selbst das nur bei Neuanmeldungen. „Das behördliche Tempo ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit dem eines Start-ups“, sagt Ursinus von Bolt. „Aber ich bin sehr optimistisch, weil wir in mehreren Städten mit den Behörden in Kontakt sind.“
Bis der Datenabgleich in den Kommunen aber wirklich regelmäßig läuft, dürfte es noch dauern – nicht zuletzt wegen Personalmangels in den Verwaltungen. Sollte eine Kommune derweil den Mindestpreis wirklich einführen, drohen Bolt und Uber bereits mit Klagen.

![Verfahren gegen Daniela Klette: Mit Kufiya auf der Anklagebank [Online-Abo]](https://www.jungewelt.de/img/1100/208539?#)










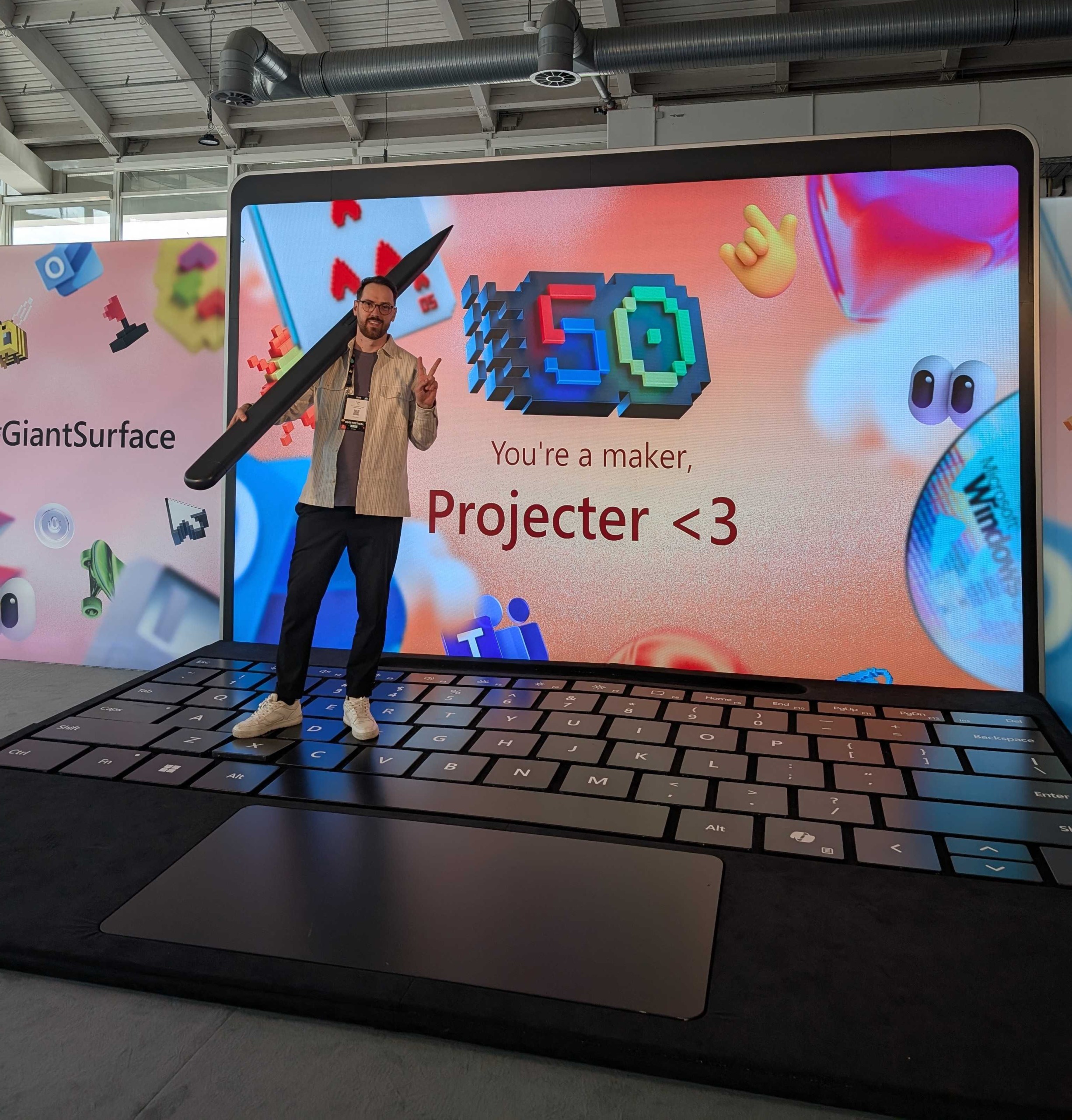





:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/51/c751686510f49bec5115a55ab93b5fee/0124517652v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5d/90/5d905a0b8cc48e8bc465b13c37a07f2e/0124513944v2.jpeg?#)








,regionOfInterest=(637,305)&hash=34b3ed22ea30907851d90d6efd25ace89ee9ed32d52ec13357c4c30c5ea6b1dc#)