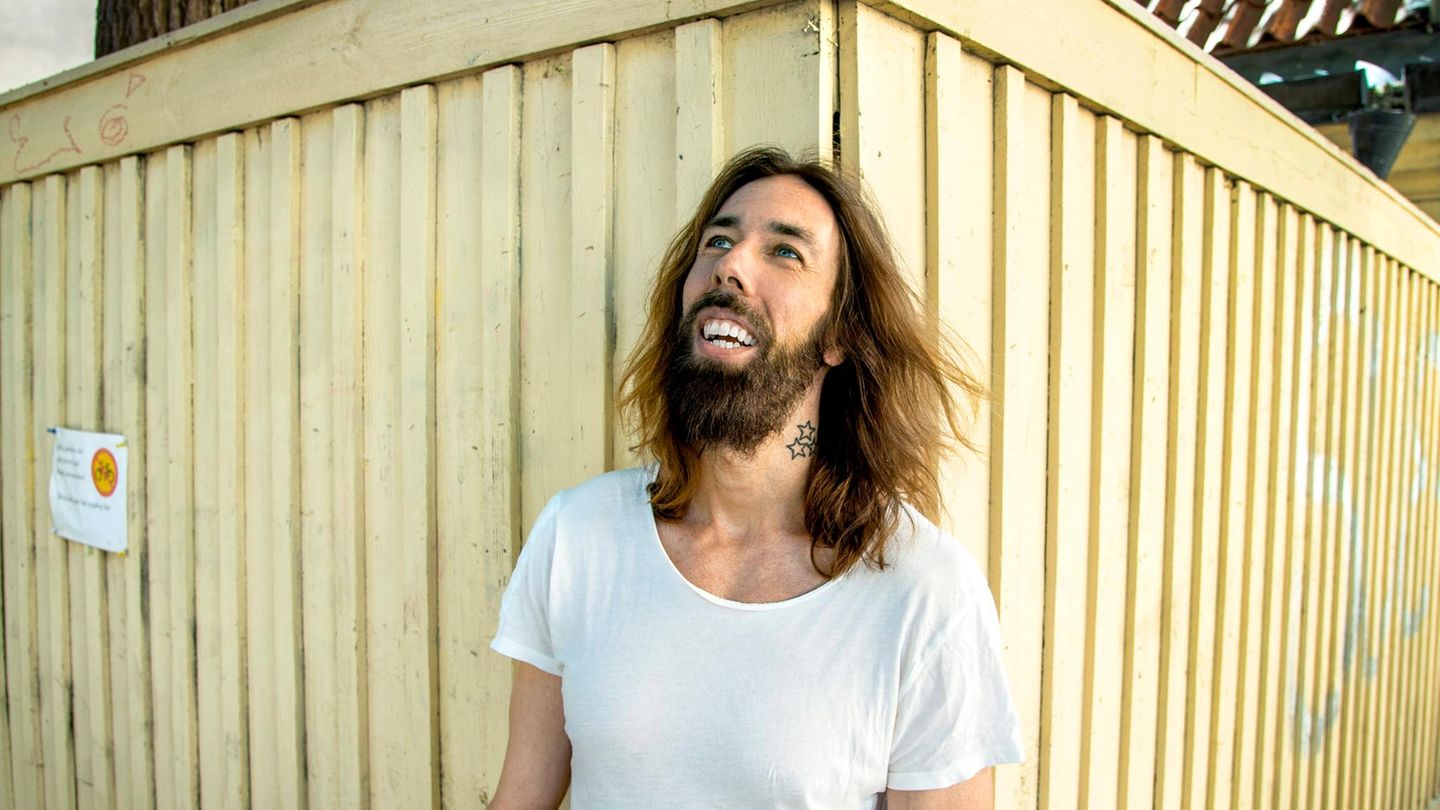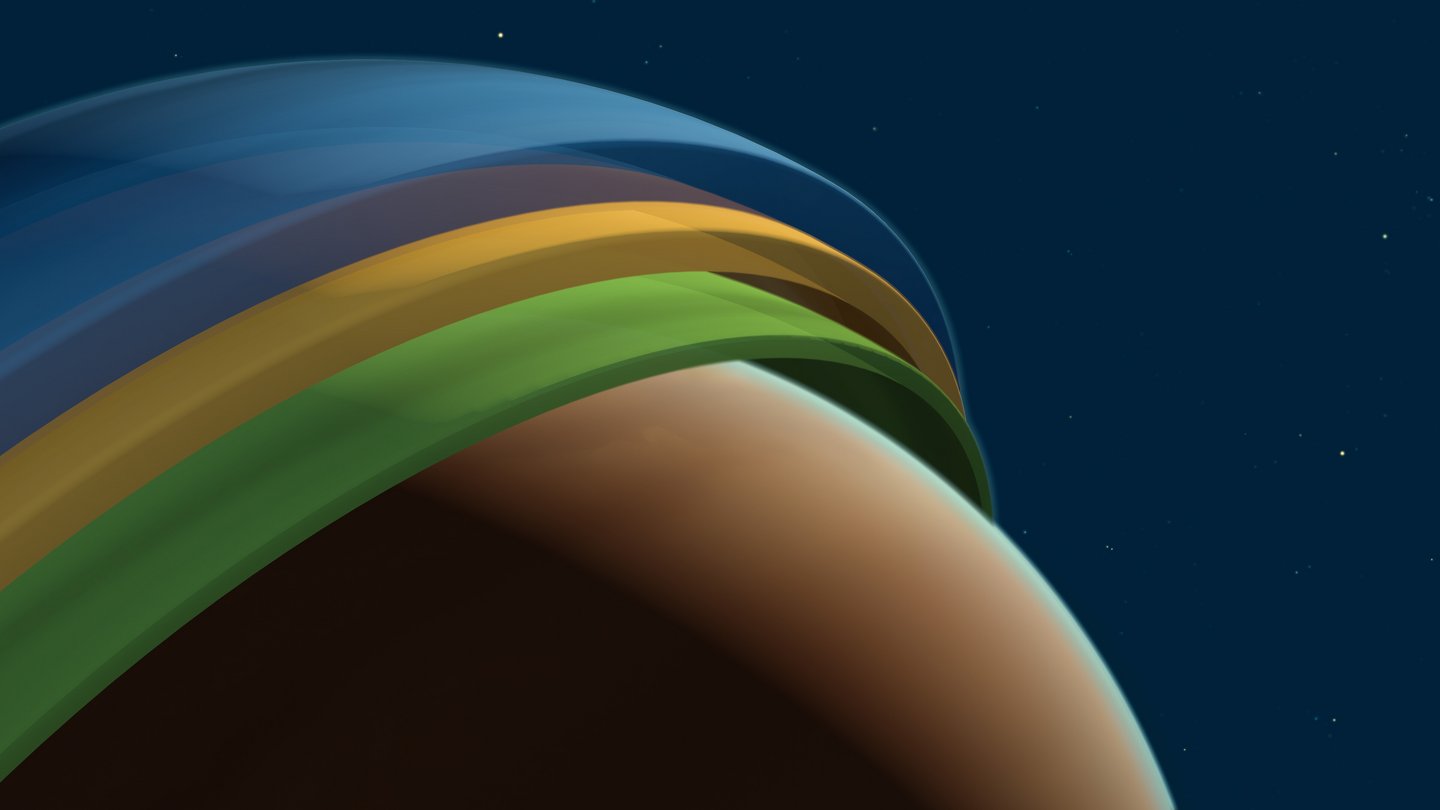Forschung: Unser Gehirn ähnelt dem von Wellensittichen – dieses Wissen könnte uns helfen
Wellensittiche können menschliche Wörter problemlos nachplappern. Forscher haben nun herausgefunden, warum das so ist – und was wir daraus für die Behandlung von Sprachstörungen lernen

Wellensittiche können menschliche Wörter problemlos nachplappern. Forscher haben nun herausgefunden, warum das so ist – und was wir daraus für die Behandlung von Sprachstörungen lernen
Auch wenn sie nicht immer auf den ersten Blick sichtbar sind: Wir haben Gemeinsamkeiten mit Tieren verschiedenster Arten. Wie bei Hunden ist unser Gehirn auf soziale Kompatibiltät ausgelegt, Stress bewältigen wir seit Urzeiten sehr ähnlich, wir teilen auch eine auf Kooperation ausgerichtete Mentalität. Wie wir sind auch Schweine durchaus hilfsbereit sind und können räumlich denken. Elefanten und Graugänse leben wie wir in langjährigen Zweierbeziehungen voller tiefer emotionaler Verbundenheit. Und, das zeigen neue Forschungen: Unser Gehirn ähnelt dem von Wellensittichen viel mehr als bislang angenommen.
Das gilt vor allem für jenen Teil des Gehirns, der für die Spracherzeugung zuständig ist. Wenn Wellensittiche Laute und Töne von sich geben, ganze Wörter und Sätze nachsprechen und ihren Wortschatz lebenslang erweitern, dann werden in ihrem Gehirn ähnliche Muster erzeugt wie jene, die entstehen, wenn wir sprechen. Das schreiben jedenfalls Zetian Yang und Michael Long vom New York University Langone Medical Center, ihre Studie veröffentlichten sie jetzt im Fachmagazin "Nature". Den beiden gelang es erstmals, die Hirnsignale plappernder Wellensittiche (Melopsittacus undulatus) aufzuzeichnen. Sie konzentrierten sich dabei auf das vordere Arcopallium (ACC), ein Hirnareal, das die Muskeln des Stimmapparates bei Wellensittichen steuert und für die Bildung von Lauten verantwortlich ist, die an Konsonanten und Vokale erinnern.
Die Vorgänge im Gehirn des Vogels aus der Familie der Altweltpapagien (Psittaculidae) gleichen dabei einem Klavir, dessen Tasten gedrückt werden: Singt der Wellensittich, werden ja nach Tonhöhe bestimmte Zellen aktiviert. Der Vorgang ähnelt wiederum der Spracherzeugung des Menschen: Auch hier gibt es einen Zusammenhang zwischen Tonerzeugung und erhöhter Hirnaktivität in bestimmten Zellgruppen.
Hilfe bei der Behandlung von Sprachstörungen
Bei allen anderen bisher untersuchten Tierarten konnte man diese Gemeinsamkeit nicht feststellen. Auch nicht bei den von den Forschern ebenfalls analysierten Zebrafinken (Taeniopygia), die zwar komplexe Tonfolgen erzeugen und durchaus auch Töne imitieren können, dabei aber deutlich unflexibler sind. Den Forschern zufolge brauchen sie mehr als 100.000 Versuche, um ein bestimmtes Lied zu erlernen. Sittiche und Menschen dagegen können ihr Stimmverhalten schnell anpassen und mit ihrer Stimmklaviatur lernen, motorische Befehle wiederzuverwenden, neu zu kombinieren und so verschiedene Laute kreativ zu erzeugen.
Das neue Wissen um das Gehirn der Wellensittiche könnte letztlich auch uns Menschen nützen und bei der Behandlung von Sprachstörungen helfen – insbesondere solchen, die durch ein Trauma infolge eines Schlaganfalls verursacht werden. Dazu zählen die Apraxie, die durch Schwierigkeiten bei der Planung von Sprechbewegungen gekennzeichnet ist, und die Aphasie, die für Probleme bei der Sprachproduktion sorgt. "Ein wichtiger Weg zur Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für Sprachstörungen besteht darin, Tiermodelle zu finden, die neue Einblicke in sprachbezogene Gehirnprozesse bieten", sagte der Hauptautor der Studie, Michael A. Long, in einer Mitteilung der Universität. "Die bei den Wellensittichen entdeckten Gehirnprozesse könnten helfen, die Mechanismen hinter Kommunikationsstörungen zu erklären, von denen Millionen Menschen betroffen sind."
















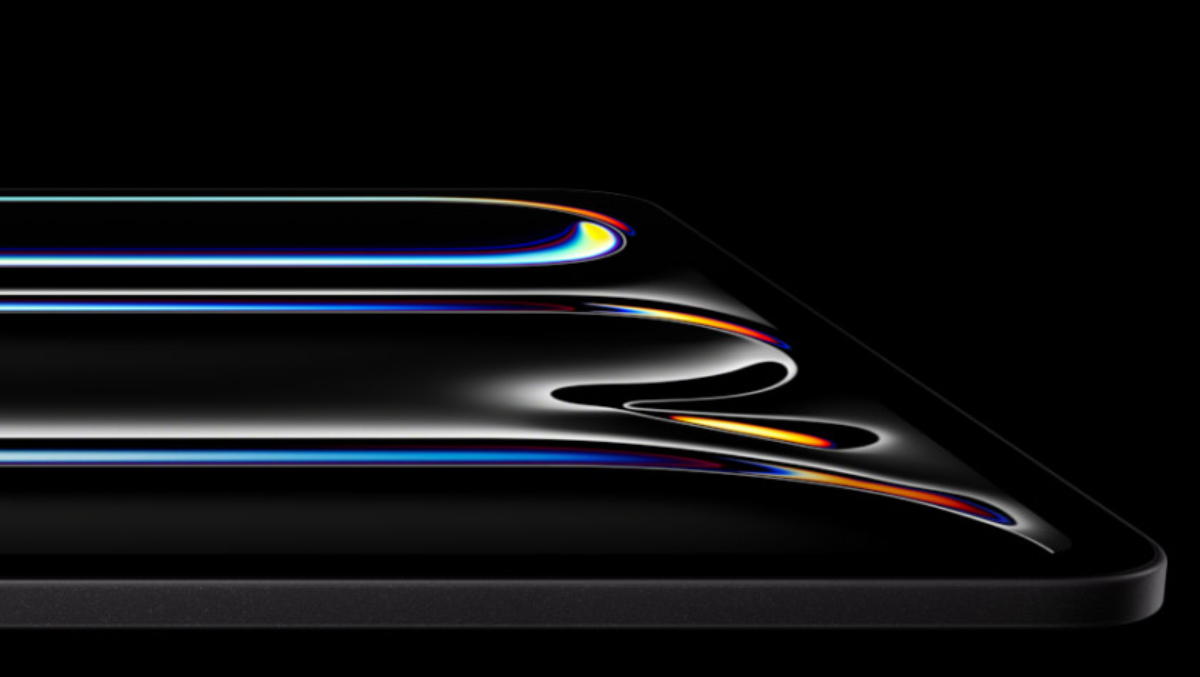


,regionOfInterest=(223,133)&hash=938b2bfbb3bdd0ccaca3a9d8170e398394668f1156567b4473f599b46f1b9d49#)
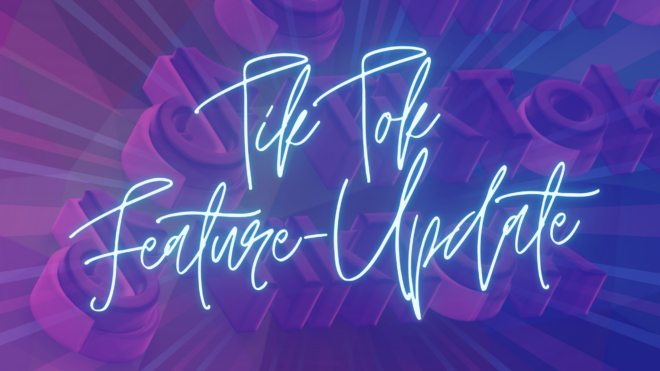



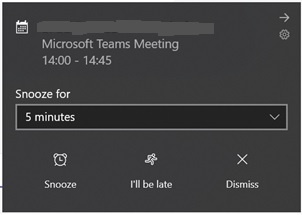























,regionOfInterest=(977,357)&hash=1c380806d77473eb3cf0f54cfc6d950f711e80c6ae334d72a53a1def183d4fe4#)