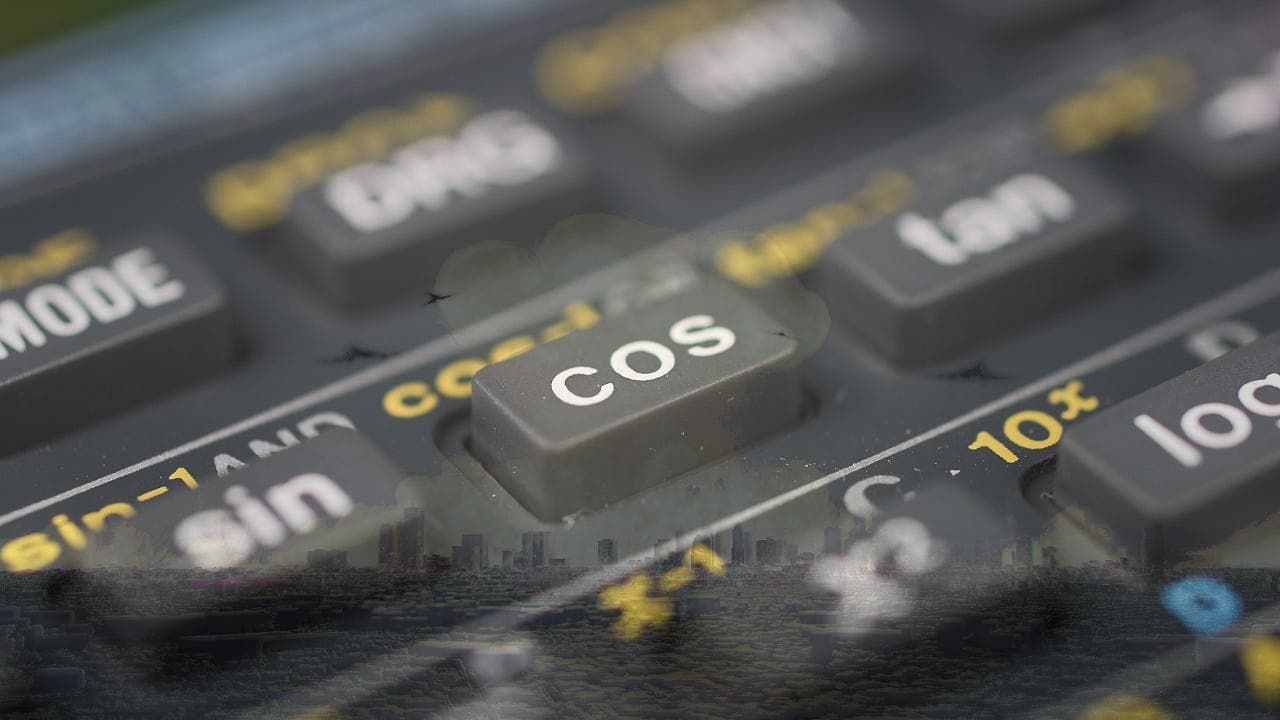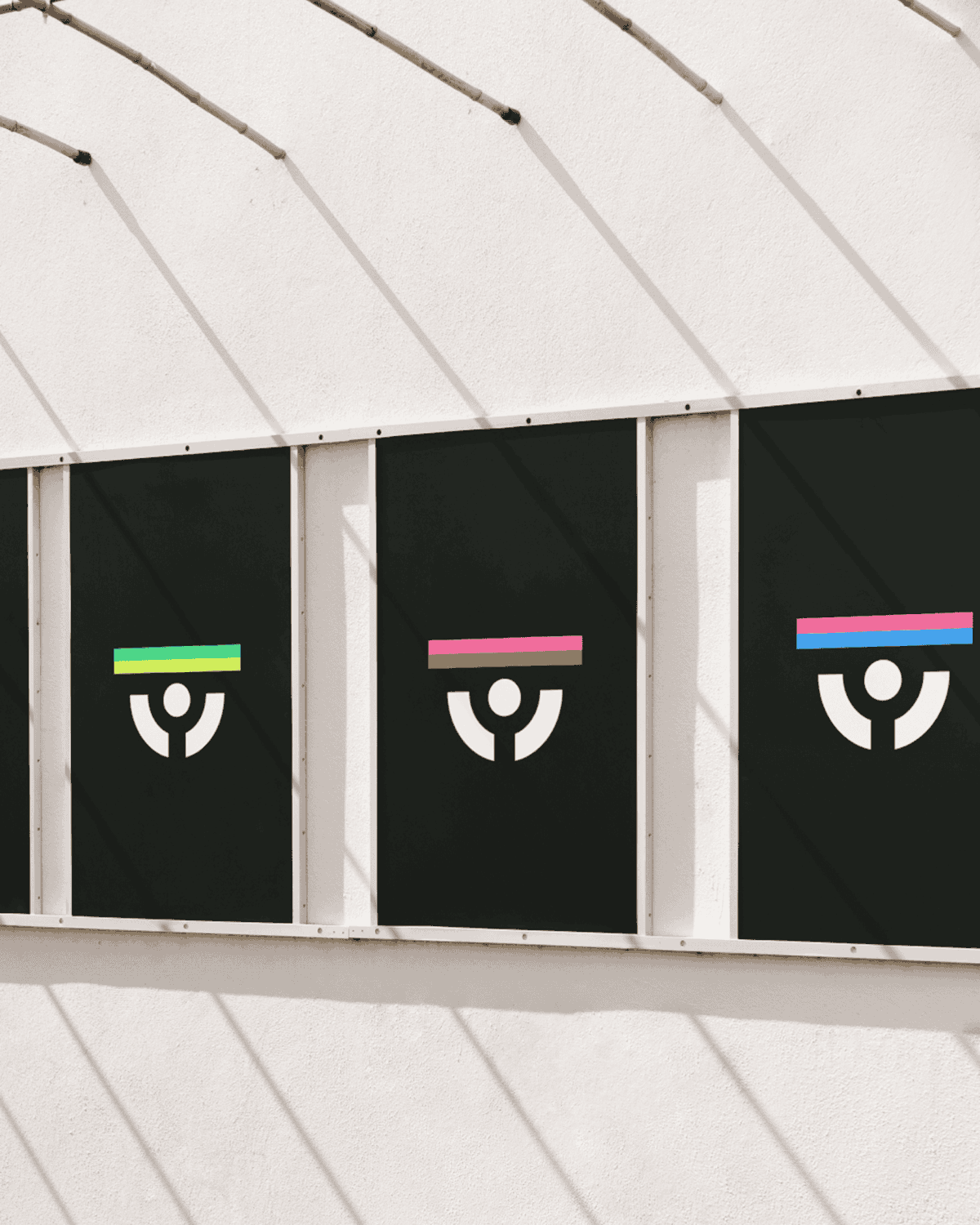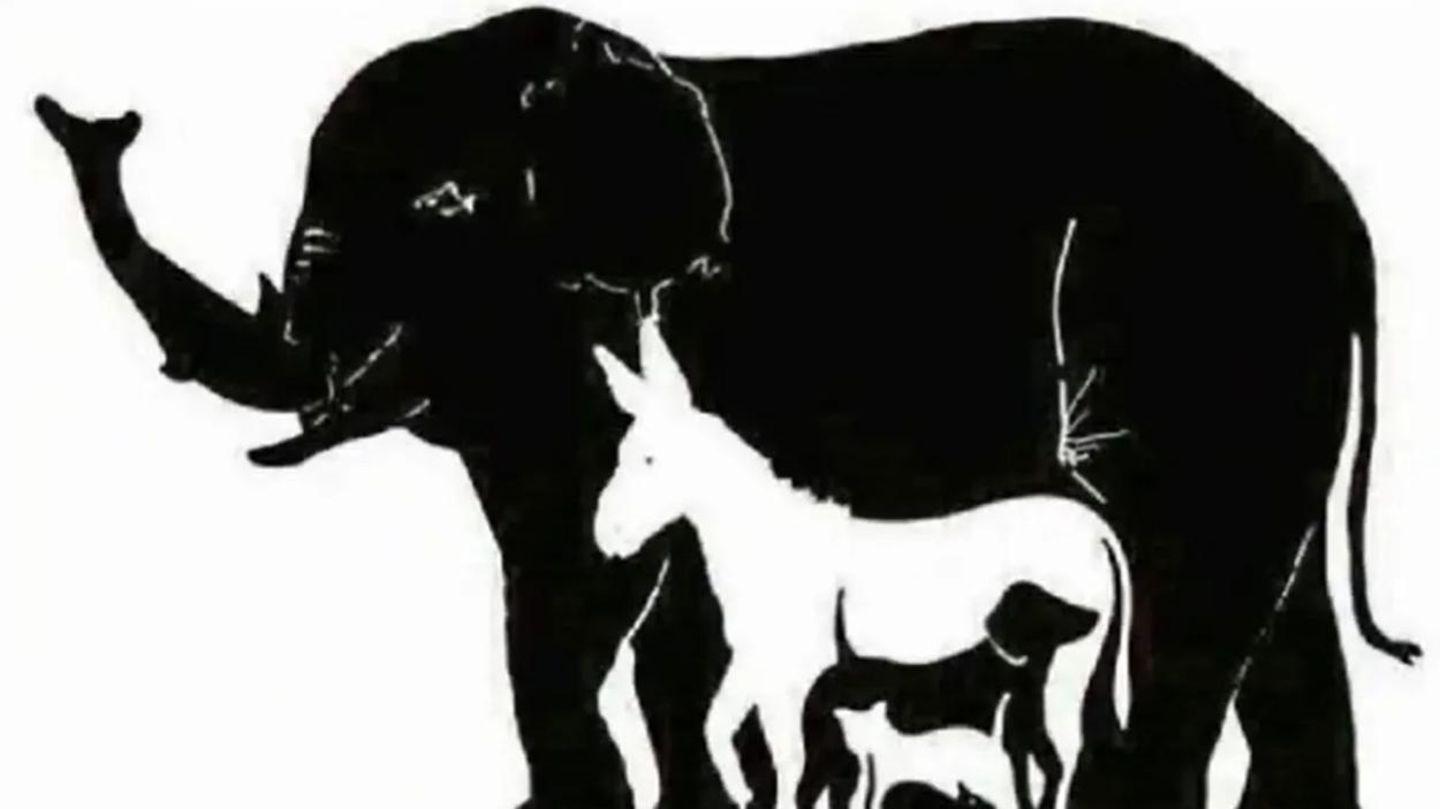Top 40 unter 40 : Aufbruch aus der Komfortzone
Deutschlands Wirtschaft kämpft mit sinkender Produktivität, langsamen Prozessen und einem lähmenden Wohlstandsparadoxon. Mitglieder des „Top 40 unter 40“-Netzwerks spüren diesem Dilemma nach und fordern: Wir brauchen ein neues Betriebsmodell

Deutschlands Wirtschaft kämpft mit sinkender Produktivität, langsamen Prozessen und einem lähmenden Wohlstandsparadoxon. Mitglieder des „Top 40 unter 40“-Netzwerks spüren diesem Dilemma nach und fordern: Wir brauchen ein neues Betriebsmodell
Ist Deutschland nicht produktiv genug? Darüber wird seit Monaten diskutiert. Doch unter der Oberfläche schlummert ein tieferliegendes Problem. Das Thema bewegt Mitglieder des Capital-Netzwerks „Top 40 unter 40“, die zu einer Debatte im vertraulichen Kreis eingeladen haben. Rund zwei Dutzend Führungskräfte, Politiker, Wissenschaftler und Berater aus den Bereichen Automobil, Energie, Life Sciences, Verteidigung und Immobilien kamen nach zwei intensiven Diskussionsrunden zu dem Ergebnis: Es geht nicht nur um Output pro Stunde, sondern um ein Land, das sich selbst im Weg steht – und das gleichzeitig alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart mitbringt.
Die Teilnehmer sind in verantwortungsvollen Positionen, haben Einblick in den Maschinenraum der deutschen Wirtschaft und wollen durch die Veröffentlichung ihrer Positionen einen Beitrag zum Aufschwung des Landes liefern.
Symptome statt Ursachen – und ein System am Limit
Zahlen zur sinkenden Produktivität sind nur das Fieberthermometer. Das eigentliche Problem ist strukturell: Ein Betriebsmodell, das jahrzehntelang funktioniert hat, passt nicht mehr zur Realität. Der technologische Wandel, geopolitische Verschiebungen und der weltweite Innovationsdruck stellen Anforderungen, auf die Deutschland bislang zu träge reagiert. Prozesse, Entscheidungswege, Führungssysteme – vieles stammt aus einer Zeit, in der Globalisierung und Digitalisierung noch Schlagworte waren. Heute ist das System überlastet – nicht weil die Menschen nicht mehr leisten wollen, sondern weil es keinen Spielraum für Neues bietet.
Führung, die fordert – nicht nur verwaltet
Ein zentrales Fazit: Wir brauchen einen neuen Typ Führungskraft und Politiker. Nicht die „Kümmerer“, die alles abfedern. Sondern Persönlichkeiten, die Orientierung geben, Realität zumuten und Verantwortung teilen. Diese Leitbilder müssen Betroffenheit erzeugen, nicht Harmonie pflegen. Wer Veränderung will, muss sie erklären, übersetzen und erlebbar machen – auch und gerade wenn sie wehtut. „Führung heißt, Menschen in Bewegung zu bringen – nicht Prozesse zu optimieren oder den Status Quo zu verwalten“, bringt es ein Teilnehmer der Diskussion auf den Punkt.
Wohlstand braucht Konfliktfähigkeit – und eine neue Erzählung
Der jahrzehntelange wirtschaftliche Erfolg hat nicht nur Strukturen stabilisiert, sondern auch Veränderung gelähmt. Viele Mitarbeitende und Organisationen leben in der Vorstellung, dass „es schon irgendwie weitergeht“. Doch globale Wettbewerber wie China oder die USA haben längst vorgelegt. Deutschland muss aus seiner eigenen Wohlstandserzählung ausbrechen und sich neu definieren – mit einer klaren Vorstellung, was das Land wirtschaftlich in zehn oder zwanzig Jahren sein will. Dafür braucht es eine neue Erzählung: Kein „Weiter so“, sondern ein „Jetzt erst recht!“
Deutschland braucht ein neues Betriebssystem – konkret und mutig
Was also tun? Ein „Weiter so“ reicht nicht mehr. Die Diskussionsteilnehmer der „Top 40 unter 40“ machen klar: Deutschland benötigt kein Feintuning, sondern ein System-Update. Fünf konkrete Baustellen wurden identifiziert – keine davon bequem, aber alle notwendig.
1. Industriepolitik mit echtem Fokus
„Wir müssen uns endlich entscheiden, in welchen Bereichen wir Weltklasse sein wollen“, fordert ein Automotive-Manager. Die Runde benennt klar: Deutschland soll nicht alles ein bisschen können, sondern in Schlüsselindustrien eine Führungsrolle übernehmen. Die Favoriten der Runde: Künstliche Intelligenz, Robotik, nachhaltige Energietechnologien (inklusive Speicher) und Biotechnologie.
Beispiel: China fördert mit „Made in China 2025“ gezielt strategische Industrien, die USA haben mit dem Inflation Reduction Act gezielt Anreize für Zukunftstechnologien gesetzt. Deutschland und die EU hingegen verteilen Milliarden breit gestreut und bleiben damit oft unterhalb der notwendigen kritischen Masse.
Die Gruppe fordert: Klare nationale „Missionen“ definieren – mit Geld, regulatorischen Erleichterungen und staatlichen Ankerinvestitionen. Warum nicht einen „Nationalen Zukunftsfonds“, der mit Milliarden gezielt Leuchtturmprojekte ermöglicht? „Lieber fünf Cluster wie Batterie, KI, GreenTech, Robotik und Biotech zur Weltspitze führen als 50 Themen im Mittelmaß versorgen“, so ein Diskussionsteilnehmer.
2. Mut zur Deregulierung
„Wir verwalten uns zu Tode“, sagt eine Unternehmenslenkerin. Genehmigungs- und Zulassungsverfahren – egal ob für Windräder, Rechenzentren oder Bahninfrastruktur – dauern in Deutschland oft doppelt so lang wie im internationalen Vergleich.
Beispiel: Während Intel in Arizona eine neue Chipfabrik in 18 Monaten bauen kann und in China Batteriefertigungen in Rekordzeit gefördert und hochgefahren werden, warten vergleichbare Projekte in Deutschland im Bestfall vier Jahre auf die erste Genehmigung. Der Grund? Ein Kompetenzwirrwarr zwischen Bund, Ländern, Kommunen und EU-Vorgaben.
Die Forderung der Runde: Einrichtung von „Fast Track“-Verfahren für strategische Projekte mit klaren Fristen und zentralen, kapazitiv und kompetenzmäßig gut ausgestatteten Anlaufstellen. „Wir brauchen einen Deutschland-Pakt für Entbürokratisierung – sonst frisst uns der Prozess.“ Der Vorschlag: Der Bund soll bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Energiewende und kritischer Infrastruktur temporär mehr Entscheidungskompetenz erhalten.
3. Bildung: Vom Nachzügler zum Vorreiter
Alle Teilnehmenden sehen: Die größte Bremse ist der Mangel an Fähigkeiten. „Wir haben ein Personalproblem, kein Fachkräfteproblem“, bringt es eine Personalerin auf den Punkt. Digitalisierung, Data Literacy, KI-Kompetenzen – das alles fehlt oft schon in der Schule.
Beispiel: Estland gilt längst als Vorbild in Sachen digitaler Bildung, Deutschland streitet noch über Informatik als Wahlpflichtfach. Die Gruppe fordert eine radikale Reform: Einführung von „Future Skills“ (Datenkompetenz, Entrepreneurship, KI) als festen Bestandteil von Schule und Ausbildung, massive Investitionen in Hochschulen und Erwachsenenbildung.
Ein Teilnehmer erinnert an Singapur: „Die haben sich in den 90ern vom Billiglohnland zum Bildungs-Hotspot gemacht – warum sollten wir das nicht auch schaffen?“
4. Führung neu denken – Konflikte zulassen, Klarheit schaffen
Viele sehen das Kernproblem nicht in den Menschen, sondern im Führungsverständnis. „Wir haben verlernt, Klartext zu reden“, sagt ein Mittelständler. Die Teilnehmer berichten übereinstimmend von Führungskräften, die harte Wahrheiten aus Angst vor Unmut vermeiden.
Ein Praxisbeispiel: Ein Geschäftsführer schildert, wie er offen mit seinen Mitarbeitenden über die Alternativen sprach – entweder eine moderate Lohnrunde oder den Abbau von 30 Stellen. „Danach gab es eine echte Diskussion – und am Ende eine Einigung.“
Die Forderung: Weg von der „Kümmerer-Führung“, hin zu einer Kultur der Verantwortung und Beteiligung. Führungskräfte müssten lernen, Konsequenzen klar zu benennen – und ihre Teams aktiv in Entscheidungen einzubinden. Vor allem müssten die Change-Kompetenzen systematisch gestärkt werden. „Wir reden viel von Transformation – aber wer lernt eigentlich noch, sie zu führen?“, fragt eine Teilnehmerin provokant.
5. Staatliche Agilität – kein Update ohne Föderalismusreform
Einig war sich die Runde: Ohne eine Modernisierung des deutschen Föderalismus wird es schwer. „Es geht nicht um Abschaffung, sondern um Anpassung an die Realität“, so ein Teilnehmer. In zentralen Zukunftsfragen wie Digitalisierung, Energie, Infrastruktur oder Industriepolitik sei das aktuelle System zu langsam.
Beispiel: Während Dänemark, Schweden oder Südkorea zentrale Zukunftsprojekte effizient zentral steuern, verteilt Deutschland Mittel und Verantwortung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene – mit bekannten Folgen.
Vorschlag: Temporäre Sonderkompetenzen für den Bund bei ausgewählten Transformationsprojekten. „Wir müssen schneller werden“, so eine Managerin, „sonst bauen andere Länder die Zukunft – und wir verwalten unser Gestern.“
Dieser Gastbeitrag ist ein Ergebnis aus Diskussionen von zwei exklusiven Roundtables des Capital-Netzwerks „Top 40 unter 40“. Die Zitate wurden aus Vertraulichkeitsgründen anonymisiert, geben aber reale Perspektiven deutscher Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wieder – und sind Ausdruck eines wachsenden Willens, nicht länger zuzuschauen. Dieser Text ist KI generiert und basiert auf den transkribierten und danach analysierten Protokollen dieser vertraulichen Dialoge.











:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cc/6e/cc6e604a0f95ebe06907e5cae3e83039/0124347036v1.jpeg?#)
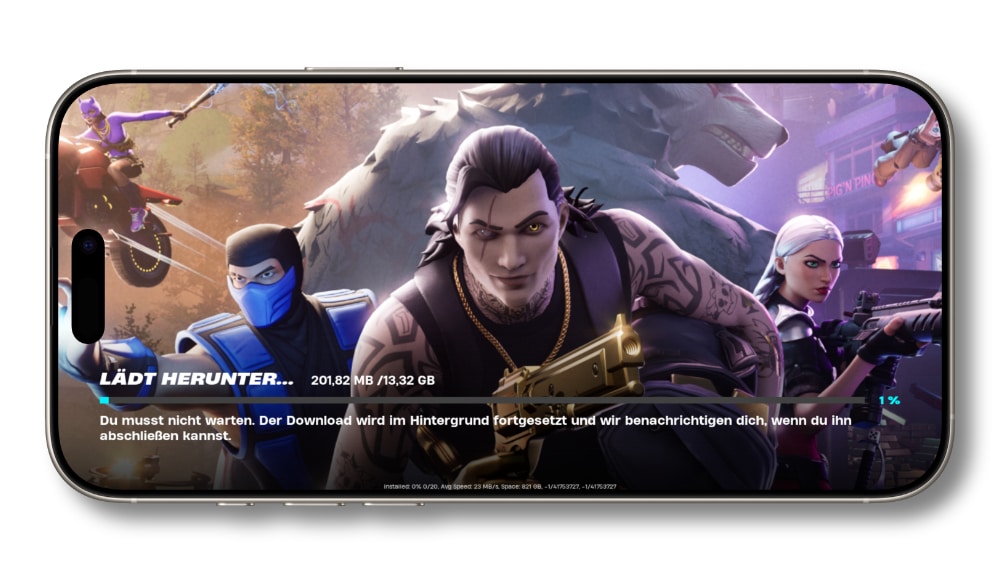






:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/53/d253f5adf5b46e8f7605c495b2bdd791/0124215186v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e2/fe/e2fee5b50079d50bab6a53161b8a1d84/0124078641v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/af/78/af78db42f5d81a8985a7625448ece735/0124433487v2.jpeg?#)