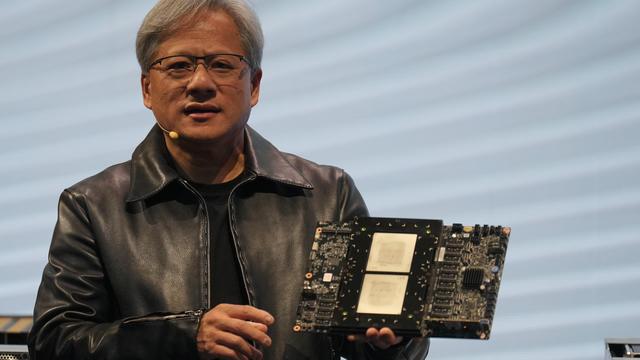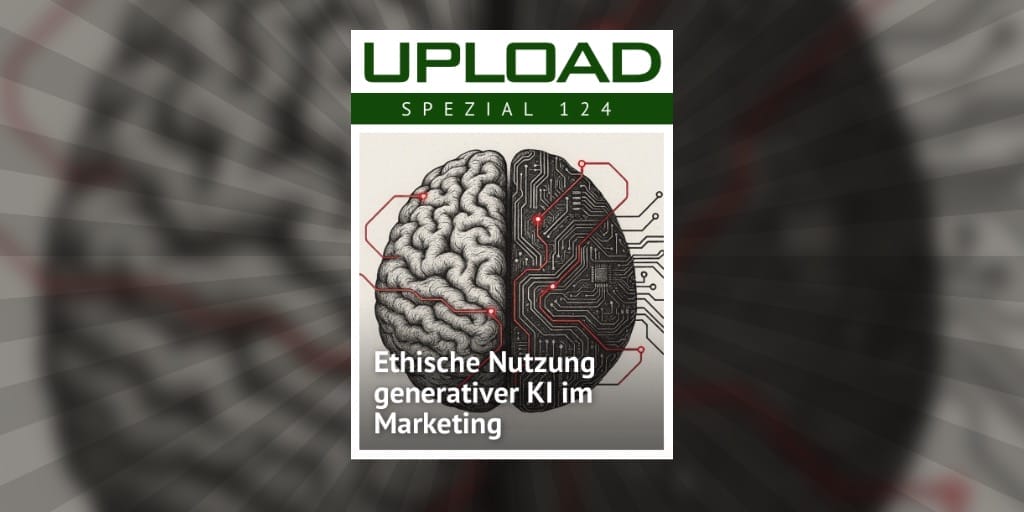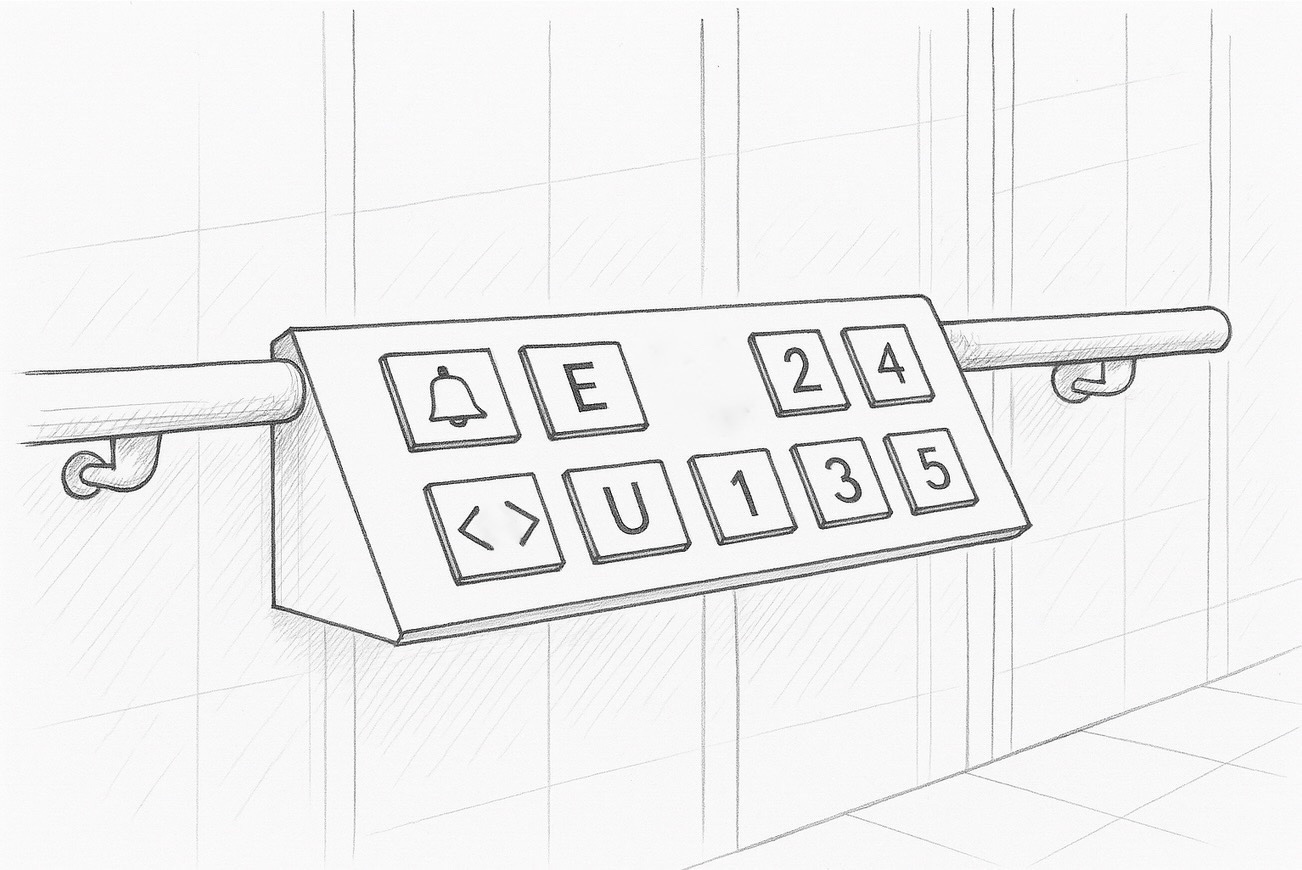Plattenkritik: Florist – Jellywish (Double Double Whammy) - Wieso gute Songs uns vor KI retten
Musik mit KI zu machen ist so einfach geworden wie nie. Spotify wird damit überschwemmt und offenbar ist das auch vielen egal. Aber ist es nicht. „Jellywish“ von Florist zeigt, wie heilsam und wichtig Songs sind – und hoffentlich bleiben. Neulich hatte ich eine Frage an ChatGPT. Mir fiel auf, wie ordinär die Maschine neuerdings mit mir sprach. „Haha, geile Idee!“ Oder „Nice! Das ist mega cool!“, und dann überall Emojis, als wäre ich in einer Chatgruppe von Teenagern gelandet. Als die Plattform vor wenigen Wochen ihren neuen Bildgenerator vorstellte, waren Bilder im Stil von Studio Ghibli plötzlich überall zu sehen. Auch weil die Bildsprache des großen japanischen Animationsstudios für unfassbar viel Liebe zum Detail und Menschlichkeit steht und das nun binnen weniger Sekunden für das Insta-Selfie benutzt werden konnte. Nachdem man aber vier Bilder generiert hat, stellte sich nach der ersten Reaktion „Nice! Das ist mega cool!“ schnell ein stumpfes Gefühl ein. So, das soll es gewesen sein? Und wo ist nun die große Erzählung, die Emotion? Wieso tun KI plötzlich so Buddy-mäßig? Die Antwort ist eigentlich einfach. Damit es erfolgreicher wird und noch weniger Menschen Unterschiede zwischen menschgemachten und KI-generierten Content ausmachen können. Viele sprechen heute schon mit LLMs statt mit Freunden oder Psychologen oder lassen sich ihre Träume analysieren. Den praktischen Nutzen von KI im Alltag kann und möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber mich lässt der Eindruck nicht los, als wollten die Betreiber krampfhaft versuchen, mehr zu sein als nur ein nüchterner Assistent. Sie wollen aus unseren Leben nicht mehr raus und stattdessen noch viel tiefer rein. Der Gründer und CEO der Musik-KI Suno, Mikey Shulman, erklärte Anfang des Jahres in einem Interview, dass Musik machen doch nur ein quälender Prozess sei. Es sei zeitintensiv und man müsse dafür – oh Gott! – viel üben. Instrumente spielen und Produktionssoftware lernen, das soll doch alles nicht sein. Die meisten Musikerinnen und Musiker würden den Großteil ihrer Zeit, die sie mit Musizieren verbringen doch überhaupt nicht genießen, so Shulman. Man möchte mit der Axt auf den Tisch hauen. Weil genau darum geht es doch. Musik machen ist eben Katharsis, eine intensive Auseinandersetzung. Hier ist nichts einfach. Es sei denn, man will es sich einfach machen. „Jellywish“, das fünfte Album der New Yorker Band Florist, dreht sich um eben dieses Thema. Auch wenn es alles andere als eine ausformulierte Antithese zu KI ist, aber im Gesamtbild dann eben doch. Die Band um die Singer-Songwriterin Emely Sprague braucht keinen großen Fuhrpark. Es sind persönliche Themen wie Isolation, Vergänglichkeit und Einsamkeit, die in einfachen und wunderschönen Songs strahlen und beschäftigen. Die stillen Zwischentöne, das Heilsame der Musik, das Prozesshafte und Vereinende – das alles gibt es hier zu fühlen und zu hören und das tut gut. Die Zukunft solcher Bands, die wichtiger denn je sind, könnte aber noch steiniger werden als es ohnehin schon ist. Spotify ist voll von KI-generierter Musik. Vielen fehlt die Aufmerksamkeit und Konzentration für ganze Alben, weil die ganze Zeit irgendwelche Playlists im Hintergrund laufen. Aber „Jellywish“ ist leicht und einfühlsam. Hier wird keine Politik gemacht, es wird einfach gespielt und empathisch erzählt. Und ich wünschte mir, dass das Bewusstsein darüber, auch in breiten Hörer:innenschaft nie untergeht.


Musik mit KI zu machen ist so einfach geworden wie nie. Spotify wird damit überschwemmt und offenbar ist das auch vielen egal. Aber ist es nicht. „Jellywish“ von Florist zeigt, wie heilsam und wichtig Songs sind – und hoffentlich bleiben.
Neulich hatte ich eine Frage an ChatGPT. Mir fiel auf, wie ordinär die Maschine neuerdings mit mir sprach. „Haha, geile Idee!“ Oder „Nice! Das ist mega cool!“, und dann überall Emojis, als wäre ich in einer Chatgruppe von Teenagern gelandet. Als die Plattform vor wenigen Wochen ihren neuen Bildgenerator vorstellte, waren Bilder im Stil von Studio Ghibli plötzlich überall zu sehen. Auch weil die Bildsprache des großen japanischen Animationsstudios für unfassbar viel Liebe zum Detail und Menschlichkeit steht und das nun binnen weniger Sekunden für das Insta-Selfie benutzt werden konnte. Nachdem man aber vier Bilder generiert hat, stellte sich nach der ersten Reaktion „Nice! Das ist mega cool!“ schnell ein stumpfes Gefühl ein. So, das soll es gewesen sein? Und wo ist nun die große Erzählung, die Emotion?
Wieso tun KI plötzlich so Buddy-mäßig? Die Antwort ist eigentlich einfach. Damit es erfolgreicher wird und noch weniger Menschen Unterschiede zwischen menschgemachten und KI-generierten Content ausmachen können. Viele sprechen heute schon mit LLMs statt mit Freunden oder Psychologen oder lassen sich ihre Träume analysieren. Den praktischen Nutzen von KI im Alltag kann und möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber mich lässt der Eindruck nicht los, als wollten die Betreiber krampfhaft versuchen, mehr zu sein als nur ein nüchterner Assistent. Sie wollen aus unseren Leben nicht mehr raus und stattdessen noch viel tiefer rein.
Der Gründer und CEO der Musik-KI Suno, Mikey Shulman, erklärte Anfang des Jahres in einem Interview, dass Musik machen doch nur ein quälender Prozess sei. Es sei zeitintensiv und man müsse dafür – oh Gott! – viel üben. Instrumente spielen und Produktionssoftware lernen, das soll doch alles nicht sein. Die meisten Musikerinnen und Musiker würden den Großteil ihrer Zeit, die sie mit Musizieren verbringen doch überhaupt nicht genießen, so Shulman.
Man möchte mit der Axt auf den Tisch hauen. Weil genau darum geht es doch. Musik machen ist eben Katharsis, eine intensive Auseinandersetzung. Hier ist nichts einfach. Es sei denn, man will es sich einfach machen. „Jellywish“, das fünfte Album der New Yorker Band Florist, dreht sich um eben dieses Thema. Auch wenn es alles andere als eine ausformulierte Antithese zu KI ist, aber im Gesamtbild dann eben doch. Die Band um die Singer-Songwriterin Emely Sprague braucht keinen großen Fuhrpark. Es sind persönliche Themen wie Isolation, Vergänglichkeit und Einsamkeit, die in einfachen und wunderschönen Songs strahlen und beschäftigen.
Die stillen Zwischentöne, das Heilsame der Musik, das Prozesshafte und Vereinende – das alles gibt es hier zu fühlen und zu hören und das tut gut. Die Zukunft solcher Bands, die wichtiger denn je sind, könnte aber noch steiniger werden als es ohnehin schon ist. Spotify ist voll von KI-generierter Musik. Vielen fehlt die Aufmerksamkeit und Konzentration für ganze Alben, weil die ganze Zeit irgendwelche Playlists im Hintergrund laufen. Aber „Jellywish“ ist leicht und einfühlsam. Hier wird keine Politik gemacht, es wird einfach gespielt und empathisch erzählt. Und ich wünschte mir, dass das Bewusstsein darüber, auch in breiten Hörer:innenschaft nie untergeht.