Liberalismus als Feindbild: Von Böckenförde zu Dugin und Deneen [Gesundheits-Check]
Postliberalismus in den USA Gerade gehen Meldungen durch die Medien, dass die USA auch von europäischen Firmen die Beendigung von Diversity-Programmen fordern. Der amerikanische Kulturkampf kennt, wie auch früher schon, keine Grenzen. Zur Erklärung trägt neben der imperialistischen Prägung der USA ein zweiter Impuls bei. „Project 2025“, an dem sich die neue Administration orientiert, verfolgt…
![Liberalismus als Feindbild: Von Böckenförde zu Dugin und Deneen [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)
Postliberalismus in den USA
Gerade gehen Meldungen durch die Medien, dass die USA auch von europäischen Firmen die Beendigung von Diversity-Programmen fordern. Der amerikanische Kulturkampf kennt, wie auch früher schon, keine Grenzen.
Zur Erklärung trägt neben der imperialistischen Prägung der USA ein zweiter Impuls bei. „Project 2025“, an dem sich die neue Administration orientiert, verfolgt auch eine konservative Frontstellung gegen den Liberalismus. Der Mentor von Vance, Patrick Deneen, sieht den Liberalismus als gescheitert an. Er habe seine Versprechungen, allen Menschen ein besseres Leben zu verschaffen, nicht einhalten können. Für das Scheitern des Liberalismus macht Deneen die Freisetzung der Menschen aus ihren gemeinschaftsfördernden Traditionen verantwortlich, wie sie insbesondere auch in den Bestrebungen nach Selbstbestimmung von Frauen, Queer-Personen oder in den USA von Menschen mit schwarzer Hautfarbe zum Ausdruck kommt.
Liberale Leerstellen
Unschwer kann man hier das berühmte Böckenförde-Diktum heraushören:
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.“
Und Böckenförde hat auch gesehen, was droht, wenn es dem freiheitlichen, säkularisierten Staat nicht gelingt, sein soziales Kapital zu regenerieren:
„Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“
Dass die „westlichen Werte“ erodiert sind, auch das Versprechen auf „Wohlstand für alle“ nicht so ohne Weiteres als eingelöst gelten kann, wird man kaum bestreiten können. Das macht die Enttäuschung vieler Menschen und ihre Hinwendung zu anderen „Wertesystemen“ verständlich. Aber man kann nicht zurück in die weltanschaulichen Prägungen des 19. Jahrhunderts oder noch früherer Zeiten, ohne autoritär zu werden. Der liberale Staat ist in der Tat ein Wagnis. Mit Nietzsches Zarathustra gesprochen:
„Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, — ein Seil über einem Abgrunde. Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben.“
Vor ein paar Monaten hatte ich hier auf einen Beitrag von Timothy Snyder in den „Blättern für deutsche und internationale Politik“ verwiesen, der den halbierten Freiheitsbegriff unserer liberalen Gesellschaften beklagt. In der aktuellen Ausgabe der „Blätter“ ist ebenfalls wieder ein Artikel, der diesen Topos aufgreift, von Carlotta Voß, einer Politikwissenschaftlerin, die über Thukydides promoviert hat. Der griechische Autor ist bis heute ein Stichwortgeber der politischen Theorie, für viele im Sinne einer autoritären Führung des Volkes. Carlotta Voß beschreibt den Einfluss, den Patrick Deneen und die „postliberale Bewegung“ mit ihren konservativ-katholischen Orientierungen auf die aktuelle amerikanische Administration hat und wie diese Strömungen die politische Debatte moralisch auflädt. Die Leerstelle des Liberalismus wollen die Postliberalen mit Werten einer „natürlichen Ordnung“ füllen, von den Geschlechterrollen bis zur Vaterlandsliebe. Auch das brüchige, für manche gebrochene Wohlstandsversprechen wird von den Postliberalen auf der ideologischen Ebene explizit adressiert, mag auch die realpolitische Umsetzung hintangestellt bleiben.
Antiliberalismus in Russland
Kurioserweise hat all das ein Spiegelbild in Russland. Dort propagiert Putin ebenfalls traditionelle Werte wie „Männlichkeit“, „Familie“ oder „nationale Größe“ und bemüht wie vor der russischen Revolution die orthodoxe Kirche mit überkommenen Glaubensinhalten als heldentodverherrlichende Staatskirche. Den Westen sieht er als dekadent, moralisch haltlos und schwach, Russland in einer missionarischen, weltrettenden Rolle. Die „Philosophie“ dazu liefert Alexander Dugin. Ein Wohlstandsversprechen wird hier nicht bemüht, für das gute Leben muss die Größe Russlands reichen.
Die Zukunft?
Was nun? Wie sollen liberale Gesellschaften aussehen, die Böckenfördes Warnung zur Kenntnis nehmen, nicht mehr auf die abgestandenen Sprüche von gestern wie „Leistung muss sich wieder lohnen“ setzen oder den Weihnachtsbaum für den Inbegriff einer „Leitkultur“ halten, Gesellschaften, die mit Wolf Biermann fragen, „das soll nun alles gewesen sein, das bisschen Fußball und Führerschein“?
Die FDP in Deutschland hatte darauf keine Antworten. Lindner ist zuletzt außer der Bewahrung der Schuldenbremse und „mehr Musk und Milei wagen“ nichts zur Zukunft des Landes eingefallen. Das war angesichts von Deneen und Dugin, von Vance und Putin, zu wenig. Leute wie Musk orientieren sich zwar sicher weniger an Deneen als an Murray Rothbard und Seinesgleichen, aber libertärer Radikalismus will nur die Freiheit der Superreichen, nicht von uns allen, das ist kein demokratisches Konzept, sondern ein elitär-autoritäres – und da treffen sich dann durchaus recht unterschiedliche Strömungen des politischen Denkens in einer gemeinsamen Galionsfigur namens Donald Trump.
Ergo, was nun?




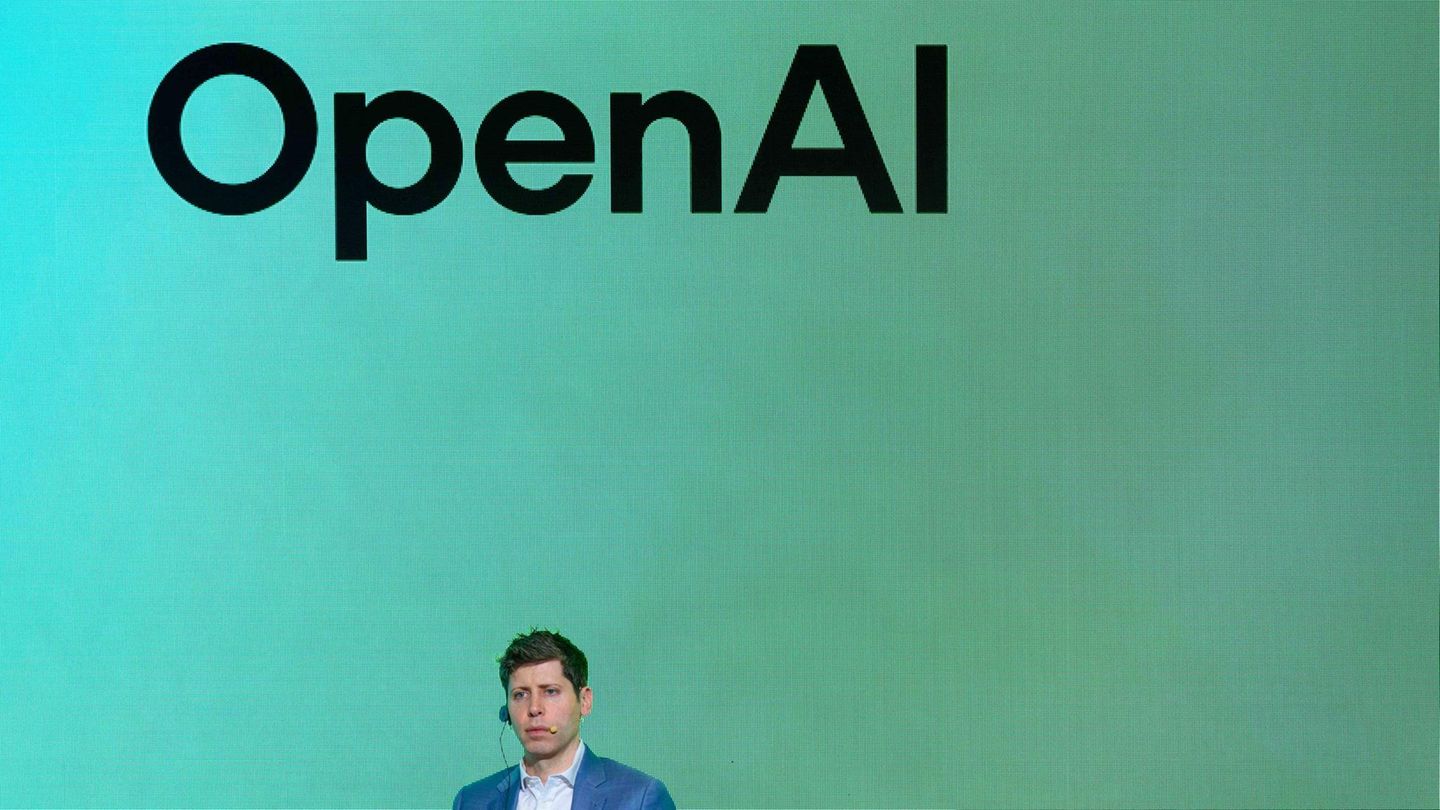





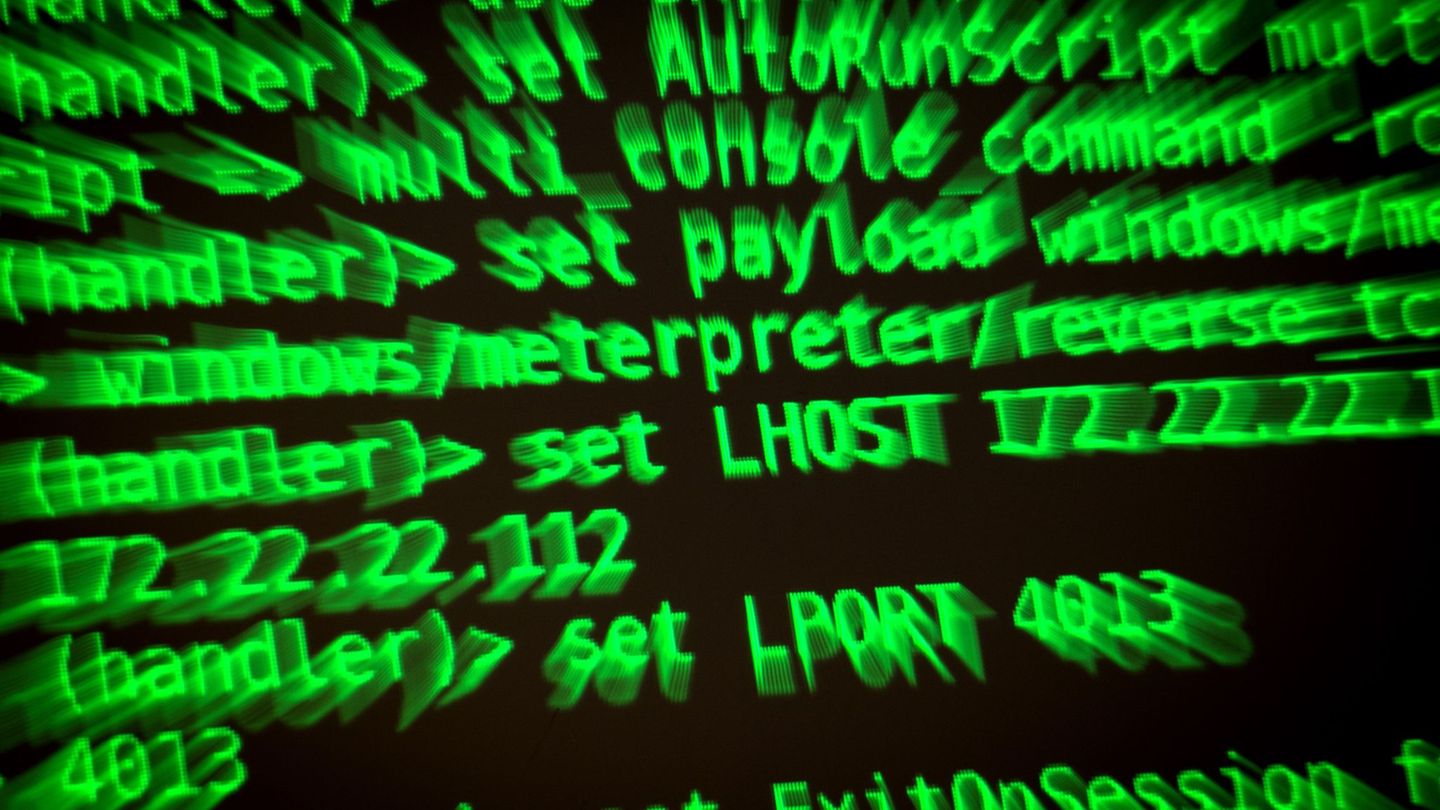



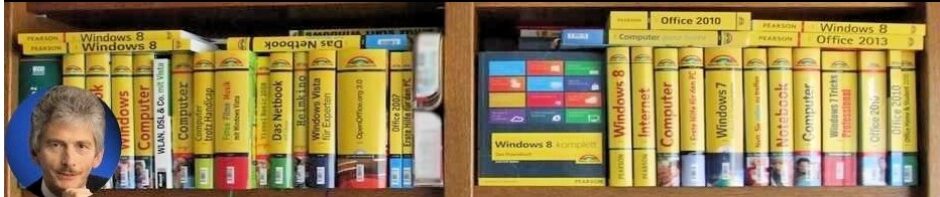

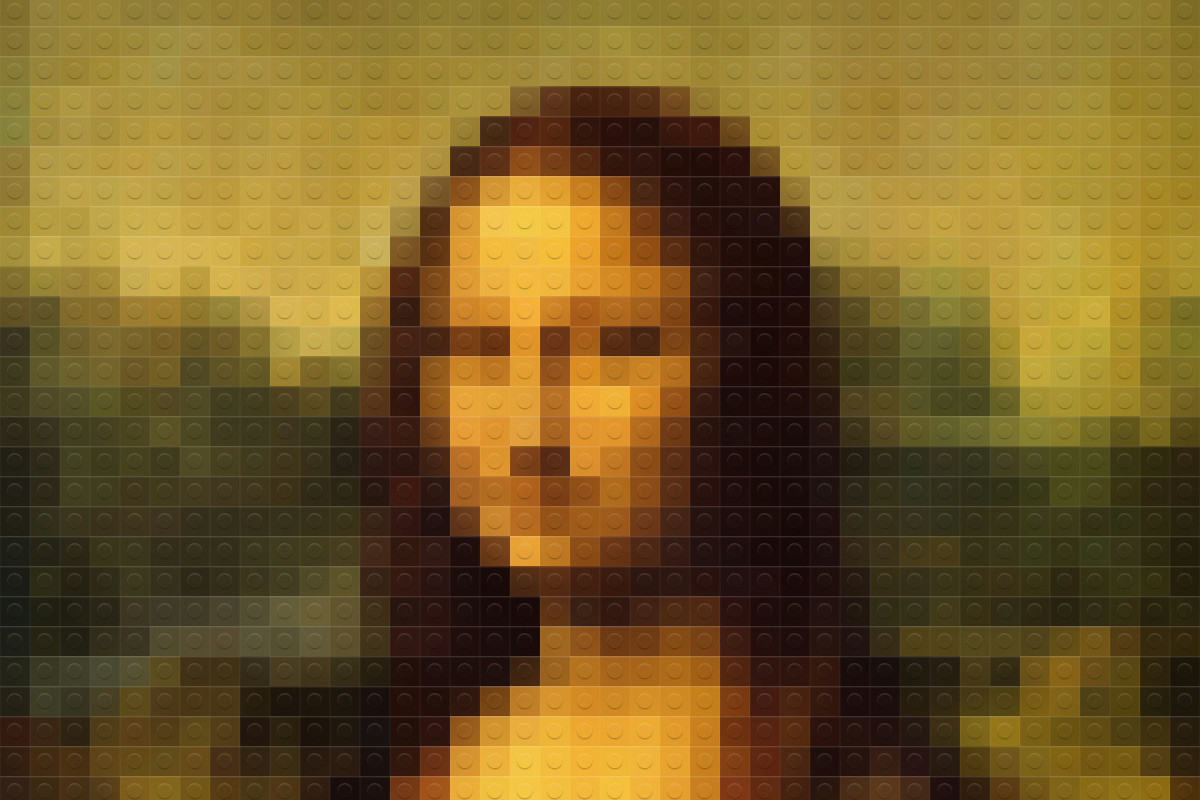






,regionOfInterest=(675,363)&hash=643e0bd37eee0bc3d774036257b3b54dd4cbeb8d655c87dacd81ed43226becf5#)
,regionOfInterest=(613,296)&hash=60f57ea38bd02559351052717352c3e39220dad6eade31377eeb6cfc5c367766#)
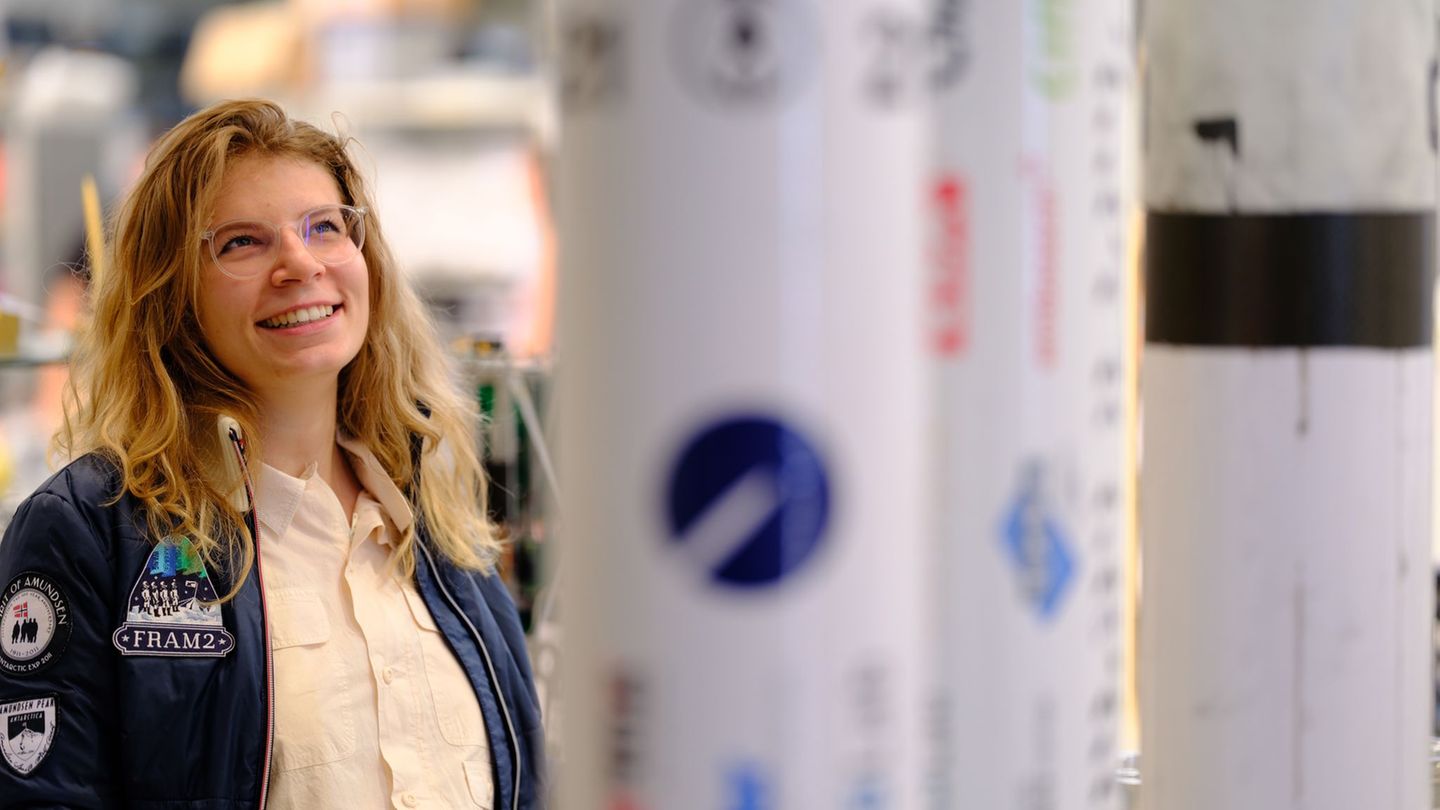



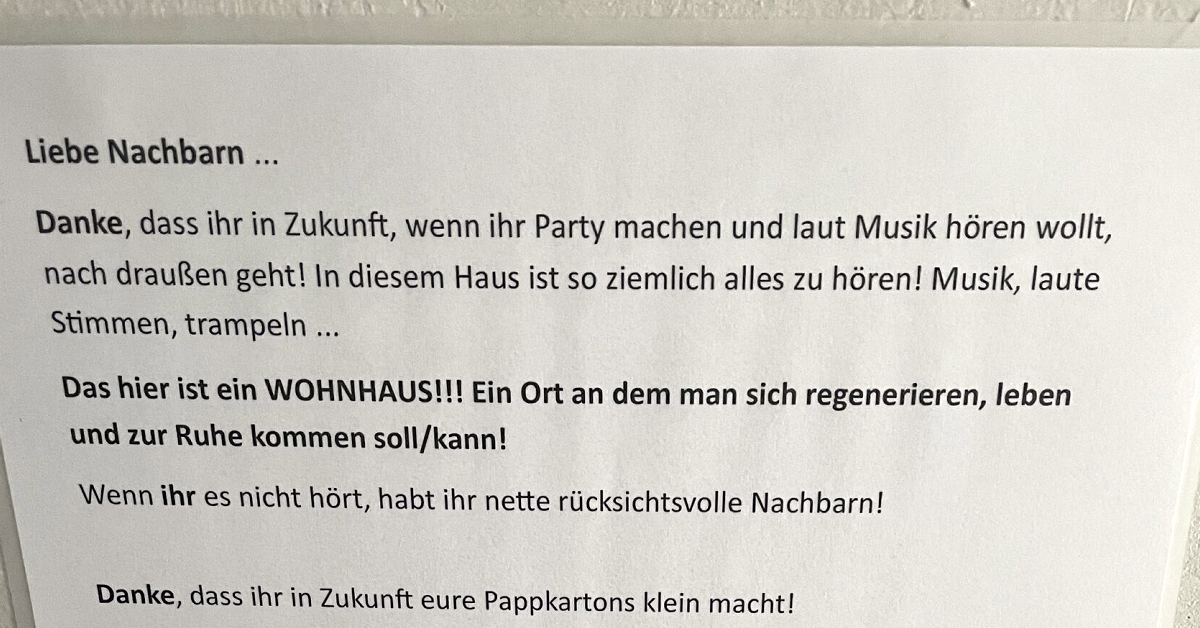













,regionOfInterest=(1012,951)&hash=0e917e8c2eead89d1c6aa8e88a8f92e61499dca748b2b601eed83e4c67fea71a#)



,regionOfInterest=(1003,605)&hash=3d6cfe025ab61fed7ac88cf0073f7be4291b1cf36da8414d4a50853766dfb2c8#)























