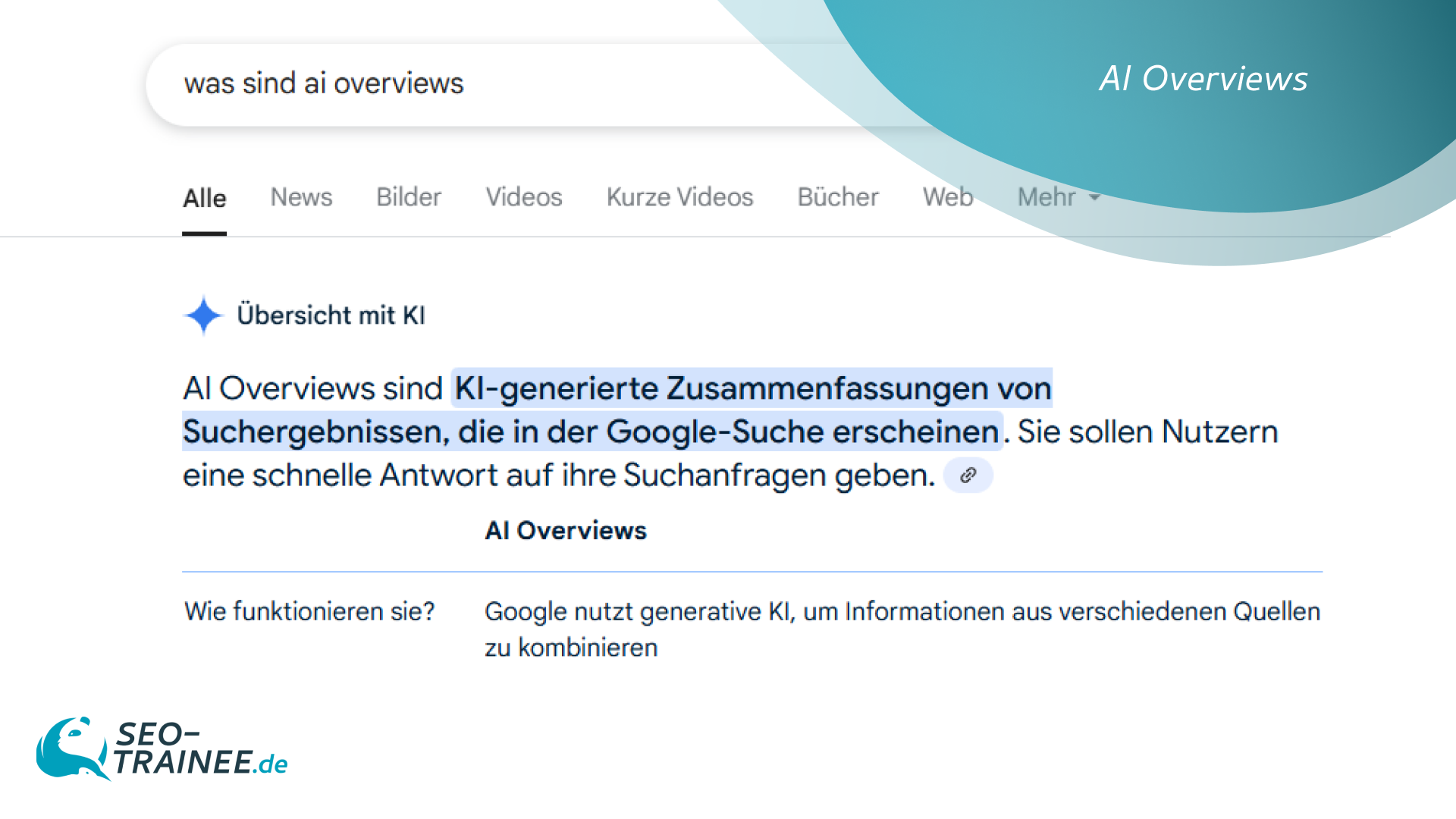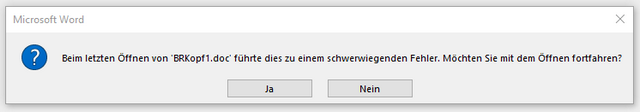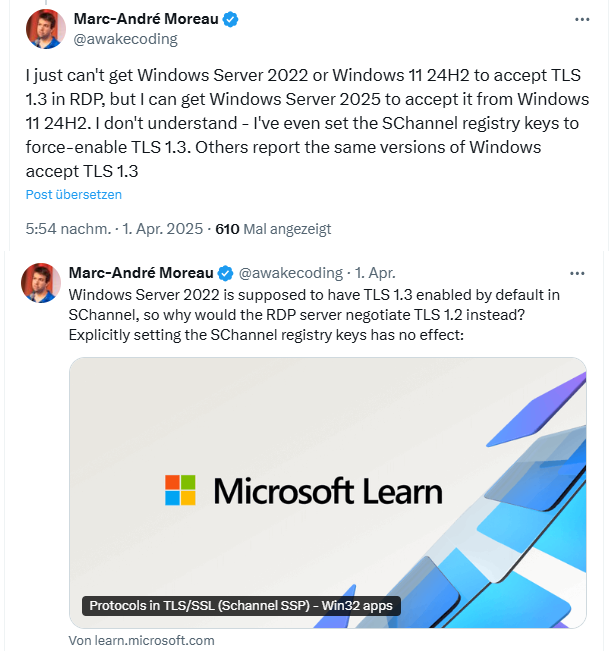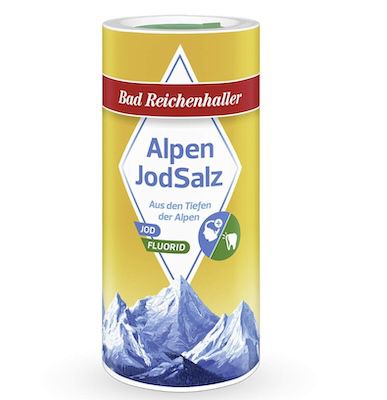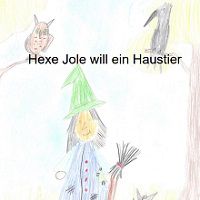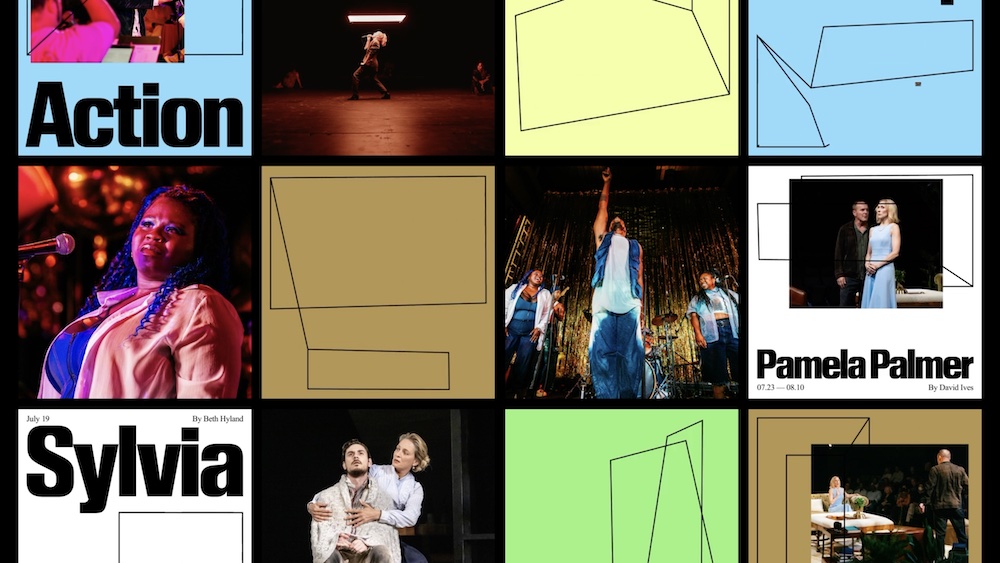Weltgeschichte im Zeitraffer: Wo bleibt EU-Europa? – Sechs Szenarien
Die Veränderungen in der internationalen Politik verlaufen immer schneller. Wir können einen grundlegenden Wandel der internationalen Politik beobachten, der in einem Tempo von statten geht, welches es kaum zulässt, die sich wandelnde Realität adäquat zu erfassen. Man kann ohne Übertreibung von einem Zeitraffereffekt sprechen: Bahnte sich der Epochenbruch – das Ende der unipolaren Weltordnung –Weiterlesen

Die Veränderungen in der internationalen Politik verlaufen immer schneller. Wir können einen grundlegenden Wandel der internationalen Politik beobachten, der in einem Tempo von statten geht, welches es kaum zulässt, die sich wandelnde Realität adäquat zu erfassen. Man kann ohne Übertreibung von einem Zeitraffereffekt sprechen: Bahnte sich der Epochenbruch – das Ende der unipolaren Weltordnung – anfänglich sehr langsam und in der westlichen Politik und den Medien nahezu unbemerkt an, so ist spätestens mit dem Beginn des heißen Krieges im Februar 2022 in und um die Ukraine dieser nun unübersehbar. Der offene Krieg selbst katalysierte den Umbruchsprozess in einer für den Westen nicht erwarteten Dimension: Der globale Nicht-Westen verweigert den Gehorsam im Hinblick auf das vorgegebene Kriegsnarrativ sowie der Forderung, sich der Sanktionspolitik gegen Russland anzuschließen. Von Alexander Neu
Vielmehr sieht sich der Westen genötigt, sogenannte Sekundärsanktionen gegen die „ungehorsamen“ Staaten zu verhängen oder anzudrohen, um überhaupt ein Minimum an Gefolgschaft herbeizwingen zu können. Zwei weitere „Booster“ beschleunigen den Epochenbruch: Erstens, der Krieg im Nahen Osten, mit massenhaften zivilen Opfern, die im globalen Nicht-Westen, insbesondere in der islamischen Welt mindestens für Unverständnis sorgen, was die westliche Doppelmoral im Hinblick auf die zivilen Opfer betrifft. Die Glaubwürdigkeit der vom Westen vorgetragener Werte wie die als universell geltenden Menschenrechte wird für den Rest der Welt absolut sichtbar zu Grabe getragen. Und der zweite Booster: Die Amtsübernahme der US-Administration durch D. Trump. Dieser letzte Booster stellt nicht einen wachsenden Riss zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen dar, sondern er ist ein Riss innerhalb des Westens – und das auch noch zwischen der bisherigen und unangefochtenen westlichen Führungsmacht USA und seiner Satelliten im transatlantischen Raum. Die neue USA unter Trump will den direkten Krieg in der Ukraine und offensichtlich auch tendenziell den Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland beenden. EU-Europa sitzt – selbstverschuldet – nicht mit am Verhandlungstisch. Die Enttäuschung über den 180-Gradwandel (nicht 360 Grad) der USA sitzt in EU-Europa tief und befördert Frustration, Orientierungslosigkeit, Aktionismus und sogar verbale Aggression gegenüber den neuen USA. EU-Europa befindet sich derweil nun – erneut völlig selbstverschuldet – zwischen allen Stühlen in Konfrontation mit Russland (irgendwas zwischen indirektem und direktem Kriegsgegner), China (strategischer Rivale) und den Trump-USA (Verräter der transatlantischen Welt), um es etwas zugespitzt zu formulieren. Ungeachtet der derzeitig tatsächlich miserablen Situation EU-Europas, stellt sich die Frage, wohin EU-Europa sich entwickeln wird in der sich neuformierenden Weltordnung mit mehreren Primärpolen (USA, China und Russland als erste Liga) und Sekundärpolen (Indien, Brasilien, Iran, Indonesien, Türkei, Südafrika etc. als zweite Liga) – also in einer multipolaren Welt mit unterschiedlichen Pol-Ebenen? Welcher der beiden Ebenen wird EU-Europa zugehörig sein? Wird EU-Europa Subjekt oder Objekt der neuen sich herausbildenden Weltordnung sein? Oder wird EU-Europa sogar tendenziell oder gar absolut zerfallen, die europäische Integration also scheitern? Welche Folgen wird das für Deutschland haben? Die Zukunft präzise vorherzubestimmen ist nicht möglich. Möglich jedoch ist, sich abzeichnende Tendenzen zu identifizieren und damit mögliche Entwicklungspfade aufzuzeigen. Der Aspekt des Krieges in und um die Ukraine und seiner Beendigung unter welchen Bedingungen spielt auch für die künftige Entwicklung EU-Europas – angesichts des Stellvertretercharakters des Krieges – und somit auch für Europa eine zentrale Rolle. Im Folgenden sollen einige Szenarien holzschnitzartig dargestellt werden. Diese Szenarien sind weder erschöpfend noch zwingend, zeigt die Geschichte doch immer wieder, wie komplex, wie viele Graustufen es zwischen schwarz und weiß gibt.
- Szenario – Wiederentdeckung der Realpolitik: EU-Europa und seine Mitgliedsländer erkennen in den nächsten Wochen und Monaten ihre schwache Position im Verhältnis zu den USA und Russland mit Blick auf den Ukrainekrieg im Speziellen und hinsichtlich des globalen Wandels im Generellen an. Die Entscheidungseliten zeigen sich zunehmend beratungsoffen für einen realpolitischen Kurswechsel, der den neuen Realitäten des Multipolarisierungsprozesses Rechnung trägt. Es geht im Prinzip nur noch darum, sich den neuen Entwicklungen gesichtswahrend zu stellen, so auch hinsichtlich des US-amerikanischen Kurs` unter D. Trump mit Blick auf dessen Friedensinitiative. Dass heißt, auch den Ukrainekrieg so schnell wie möglich – und das nicht nur verbal, sondern auch diplomatisch und materiell – zu beenden. Darüber hinaus wird an Konzepten gearbeitet, welche Stellung EU-Europa in der künftigen neuen Weltordnung durch konstruktives Mitwirken für sich mit der Zielsetzung, einen Platz in der ersten Liga zu besetzen, sichern kann.
Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung tendiert gegen Null. Die politischen Entscheider sowie auch die jeweiligen Mainstreammedien, insbesondere in den großen EU-Staaten, Frankreich und Deutschland, aber auch in einigen osteuropäischen Staaten sowie außerhalb der EU, Großbritannien, sind transatlantisch geprägt. Die politischen Biographien verdanken sich einer speziellen ideologischen Grundierung, die nicht so einfach aufgebrochen werden kann. Es könnte sich, wenn es um einen Wandel gehen soll, um eine Lost-Generation handeln, die nicht imstande ist, sich den neuen Realitäten pragmatisch anzupassen – fehlt schlichtweg an geistiger Flexibilität. Sie fokussieren sich unverdrossen und alternativlos auf das transatlantische Bündnis, da sie die Trump-Administration nur für einen temporären Betriebsunfall betrachten, den man nur aussitzen müsse.
- Szenario – Das Aussitzen: Die Trump-Administration vermag es nicht, einen Waffenstillstand und einen Frieden für die Ukraine durchzusetzen. Entweder unterläuft Russland oder EU-Europa die US-Anstrengungen. Die USA ziehen sich frustriert aus den Friedensbemühungen zurück und überlassen EU-Europa das Feld. EU-Europa zahlt und liefert weiterhin Waffen an die Ukraine. Ein Sieg ist auf beiden Seiten weiterhin nicht in Aussicht. In EU- und NATO-Brüssel setzt man entweder auf einen vorzeitigen oder regulären Machtwechsel in Washington, da man die Trump-Administration als einen temporären Betriebsunfall betrachtet. Bis dahin hält EU-Europa plus Großbritannien die Stellung in der liberalen Welt in der Hoffnung, dass spätestens die USA 2029 wieder die Führungsrolle in der transatlantischen Welt übernehmen und man gemeinsam den Sieg der Ukraine und die Niederlage Russlands herbeizuführen vermag. Die gute alte Zeit der bestenfalls unipolaren Weltordnung ist wieder greifbar nahe. Das US-Engagement in Europa und die NATO erleben einen zweiten Frühling. Es ist davon auszugehen, dass auch der neue derzeit auszuhandelnde schwarz-rote Koalitionsvertrag genau diese Denk- und Handlungsrichtung reflektiert.
Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit dies Szenarios ist eher gering. Ein vorzeitiger Machtwechsel ist wenig wahrscheinlich. Das Wahlergebnis für D. Trump war überwältigend, womit er eine hohe politische Legitimität besitzt. Allenfalls könnte ein Amtsenthebungsverfahren erfolgreich sein, wenn D. Trump einen gewaltigen Fehler macht – gekoppelt mit einem signifikanten Zustimmungsverlust. Sollte D. Trump durch ein erneutes Attentat amtsunfähig oder getötet werden, würde J.D. Vance, sein Vize, das Amt übernehmen. Und was seine politische Positionierung anbetrifft, hat er auf der Münchner Siko kürzlich ausgeführt.
- Szenario – Sieg EU-Europas: Die Trump-Administration vermag es nicht, einen Waffenstillstand und einen Frieden für die Ukraine durchzusetzen. Entweder unterläuft Russland oder EU-Europa die US-Anstrengungen. Die USA ziehen sich frustriert aus den Friedensbemühungen zurück und überlassen EU-Europa das Feld. EU-Europa zahlt und liefert weiterhin Waffen an die Ukraine. Die massive Unterstützung der Ukraine überfordert Russland. Moskau verliert den Krieg und muss sich aus der Ukraine zum Teil oder gänzlich zurückziehen. Russland wird verpflichtet, massive Reparationszahlungen an die Ukraine zu leisten und seine Streitkräfte signifikant abzubauen.
EU-Europa setzt im Bündnis mit Großbritannien (London assoziiert sich zumindest sicherheitspolitisch wieder mit EU-Europa) auf eine massive Militarisierung. Der Abstimmungsmodus in EU-Europa im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik /Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird vom Einstimmigkeitsprinzip auf das Prinzip der qualifizierten Mehrheit verändert, wodurch die Entscheidungen in Brüssel klarer, schneller und somit EU-Europa handlungsfähiger wird. Insgesamt werden weitere nationalstaatliche Handlungskompetenzen auf die EU-Ebene verlagert und somit den nationalstaatlichen Willensbildungsprozessen entzogen. Die „Republik Europa“ als Elitenprojekt gewinnt an Konturen.
EU-Europa wird trotz tendenzieller Deindustrialisierung, Sozialabbau und damit einhergehenden Protesten zu einem Globalakteur in der ersten Liga – neben den USA, Russland und China. Die USA akzeptieren eine neue transatlantische Partnerschaft auf Augenhöhe, orientieren sich jedoch sicherheitspolitisch sehr stark auf den pazifischen Raum, so dass EU-Europa für die Sicherheit Europas sich zuständig und befähigt fühlt. Der Westen als transatlantischen Projekt existiert wieder, jedoch mit einem eigenständigen EU-Europa. Die neue europäische Sicherheitsarchitektur wird ohne Russland oder gegen Russland geformt, womit die Grundlagen für einen erneuten Konflikt, wie auch schon im Versailler Vertrag 1919, geschaffen werden. Die NATO reduziert sich operativ auf die europäischen NATO-Staaten.Wahrscheinlichkeit: Ob EU-Europa tatsächlich unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges, der graduellen Abwendung der USA von seinen europäischen Verbündeten sowie insgesamt des globalen Epochenbruchs tatsächlich in der Lage ist, sich so zu einen, dass es sich zu einem Globalakteuer der 1. Liga zu entwickeln imstande sein wird, ist zu bezweifeln. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Angefangen von der Voraussetzung, dass Russland militärisch ins Hintertreffen käme. Die Realität vor Ort sieht anders aus. Es mangelt an dem entscheidenden Willen, die verbliebene nationale Souveränität in wichtigen politischen Feldern, wie der Außen- und Sicherheitspolitik tatsächlich an eine Brüssler, wenig demokratisch legitimierte Bürokratie zu delegieren. Die EU-Südländer haben andere außenpolitische Interessen als die EU-Nord- oder EU-Ostländer. Die osteuropäischen Staaten stehen ohnehin eher für ein intergouvernementales statt eines supranationalen EU-Europa. Und Deutschland, irgendwo dazwischen – einerseits mit viel Verständnis gegenüber den osteuropäischen Mitgliedsstaaten, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht, andererseits aber dem Leitbild eines supranationalen Europas`, also einer „Republik Europa“ gegenüber offen. Zugleich sehen wir in EU-Europa sowohl im Westen als auch im Osten in der Bevölkerung eine ideologische Zeitenwende, die konservativen bis rechten Kräften, die sich ausgesprochen EU-kritisch positionieren, gewinnen an politischem Zuspruch. Ein weiter so des politisch-liberalen Mainstreams in Politik und Medien wird immer schwieriger.
- Szenario – Niederlage der Ukraine: Die Trump-Administration vermag es nicht, einen Waffenstillstand und einen Frieden für die Ukraine durchzusetzen. Entweder unterläuft Russland oder EU-Europa die US-Anstrengungen. Letztendlich gewinnt Russland den Krieg in und um die Ukraine. Die von Russland besetzten Gebiete – welche Ausmaße sie auch immer annehmen werden – gehen für die Ukraine verloren. Die Rest-Ukraine wird zur Neutralität verpflichtet und ist weitgehend gesellschaftlich und wirtschaftlich zerstört. Eine schleichende, aber unaufhaltsame millionenfache Armutsmigration aus der Ukraine nach Polen, Deutschland und Österreich beginnt. EU-Europa sieht sich zwar weiterhin in der Pflicht, die Ukraine wirtschaftlich und finanziell zu unterstützen, wird dies aber nur unzureichend leisten (können), da die Mitgliedsländer der EU selbst unter enormem wirtschaftlichem Druck stehen. Die Militarisierungskosten, die Schuldenlast der Staatshaushalte, die tendenzielle Deindustrialisierung aufgrund der Bürokratie, der verfehlten Energiesanktionen gegen Russland und der US-Zölle auf EU-Produkte, der verfehlten Migrationspolitik etc. führen zu sozialen Unruhen und damit einhergehenden Instabilitäten bis hin zur Gefährdung der inneren Sicherheit. Diese Entwicklung zwingt die EU und ihre Mitgliedsstaaten, die Unterstützung der Ukraine bis auf ein paar Potemkin’sche Dörfer runterzufahren. Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU steht nicht mehr zur Debatte, sofern überhaupt noch eine Erweiterungspolitik eine Rolle spielen wird. EU-Europa besteht zwar weiter in der bisherigen Konstitution, muss sich aber auf die Aufrechterhaltung seiner Binnenstabilität konzentrieren. Und auf globaler Ebene wird EU-Europa als unseriöser Sicherheitsgarant mit viel Werteideologie, aber wenig Ausstrahlungskraft und praktizierten Doppelstandards wahrgenommen und spielt sodann auf der weltpolitischen Bühne bestenfalls in der zweiten Liga.
Wahrscheinlichkeit: Dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen wird, ist sehr wahrscheinlich. Ein militärischer Sieg unterhalb der Rückgewinnung der von Russland eroberten Gebiete wäre kein Sieg. Auch scheint, sofern es nach den USA geht, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine vom Tisch zu sein, auch wenn die europäischen Verbündeten das immer noch anders sehen. Damit hätten die EU respektive ihre Mitgliedstaaten Hunderte Milliarden Euro Steuergelder in den Sand gesetzt. Weitere Milliarden Steuergelder für die Aufrüstungsorgie als vermeintlich verbindendes Instrument der Kohäsion der EU wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gegenteil in den EU-Gesellschaften erzeugen. Es fehlt schlicht an einer neuen attraktiven, progressiven und sodann verbindlichen Idee für die Europäische Integration. Der mangelnde Sinn für politischen Realismus in den Zeiten des weltpolitischen Umbruchs führt eher in eine Selbstisolation EU-Europas.
- Szenario – Ende der europäischen Integration: EU-Europa unterstützt die Ukraine weiterhin massiv. Dennoch verliert die Ukraine den Krieg (siehe Szenario 3 – Niederlage der Ukraine). Obschon EU-Europa sehr viel in die Unterstützung der Ukraine als auch in die eigene Militarisierung investiert hat, wird weltweit, aber auch innerhalb der EU deutlich, das EU-Europa kein ernstzunehmender Sicherheitsgarant ist. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schwindet. Die ersten EU-Mitgliedsstaaten orientieren sich zunächst verdeckt, dann immer offener auf die Trump-Administration, in der Hoffnung auf einen bilateralen US-Schutzschirm. Es beginnt ein Wettlauf europäischer Staaten um die Gunst der USA. Die EU wird zwar nicht offiziell aufgelöst, aber EU-Brüssel verliert zunehmend an Handlungskompetenzen, da die Mitgliedsstaaten ihr Heil in der eigenen Souveränität suchen. Diese Entwicklung wird dann als Rückkehr zum Leitbild der „Europa der Vaterländer“ der Öffentlichkeit verkauft, tatsächlich jedoch wird die europäische Integration in erheblichem Maße rückabgewickelt. Die NATO selbst spielt für die USA keine wesentliche Rolle mehr – Artikel 5 des NATO-Statuts` verkommt zur Lyrik. Die NATO wird zwar ebenfalls nicht offiziell aufgelöst, verabschiedet sich aber in die Passivität.
Einige, insbesondere osteuropäische Staaten setzen auf Annäherung und Ausgleich mit Russland in der Hoffnung, dass dies angesichts der neuen Realitäten ihrer eigenen Sicherheit zuträglicher als ein Konfrontationskurs ist. EU-Europa als Gestaltungsakteur findet nicht statt. Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten bewegen sich in ihrer politischen Souveränität in dem Spektrum zwischen Mittelmacht (Deutschland, Frankreich, Polen und Italien) und wenig relevanten Staaten auf der internationalen Bühne.
Wahrscheinlichkeit: Dieses Szenario erachte ich als nicht unwahrscheinlich. Eine Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit wie im 19. Jahrhundert wird es zwar nicht werden, aber EU-Brüssel wird politisch-operativ weitgehend irrelevant werden. Einige EU-Staaten werden untereinander bi-, tri- oder multilateral ggf. unter Rückgriff auf EU-Strukturen enger miteinander kooperieren, andere eher nicht. Die jeweilige neue nationalstaatliche Ausrichtung einiger EU-Mitgliedsstaaten (beispielsweise Ungarn, die Slowakei, aber auch Polen, Rumänien und Bulgarien) auf die USA und Russland stellt eine Flucht in die neuen internationalen Realitäten dar.
- Szenario: Krieg in Europa: Großbritannien, Frankreich, Deutschland und eventuell ein paar andere Staaten – nicht jedoch die EU oder NATO als solches – entscheiden, in den Ukraine-Krieg aktiv einzugreifen. Entweder als „Friedenstruppe“ zur Absicherung eines Friedensabkommens oder als Interventionstruppe, um eine drohende Niederlage der Ukraine doch noch abzuwenden. In beiden Fällen, käme es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Kampfhandlungen, da bislang Moskau „Friedenstruppen“ aus EU und NATO-Staaten kategorisch ablehnt und sie als militärische Ziele betrachtet. Die oben genannten europäische Staaten setzen auf Artikel 5 des NATO-Statuts, d.h., dass die USA ihr Schutzversprechen einhalten und damit die Abschreckung gegen Russland aufrechterhalten, so dass ihre Armeen nicht in die Defensive geraten oder auch ihre Territorien Schauplatz von Kampfhandlungen werden, womit sich das Risiko für die Truppenstellerstaaten in ihren Augen als überschaubar erweise.
Exkurs
Der Text des Artikel 5 lautet:
„Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von Ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird; sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen (…) der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebietes wieder herzustellen und zu erhalten. (…)“.
Die Formulierung des Artikels impliziert indessen zwei Unsicherheiten: Erstens ist der „Beistand“ nicht eindeutig qualifiziert, muss also nicht unbedingt militärischer Art sein. Und zweitens lässt diese Formulierung mindestens offen, ob diese Beistandsklausel auch dann verbindlich ist, wenn der Angriff nicht auf die Territorien der NATO-Staaten stattfindet, sondern auf die Truppen der Truppenstellerstaaten in der Ukraine. Geht man vom klassischen territorialgebundenen Verteidigungsbegriff, der auch mit der Formulierung „nordatlantisches Gebiet“ – mithin NATO-Territorium – gemeint ist, aus, so würde ein Angriff auf deutsche oder französische Truppen in der Ukraine nicht den Verteidigungsfall gemäß Artikel 5 bedeuten. Selbst, wenn sich die Kampfhandlungen auf polnisches Gebiet oder anderer NATO-Staaten ausdehnen sollten, ist nicht unbedingt ein Beistandsautomatismus gewährleistet. Stellt Polen selbst Truppen in der Ukraine oder nicht, ist eine entscheidende Frage für den Fall, dass sich die Kämpfe auf polnisches Staatsgebiet ausdehnten? Wären angesichts der Kämpfe in der Ukraine zwischen westlichen und russischen Truppen russische Luftschläge gegen Einrichtungen der Truppenstellerstaaten, beispielsweise in Frankreich oder Deutschland, hinreichend für den Bündnisfall? Es müsste geklärt werden, ob diese Luftschläge aktiv (zur Zerstörung von Kommunikations- und Kommandoeinrichtungen oder Nachschub- und Transportlinien – Stichwort „Drehscheibe Deutschland“) oder reaktiv (westliche Truppen greifen zuerst russisches Territorium während der Kampfhandlungen in der Ukraine an, beispielsweise mit Taurus-Marschflugkörpern, um dortige Einrichtungen zu zerstören), stattfanden. Die Frage, wer wen zuerst angreift und wer sich verteidigt, ist angesichts der wachsenden Konfliktkomplexität dann nicht mehr so einfach zu klären – trotz Rückgriff auf die „Definition der Aggression“, die 1974 in einer Resolution der UN-Generalversammlung (A/RES/3314 (XXIX) vom 14 Dezember 1974) fixiert wurde. Und sind die beteiligten Entscheidungsträger angesichts der Faktoren Zeitdruck, maximale Stresssituation und Emotionalität überhaupt in der Lage, eine adäquate rechtliche Beurteilung vorzunehmen?
Diese Fragen müssten anhand vorheriger Szenarien, die in der Natur der Sache liegend, nie abschließend sein können, geklärt werden. Nicht zuletzt bliebe offen, ob jenseits der rechtlichen Ebene – Bündnisfall ja oder nein – die Trump-Administration auch politisch bis zum äußersten – mithin Griff zur Atombombe – willens wäre, eine rechtliche Verpflichtung auch militärisch umzusetzen. Denn, warum sollte D. Trump die europäischen NATO-Staaten, die seine Friedensinitiative nur halbherzig unterstützt, oder gar mit der Entsendung von Interventionstruppen unterlaufen hätten, dann tatsächlich militärische Hilfe zuteilwerden lassen? Insgesamt zeigt sich, dass die in Artikel 5 des NATO-Statuts` formulierten Bedingungen sowie die daraus resultierenden Verpflichtungen alles andere als so eindeutig anwendbar in einem so komplexen Konfliktgefüge sind, so dass sie der Trump-Administration eine gute Möglichkeit böte, sich aus dem Abenteuer rauszuhalten.
Exkurs Ende
In beiden Fällen (nicht-akzeptierte „Friedenstruppen“ oder Interventionstruppen) bedeuten diese möglichen Kampfhandlungen einen Krieg zwischen einzelnen NATO-Mitgliedsstaaten und Russland, ohne dass Artikel 5 wirklich garantiert ist. Wenn also die potentiellen europäischen Truppenstellerstaaten der Auffassung sein sollten, Artikel 5 wäre eine sichere Rückfalllinie und das somit die Risiken für die Truppenstellerstaaten überschaubar seien, soll heißen, die USA würden rettend eingreifen, so ist das ein eklatanter Trugschluss. Denn weder rechtlich, noch politisch ist ein US-amerikanischer Beistand gesichert. Diese Fehlperzeption könnte für die EU-Europäer und letztlich für Gesamteuropa zum Desaster mutieren. Ein auf Europa „begrenzter“ Nuklearkrieg würde die weitere Diskussion über die weltpolitische Rolle EU-Europas wohl irrelevant machen. Und selbst, wenn die USA zu Gunsten der europäischen Truppenstellerstaaten eingriffen, so wüchse die Gefahr einer nuklearen Eskalation exponentiell an. Dass dieses Armageddon einträte, ist meines Erachtens wahrscheinlicher als das es nicht einträte – siehe auch den Beitrag zu aktualisierten Nukleardoktrin der Russischen Föderation.
Wahrscheinlichkeit: Sollte Washington einer militärischen Option – seien es europäische „Friedenstruppen“, seien es Interventionstruppen – keine klare Absage erteilen, könnten sich E. Macron, K. Starmer und ggf. auch F. Merz zu einem unbedachten Abenteuer hinreißen lassen, in dem Glauben, die Russen würden ihre in der Ukraine zu stationierenden Truppen letztlich doch nicht angreifen. Ob dieses Szenario eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich ist, hängt auch einerseits von der US-Administration ab, andererseits aber auch von den Gesellschaften in Europa. D.h., werden die Menschen aufwachen und ein Ende derart gefährlicher Sandkastenspielchen mit potentiell nuklearem Ausgang fordern oder folgen uninteressiert an der politischen Lage ihren schlafwandlerischen politischen Eliten und Mainstreammedien?
Fazit
Die dargestellten sechs Szenarien sind, wie bereits ausgeführt, weder absolut so zu sehen, noch alternativlos, da die Wirklichkeit viel komplexer ist, als dass sie durch Szenarien adäquat erfasst werden könnte. Die Szenarien sind jedoch Ausdruck möglicher Entwicklungen auf der Grundlage der gegenwärtigen von mir erfassten Faktenlage. Und die Faktenlage sieht zumindest für EU-Europa, was die Anpassungsfähigkeit an die realpolitischen Entwicklungen betrifft, nicht wirklich gut aus. EU-Europa droht, sofern es seinen Binnenzerfall noch abzuwenden vermag, nur noch in der zweiten weltpolitischen Liga zu spielen. Dass heißt auch, dass die Großmächte der ersten Liga die neuen Spielregeln der künftigen Weltordnung im Wesentlichen bestimmen werden. Der alte Kontinent, über Jahrhunderte das Zentrum der Weltpolitik, würde in die Peripherie rutschen.
Titelbild: Shutterstock / Shutter SV











:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ca/1dca419c2658da8653ccda9dcd7fa458/0123877365v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/48/f7/48f78b959c3f62d59ef36983c5c95d4f/0124034819v2.jpeg?#)