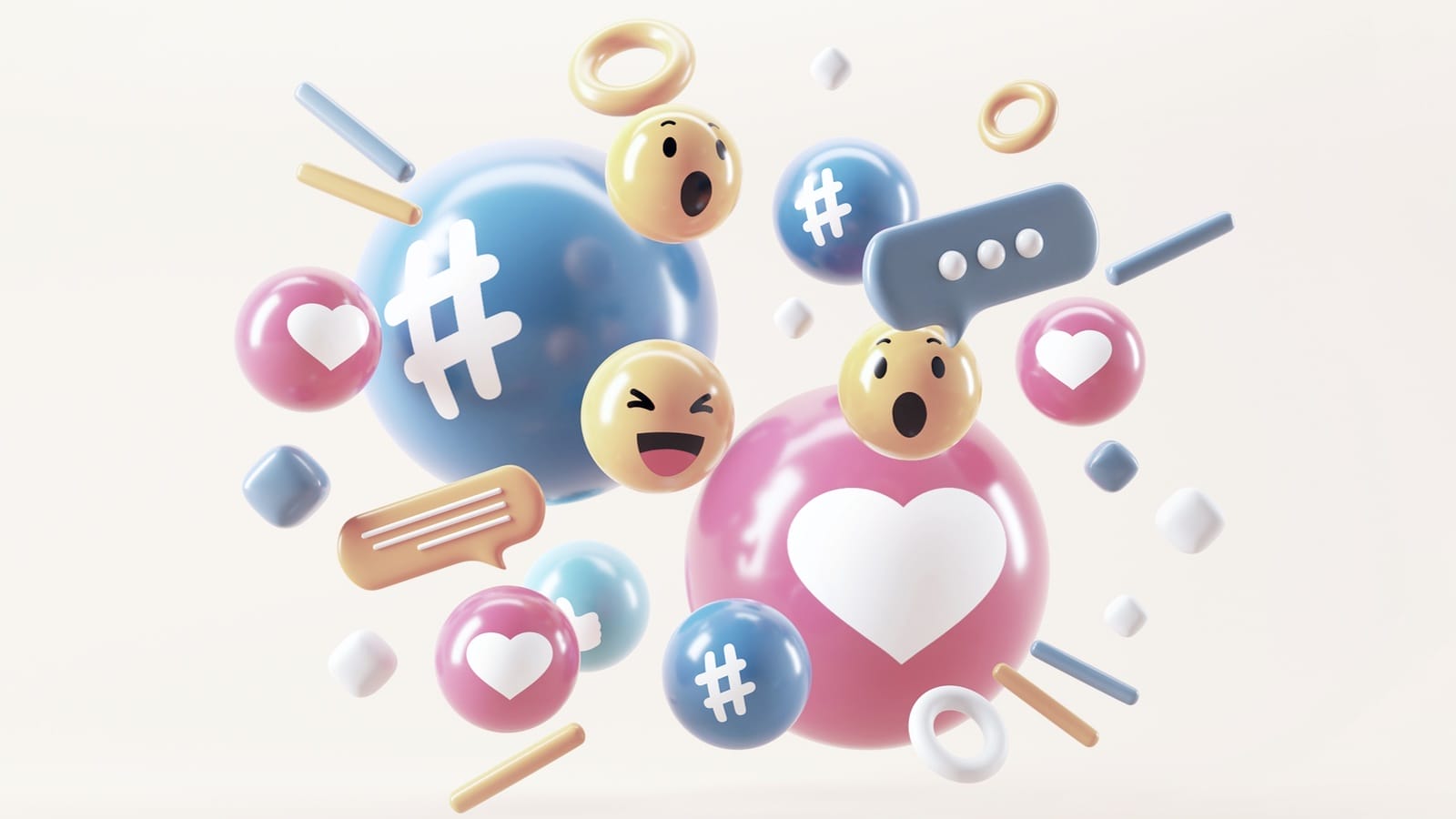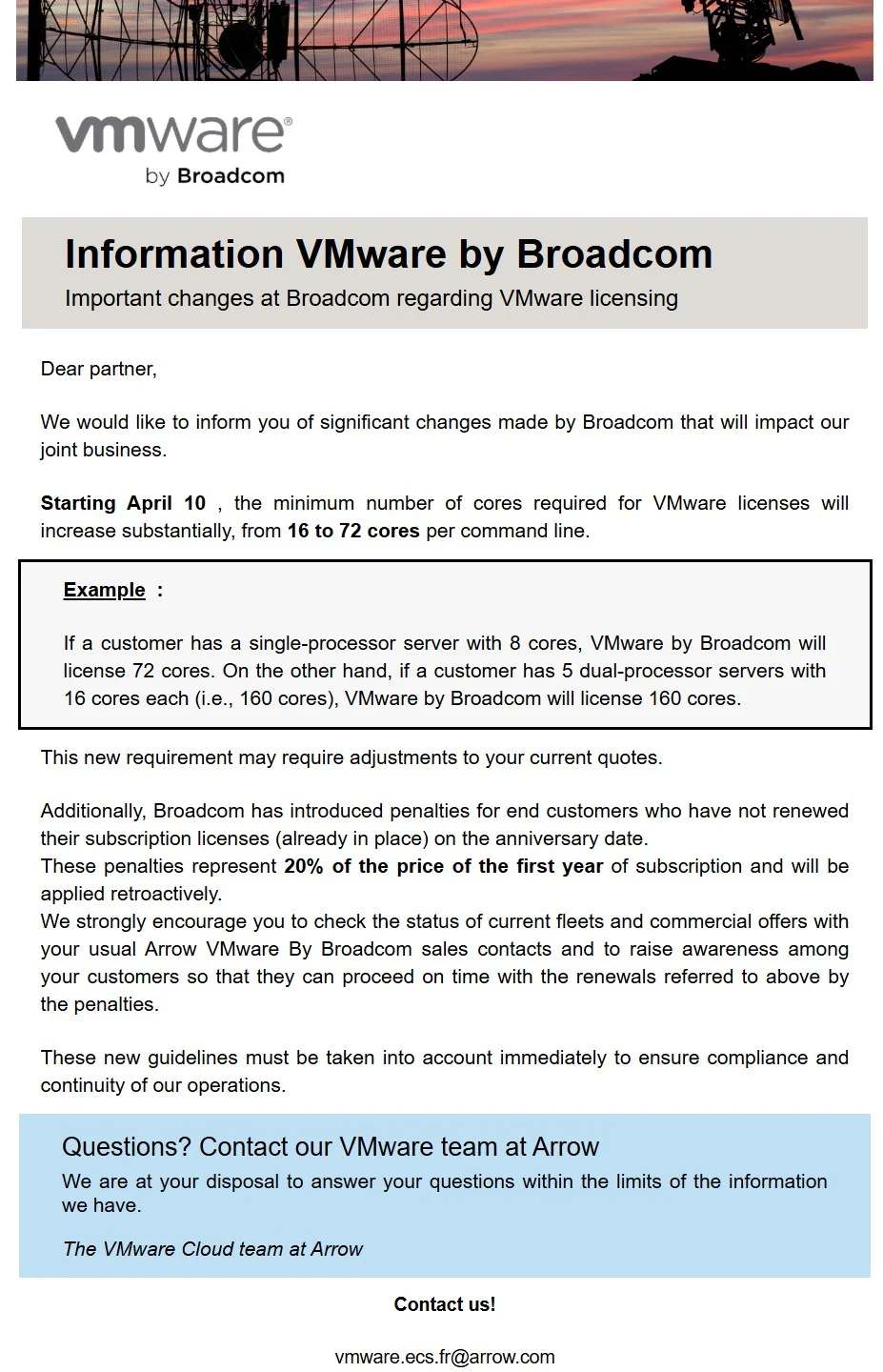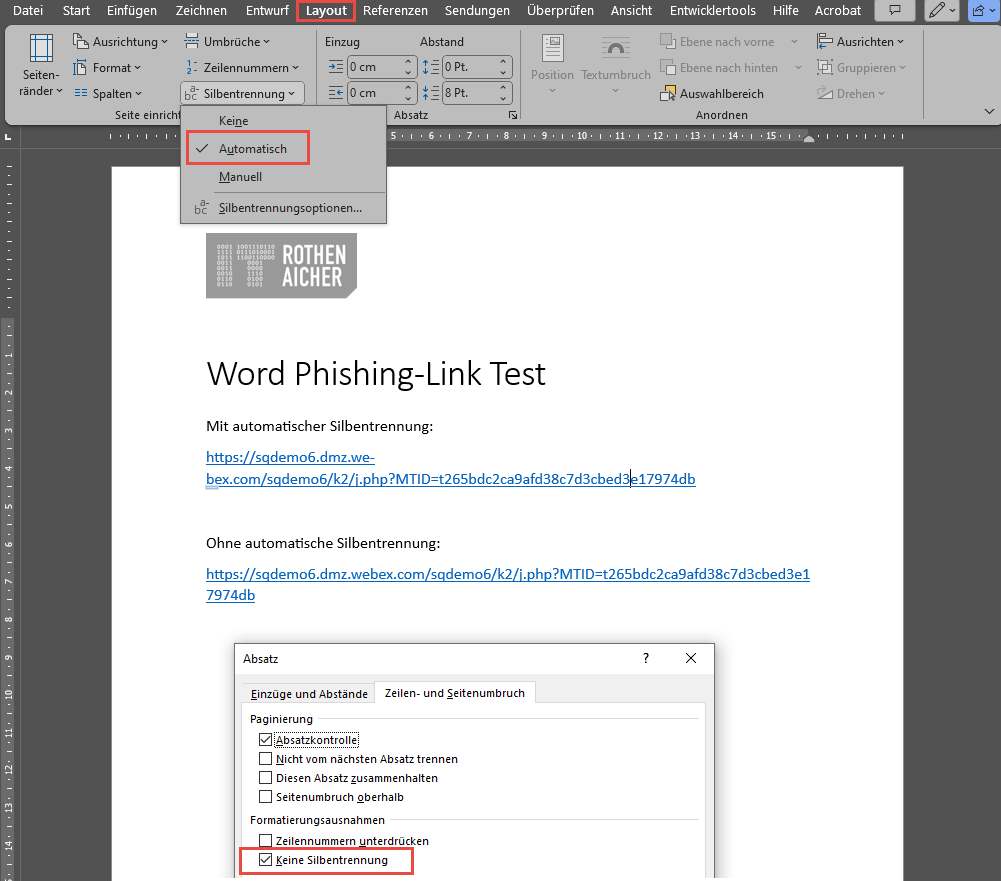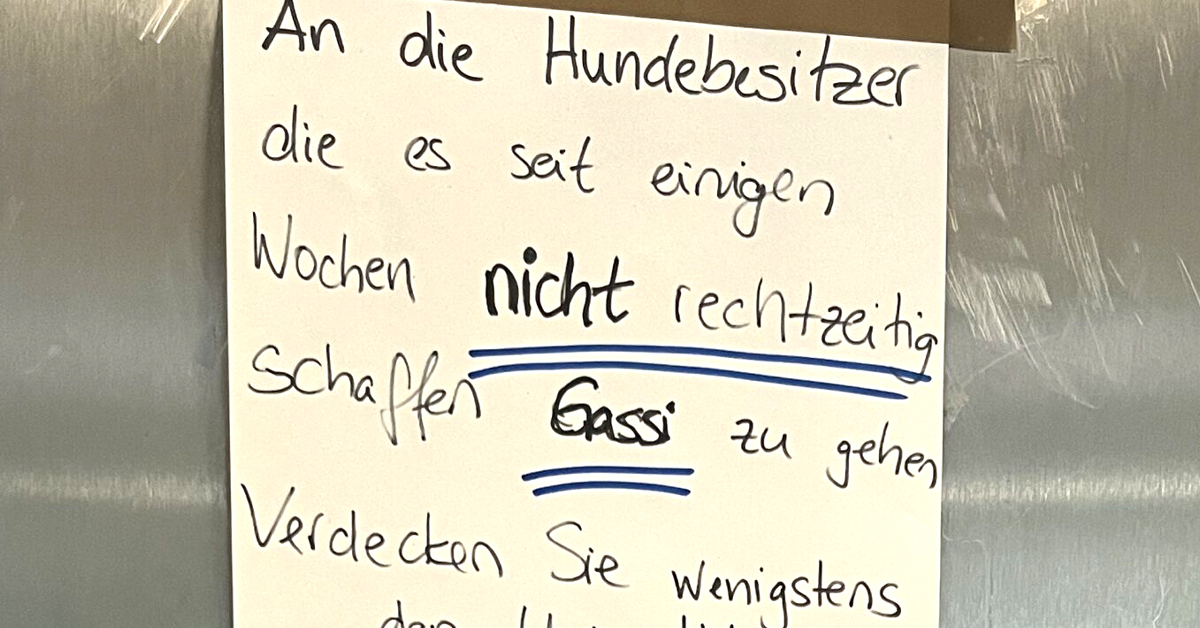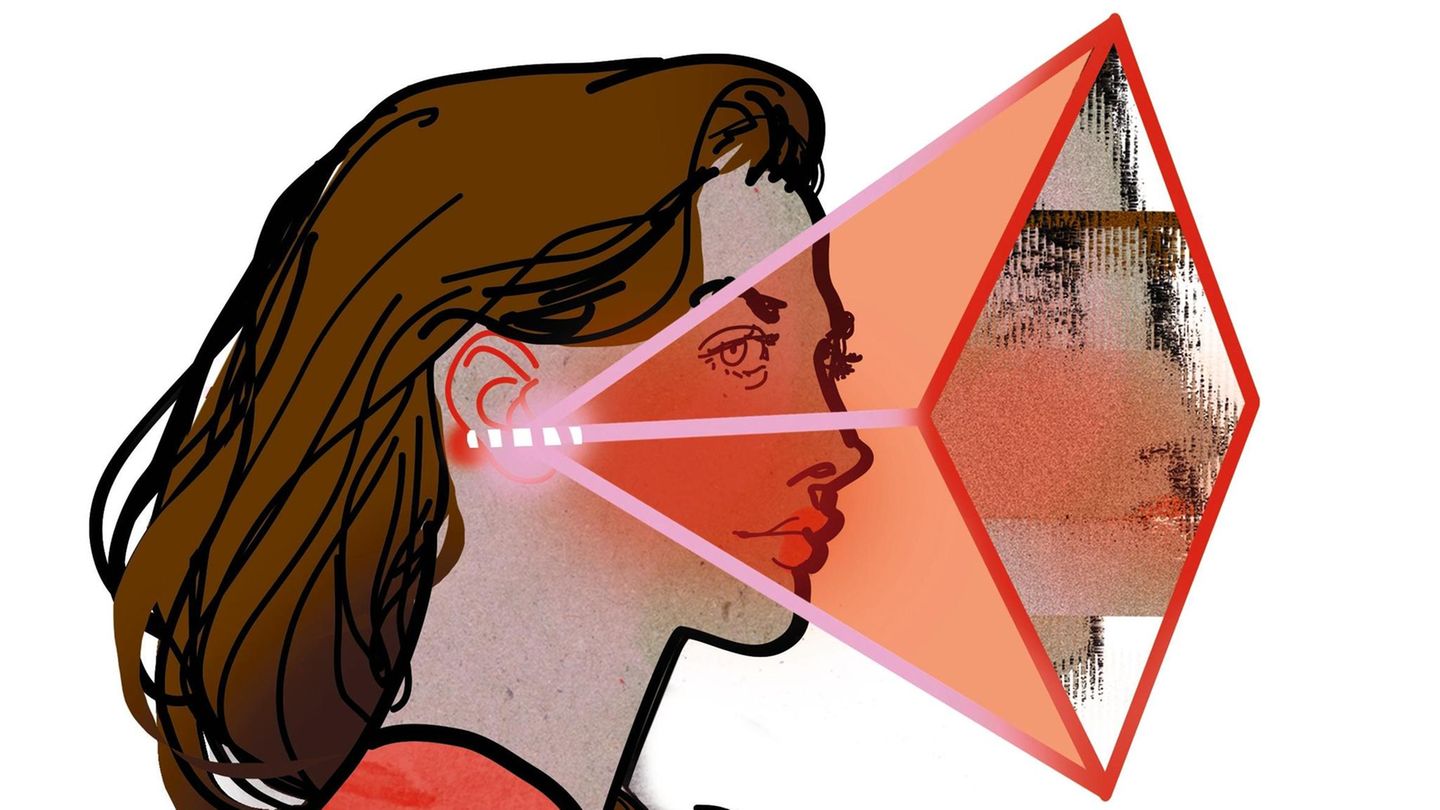Soli bleibt: Verfassungsrichter schmettern Klage gegen Solidaritätszuschlag ab
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Solidaritätszuschlag rechtens ist. Die künftige Bundesregierung kann aufatmen – sie muss nun keine neuen Milliardenlöcher stopfen

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Solidaritätszuschlag rechtens ist. Die künftige Bundesregierung kann aufatmen – sie muss nun keine neuen Milliardenlöcher stopfen
Der Solidaritätszuschlag ist verfassungsgemäß. Dieses Urteil verkündete am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht. Damit wies der Zweite Senat die Verfassungsbeschwerden von ehemaligen FDP-Bundestagsabgeordneten zurück (Az. 2 BvR 1505/20).
Allerdings betonten die Richterinnen und Richter auch, dass eine solche Ergänzungsabgabe nicht zeitlich unbegrenzt erhoben werden dürfe. Den Gesetzgeber treffe eine „Beobachtungsobliegenheit“. Eine solche Abgabe könnte verfassungswidrig werden, sobald der zuvor festgestellte Mehrbedarf wegfällt.
Bislang zahlen nur noch Unternehmen und Gutverdienende den Soli. Wäre er weggefallen, hätten dem Bundeshaushalt jährlich mindestens rund 12 bis 13 Mrd. Euro gefehlt. Die künftige Bundesregierung um den designierten Kanzler Friedrich Merz (CDU) dürfte das Urteil begrüßen. Sie muss ihre Finanzplanung nun nicht komplett überarbeiten.
Was ist jetzt mit dem Soli?
Die Debatte um den Soli dürfte trotz Urteil aus Karlsruhe weitergehen: Stefan Bach, Steuerexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), fordert eine Umwandlung des Solis. „Der Solidaritätszuschlag könnte als ,Wehrbeitrag' zur Finanzierung der hohen Verteidigungsausgaben umgestaltet werden“, so Bach. Die Freigrenze könne in einen echten Freibetrag umgewandelt und der Satz auf acht Prozent erhöht werden. Dies würde Steuerpflichtige bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 178.000 Euro entlasten, rechnet Bach vor, Spitzenverdienende aber stärker belasten. Dieser Soli 2.0 würde knapp 10 Mrd. Euro im Jahr bringen. Über zehn Jahre gerechnet wären das knapp 100 Mrd. Euro, mit denen die Rüstungskosten finanziert werden könnten. Gleichzeitig solle der Spitzen- und Reichensteuersatz bei der Einkommensteuer erhöht werden – auf 44,3 Prozent und 47,5 Prozent.
Julia Jirmann, Wirtschaftsjuristin beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, begrüßt das Urteil. „Dass der Soli heute nur noch für Spitzenverdiener gilt, macht ihn nicht weniger legitim – im Gegenteil: Er ist heute dringender nötig und gerechter denn je“, so Jirmann. Die Politik habe bisher verschlafen, die Ergänzungsabgabe in den Steuertarif zu integrieren oder ersatzweise über eine Vermögensteuer für einen Ausgleich zu sorgen. „Während die breite Mitte der Gesellschaft rund die Hälfte ihres Arbeitseinkommens für Steuern und Abgaben aufbringen muss, zahlen Superreiche häufig nur 25 bis 30 Prozent.“ Wäre der Soli ersatzlos entfallen, hätte sich diese Gerechtigkeitslücke laut Jirmann noch weiter geöffnet.
Was ist der Solidaritätszuschlag überhaupt? Einfach erklärt
Der Solidaritätszuschlag, kurz Soli, wurde 1991 zunächst als befristete Abgabe eingeführt und 1995 dauerhaft etabliert. Ziel war es, die Kosten für den wirtschaftlichen Aufbau der ostdeutschen Bundesländer zu decken. Ursprünglich lag der Zuschlag bei 7,5 Prozent auf Lohn-, Einkommen-, Kapitalertrags- und Körperschaftsteuer, seit 1998 beträgt der Satz 5,5 Prozent. Der Soli gilt bundesweit, seine Einnahmen fließen ausschließlich in den Bundeshaushalt und sind nicht an bestimmte Zwecke gebunden.
Wer zahlt den Soli noch?
Nach dem Ende des Solidarpakts 2019 wurde der Solidaritätszuschlag für einen Großteil der Bevölkerung abgeschafft. Die damalige Große Koalition aus Union und SPD einigte sich 2021 darauf, die Freigrenzen deutlich anzuheben, sodass heute rund 90 Prozent der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen von der Abgabe befreit sind. Unternehmen und Spitzenverdiener zahlen ihn jedoch weiterhin.
Seitdem wurden die Freigrenzen regelmäßig angepasst. 2024 musste ein Alleinstehender mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen ab etwa 104.000 Euro den vollen Satz entrichten. Auch Kapitalerträge wie Dividenden unterliegen nach wie vor dem Soli.
Wer hat sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt – und warum?
Sechs Bundestagsabgeordnete der FDP, die sich damals in der Opposition befanden, legten 2020 Verfassungsbeschwerde gegen den Soli ein. Ihr Kernargument: Die Abgabe sei nach dem Ende des Solidarpakts nicht mehr verfassungsgemäß und müsse für alle Steuerzahlenden abgeschafft werden.
Nach ihrer Auffassung hätte der Soli mit dem Ende des Solidarpakts vollständig entfallen müssen, da er ursprünglich der Finanzierung der Wiedervereinigung diente. Sie kritisieren zudem, dass nur noch eine bestimmte Gruppe zur Kasse gebeten wird, und sehen darin eine Verletzung des Eigentumsrechts.
Gab es bereits ein Gerichtsurteil zum Soli?
Ja, eine Entscheidung traf bereits der Bundesfinanzhof in München. Im Januar 2023 wies das oberste deutsche Finanzgericht eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag ab. Geklagt hatte ein Ehepaar aus Bayern mit Unterstützung des Bundes der Steuerzahler, das sich gegen die Zahlung des Solis für die Jahre 2020 und 2021 wehrte. Das Gericht entschied jedoch, dass die Erhebung weiterhin zulässig sei.
Wie lief die Verhandlung in Karlsruhe?
Die Bundesregierung verteidigte vor dem Verfassungsgericht die Fortführung des Solis. Sie argumentierte, dass die finanziellen Herausforderungen der Wiedervereinigung noch nicht vollständig bewältigt seien. Vertreter von SPD und Grünen betonten zudem, dass es wirtschaftspolitisch sinnvoll sei, nur einkommensstarke Gruppen zur Zahlung heranzuziehen.
Grundsätzlich darf eine Ergänzungsabgabe wie der Soli nur erhoben werden, wenn ein besonderer Finanzbedarf des Bundes besteht. In Karlsruhe drehte sich die Debatte daher um die Frage, ob die Erhebung auch dann noch zulässig ist, wenn der ursprüngliche Zweck entfällt, der Staat aber weiterhin hohe Ausgaben hat. Steuerrechtsexperten lieferten hierzu unterschiedliche Einschätzungen.
Welche finanziellen Folgen hätten gedroht?
Hätte das Bundesverfassungsgericht der Beschwerde stattgeben – und somit der Soli ganz abgeschafft werden müssen – wären dem Bund 12 bis 13 Mrd. Euro an jährlichen Einnahmen entgangen. Für die kommende Bundesregierung um den designierten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wäre das aber nicht einmal das schlimmste Szenario gewesen.
Die Richterinnen und Richter hätten auch entscheiden können, dass bereits gezahlte Beiträge an die Steuerzahler zurückerstattet werden müssen. In diesem Fall hätten sich die Kosten für den Staat auf noch einmal 65 Mrd. Euro belaufen. Um dieses Finanzloch zu schließen, hätten dann wohl andere Einnahmequellen gefunden werden müssen. Möglicherweise in Form höherer Steuern – für Bürgerinnen und Bürger wäre das keine gute Nachricht gewesen.
Was hätte das Soli-Aus für Unternehmen bedeutet?
Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags hätte die Wirtschaft deutlich entlastet. Unternehmen in Deutschland könnten knapp 65 Mrd. Euro einsparen, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bereits im November 2024 ermittelt hat. Die aktuelle Wirtschaftslage sei Grund genug, den Soli zu hinterfragen, sagte IW-Ökonom Tobias Hentze damals. „Vom Soli abzulassen, würde die Unternehmen endlich etwas entlasten und ihnen dringend benötigten Spielraum für neue Investitionen geben.“