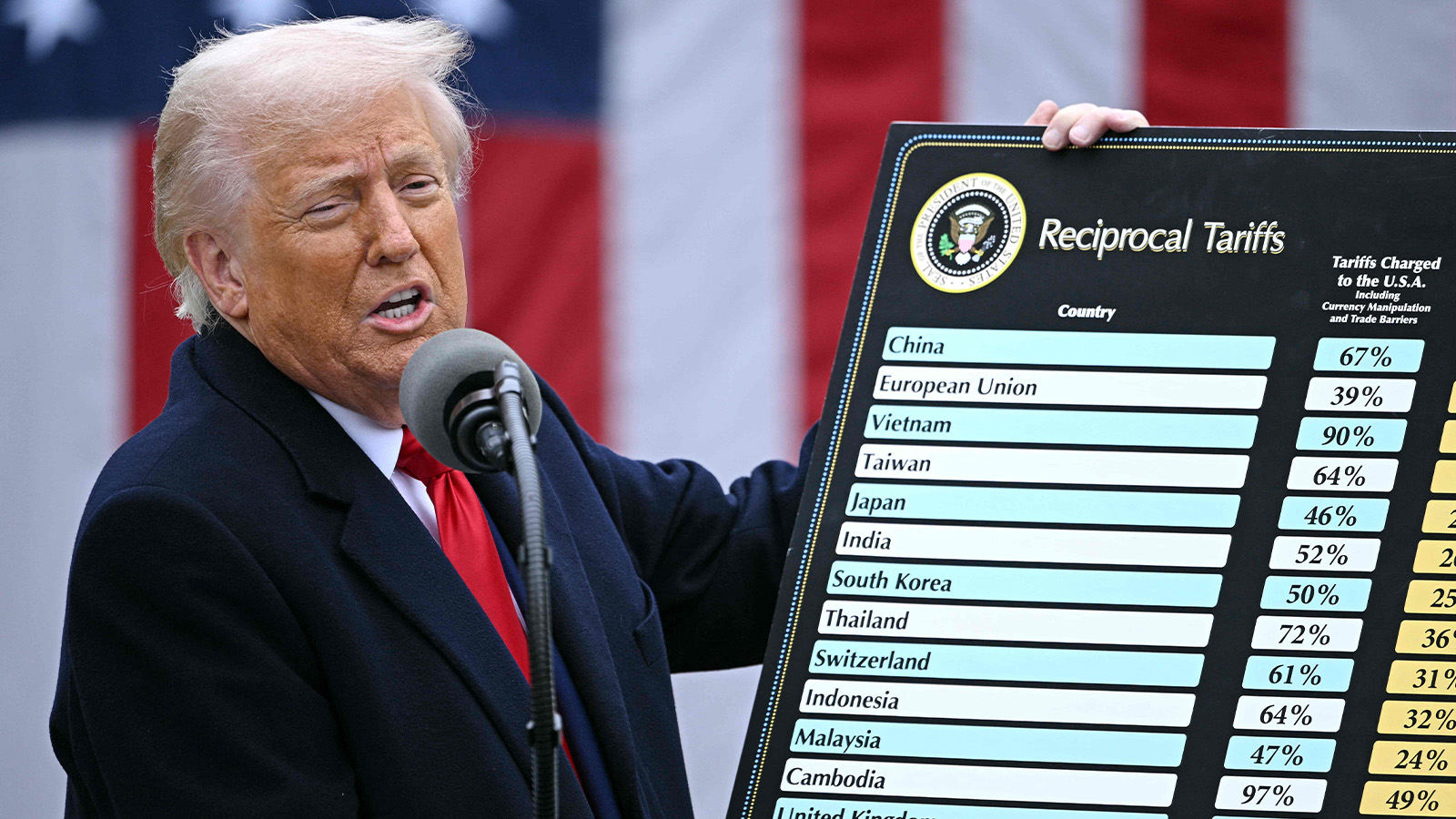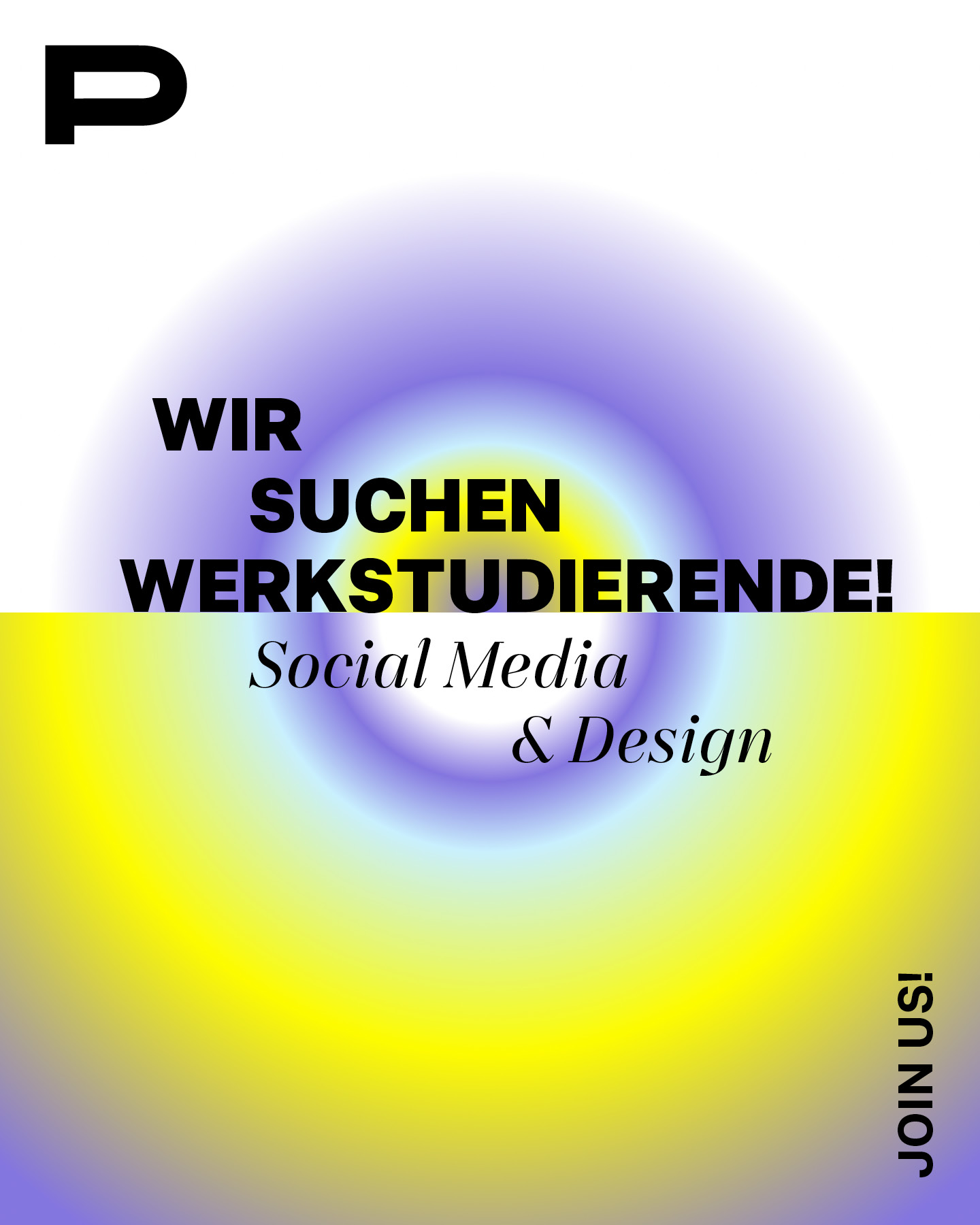Serien-Marathon: "Kognitive Fähigkeiten verkümmern allmählich"
"Nur noch eine Folge" – und plötzlich ist es drei Uhr morgens. Serien-Binge-Watching fühlt sich wie harmloser Spaß an, doch es macht etwas mit dem Gehirn.

"Nur noch eine Folge" – und plötzlich ist es drei Uhr morgens. Serien-Binge-Watching fühlt sich wie harmloser Spaß an, doch es macht etwas mit dem Gehirn.
Die Augen brennen, der Nacken ist steif, das Sofa hat längst die eigene Körperform angenommen – aber nur noch eine Folge. Und dann noch eine. Vielleicht noch die nächste. Wer einmal in den Sog einer Serie geraten ist, kennt das Gefühl: Der "Nächste Episode"-Button ist eine Einladung, der man schwer widerstehen kann. Doch was passiert eigentlich im Kopf, wenn wir uns stundenlang von einer fiktiven Welt verschlucken lassen?
Binge-Watching: die Endlosschleife im Gehirn
Unser Gehirn liebt Geschichten. Sie sind der Zucker für unsere Vorstellungskraft, der Treibstoff für Emotionen. Jedes Mal, wenn eine spannende Szene über den Bildschirm flimmert, schüttet unser Körper Dopamin aus – einen Botenstoff, der uns belohnt und sagt: "Mehr davon!" Doch während ein guter Film oder eine einzelne Folge wie ein Genussmittel wirken können, verwandelt sich ein Marathon aus Episoden schnell in eine Art geistige Dauerdusche, die unser Belohnungssystem überfordert.
Christine Geschke, Psychologin aus Hamburg, warnt: "Das Gehirn ist durch die Vielzahl an visuellen Reizen und das ständige Flimmern einer hohen Belastung ausgesetzt und muss diese Impulse verarbeiten. Doch abgesehen von diesem Stress erhält es keine wirkliche Anregung. Es besteht die Gefahr, dass die kognitiven Fähigkeiten allmählich verkümmern."
Bei sogenannten "Trash-TV-Formaten" müsse der Zuschauer gar nicht mehr wirklich nachdenken, da die aufgenommenen Informationen oberflächlich blieben und die intellektuellen Fähigkeiten kaum herausforderten.
Unsere Konzentration leidet, weil unser Kopf sich an schnelle Reize gewöhnt. Dialoge, Schnitte, Cliffhanger – alles passiert in Minuten, während das echte Leben viel langsamer läuft. Das Problem: Unser Gehirn passt sich an. Plötzlich erscheinen normale Gespräche langatmig, Arbeit wird zäh, der Alltag zieht sich wie Kaugummi. "Alles, was nicht regelmäßig genutzt wird, verkümmert mit der Zeit", sagt Geschke. Aber kann jeder in den Sog der Serien geraten?
Wer fällt in die Serienfalle?
Nein, nicht jeder wird zum Serienjunkie. Besonders Menschen, die akutem Stress entkommen wollen oder sich einsam fühlen, sind anfällig. Wer nach einem langen Arbeitstag Erholung sucht, findet in der fesselnden Story einen Zufluchtsort. Das ist verständlich – aber gefährlich. Denn statt sich aktiv zu erholen, verfallen wir in eine passive Betäubung. Auch Perfektionisten, die sich schwertun, den Tag "auszuknipsen", finden in der Flucht in fremde Geschichten eine verlockende Pause von sich selbst – mit negativen Folgen.
Ein paar Stunden Serien? Kein Problem. Aber wer regelmäßig ganze Nächte durchschaut, riskiert mehr als nur Augenringe. Schlafstörungen sind eine häufige Folge, denn das blaue Bildschirmlicht unterdrückt das Schlafhormon Melatonin. Das Gehirn bleibt im Wachmodus, selbst wenn die Augen längst zufallen.
Das Risiko: ein Leben auf Pause
Auch die Gedächtnisleistung kann leiden. Wer ständig von Folge zu Folge springt, trainiert das Gehirn auf oberflächliche Informationsverarbeitung. Inhalte werden aufgenommen, aber nicht richtig verarbeitet oder gespeichert – ähnlich wie bei endlosem Social-Media-Scrollen.
Dazu kommt das soziale Leben. Wenn aus einem "Heute bleibe ich mal daheim" ein Dauerzustand wird, verkümmert unser Bedürfnis nach echter Interaktion. Gespräche mit Freunden erfordern mehr Mühe als das passive Konsumieren einer Serie – und wenn das Gehirn sich an den leichten Weg gewöhnt, kann selbst eine Verabredung anstrengend wirken.
Die Psychologin warnt deshalb: "Serien-Sucht kann zu sozialer Isolation, körperlichen Beschwerden wie Rückenschmerzen und Schlafstörungen sowie psychischen Problemen führen. Der übermäßige Konsum verdrängt oft reale Probleme und senkt die Produktivität." Und wie rettet man sich aus der ungesunden Routine?
So kommt man aus der Binge-Falle
Der erste Schritt: Bewusstsein. Wer merkt, dass Serien mehr Kontrolle über einen selbst haben als umgekehrt, kann gegensteuern. Kleine Tricks helfen: eine Folge bewusst stoppen, bevor der Cliffhanger zuschlägt, den Fernseher nicht im Schlafzimmer stehen haben, einen Wecker stellen, der ans Ausschalten erinnert.
Noch besser: Die Dopamin-Kicks durch echte Erlebnisse ersetzen. Ein Spaziergang kann eine Serie nicht ersetzen, aber er gibt dem Gehirn wieder die Chance, sich an langsamere, echte Reize zu gewöhnen. Lesen, Sport, kreative Hobbys – all das trainiert unsere Aufmerksamkeit wieder auf eine gesunde Art. Das Schauen von Serien ist natürlich kein Tabu, einige Formate können sogar förderlich für die Zuschauer sein.
Serien können auch guttun
Anspruchsvolle Formate können einen positiven Effekt haben, so die Expertin. "Bei Reisedokumentationen kann man richtig was lernen, über fremde Länder, über fremde Kulturen. Es gibt so viele spannende Themen, wie Kunst und andere kulturelle Aspekte, die wertvolle Einblicke vermitteln", sagt Geschke.
Die Psychologin betont, dass es grundsätzlich in Ordnung sei, Serien zu schauen, solange es zu keiner festen Routine werde. Besonders in einer schnelllebigen und stressigen Zeit, in der den Menschen viel abverlangt werde, könne der Konsum von Unterhaltung als eine Möglichkeit der Ablenkung und des Stressabbaus dienen.
Am Ende ist es wie mit gutem Essen: Eine Serie in Maßen zu genießen, kann ein Genuss sein. Doch wer sich ausschließlich von Fast-Food-Entertainment ernährt, darf sich nicht wundern, wenn der Kopf irgendwann müde und reizüberflutet ist. Also: eine Folge weniger – und vielleicht stattdessen eine echte Geschichte erleben.
















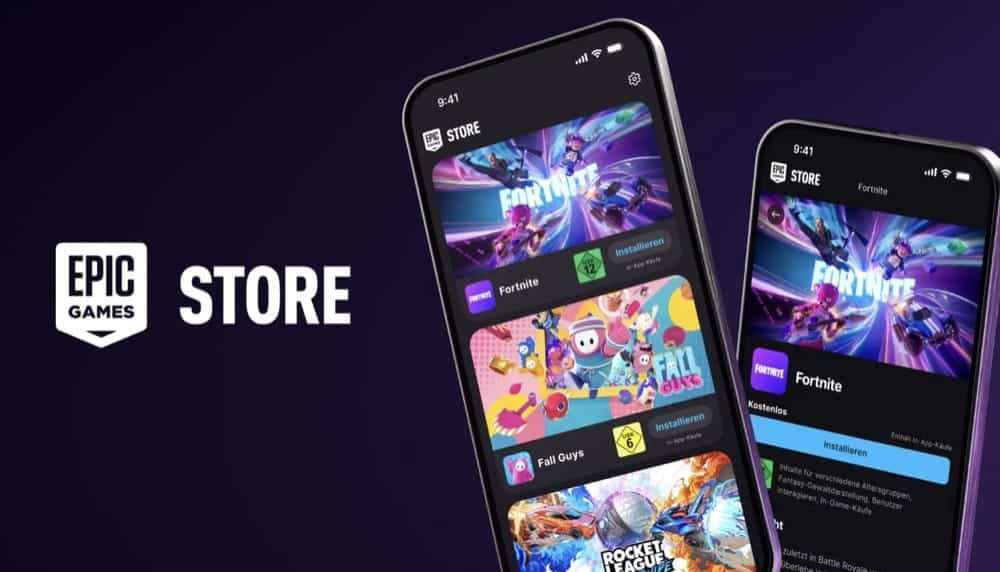

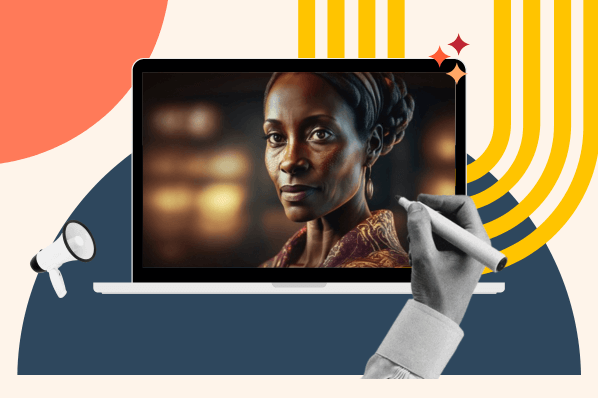


:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/f8/a8f839b6d6fc54f14228abb8e4984e8c/0123871625v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/47/ff4790ee0143a184bb372666e5945ef0/0123507403v1.jpeg?#)