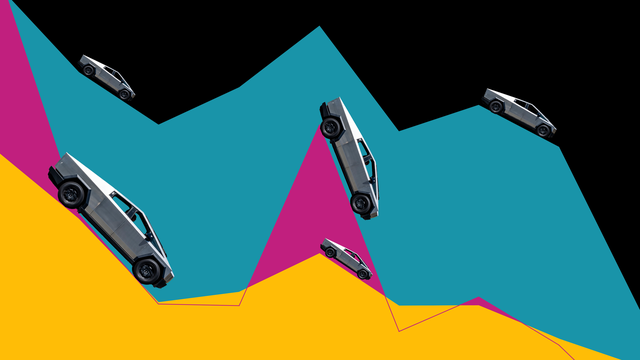Mittelstand: Baby-One-Chefin Weber: „Das Schlimmste ist so eine Harmonie-Decke“
Im Podcast „Alles neu...? Aus dem Maschinenraum” spricht die Baby-One-Chefin Anna Weber über das Führungstandem mit ihrem Bruder, warum sie ein Fan von Konflikten ist und wieso sie zu viel Homeoffice für schädlich hält

Im Podcast „Alles neu...? Aus dem Maschinenraum” spricht die Baby-One-Chefin Anna Weber über das Führungstandem mit ihrem Bruder, warum sie ein Fan von Konflikten ist und wieso sie zu viel Homeoffice für schädlich hält
Die Geschwister Anna Weber und Jan Weischer führen Deutschlands größte Babymarktkette Baby One. Das Münsteraner Familienunternehmen haben ihre Eltern aufgebaut. Heute verteilen sich 100 Fachmärkte über das ganze Land, Baby One beschäftigt rund 1400 Menschen und hat 2023 mehr als 240 Mio. Euro umgesetzt.
Capital: Frau Weber, Sie waren Managerin bei Vodafone, bevor Sie gemeinsam mit Ihrem Bruder Baby One von Ihren Eltern übernommen haben. Wie kam es dazu?
ANNA WEBER: Es war eine schleichende Entscheidung, wir sind beide erst einmal eigene Wege gegangen. Das Familienunternehmen war zwar im Hinterkopf, aber nie wirklich eine Option. Als mein erster Sohn geboren wurde, habe ich überlegt: Was will ich mit meinem Leben machen? Welche Fußspuren will ich einmal hinterlassen? Meinem Bruder Jan, der auch gerade Vater geworden war, ging es ähnlich. Wir sind unabhängig voneinander auf unsere Eltern zugegangen und haben einen Prozess vollzogen, der ungefähr anderthalb Jahre gedauert hat, bis wir eingestiegen sind.
Wie war dieser Prozess gestaltet?
Wir haben uns von einem Coach beraten lassen und überlegt: Was wäre ein guter Weg ins Unternehmen? Wir haben viel Zeit aufgewendet, einen Plan zu entwickeln, damit wir nicht sofort die Chefs sind, wenn wir einsteigen, aber mit der Erfahrung, die wir schon hatten, auch nicht bei null anfangen und noch mal Azubis sind. Wir haben festgelegt, dass mein Bruder und ich drei Jahre lang mit unseren Eltern zusammenarbeiten, und wann der richtige Zeitpunkt ist, dass Jan und ich als Geschäftsführer ernannt werden und unsere Eltern ausscheiden.
Sie sind 18 Monate älter als Ihr Bruder. Große Schwester, kleiner Bruder – in jeder Familie gibt es Rollenkonstellationen. Schaffen Sie es, diese im Unternehmen abzulegen?
Ich glaube, dass jeder, der sagt, dass er in der Firma komplett anders ist als in der Familie, lügt. Das macht ein Familienunternehmen aus, dass du etwas von dir selbst und deinen Beziehungen ins Unternehmen bringst. Wir haben gelernt, professionell zu agieren, aber ein paar Dinge bleiben einfach drin.
Zum Beispiel?
Ich bin organisierter als mein Bruder, sei es beim Planen von Geburtstagen oder in der Firma.
Sie sind heute beide CEOs von Baby One. Wie teilen Sie sich auf?
Ich bin derzeit zuständig für Personal, Marketing und unsere Eigenmarke. Mein Bruder macht IT, Data und den Einkauf. Christoph Semer, unser dritter, externer Geschäftsführer, kümmert sich um Vertrieb und Finanzen.
Wie funktioniert das gegenüber den Mitarbeitern? Nehmen sie die thematische Trennung an oder kommen da manche auch zu Ihnen oder Ihrem Bruder, weil sie die Hoffnung haben, dass sie bei einem von Ihnen weiterkommen als bei der anderen?
Sie meinen den Mama-Papa-Effekt? Nein. Ich finde, dass das super funktioniert. Auch unsere Eltern haben ja das Unternehmen zusammen geführt, und auch die hatten sich ihre Bereiche aufgeteilt. Das Wichtigste ist, dass wir die großen strategischen Entscheidungen gemeinsam treffen und mit einer Stimme ins Unternehmen gehen. Natürlich passiert es mal in der Hektik des Alltags, dass wir nicht hundertprozentig abgesprochen sind und dass es kleinere Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber ich denke, das ist absolut normal.
Sie und Ihr Bruder streiten also manchmal?
Auf jeden Fall. Und ich halte das auch für total wichtig und relevant. Das Schlimmste ist so eine Harmonie-Decke, unter der alles gehüllt ist, in der Familie und im Unternehmen. Ich bin ein großer Fan von Konflikten und davon, konstruktiv zu streiten.
Was haben Sie und Ihr Bruder im Unternehmen verändert, seitdem Sie es übernommen haben?
Was sich geändert hat, ist vor allen Dingen die Kultur. Das liegt aber nicht nur an meinem Bruder und mir. Ich bin jetzt knapp acht Jahren im Unternehmen. In dieser Zeit hat sich unsere Welt sehr gewandelt: Corona und Homeoffice, der russische Überfall in der Ukraine, die Energiekrise. All diese Veränderungen bedeuten ja auch eine kulturelle Änderung in den Unternehmen. Vielleicht ist das kleinste Beispiel bei Baby One die Duz- gegenüber der Siezkultur. Wir haben das Duzen eingeführt, an dem Tag als meine Eltern ausgeschieden sind. So lange hatten sie uns darum gebeten. Und das Thema flexibles Arbeiten ist natürlich, auch bedingt durch Corona, nochmal ganz anders aufgekommen, ebenso wie das Thema Transparenz.
Können Sie Beispiele nennen?
Wir haben komplett offene Kalender. Ich habe kein Problem damit, wenn da bei mir mal ein Elternsprechtag in der Schule drinsteht. Das gehört ja zum Leben dazu. Andersrum bedeutet es, wir können wirklich von jedem und jeder die allermeisten Termine sehen, damit Terminabsprachen einfacher werden. Allerdings überlegen wir, ob diese Transparenz immer förderlich ist und den Leuten hilft. Manchmal werden Dinge dadurch auch einfach komplexer. Wie viel Informationen machen dich vielleicht nur nervös oder unsicher? Da sind wir gerade in der Findungsphase.
Beim Thema Homeoffice sind Sie zurückgerudert. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und warum haben Sie die Leute zurück ins Büro geholt?
Nach Corona haben wir „Work from anywhere“ für unsere Zentrale ausgerufen. Das lief anderthalb Jahre. Dann haben wir, ich würde es eher nennen, die Regelung abgeschwächt und gesagt: Drei Tage Arbeit in Präsenz, zwei Tage sind von zu Hause möglich. Und übrigens gilt immer noch ein kompletter Monat im Jahr „Work from anywhere“. Warum haben wir das gemacht? Weil wir gemerkt haben, dass unsere Kultur total leidet, wenn die Menschen nicht hier vor Ort sind. Bei der kompletten „Work from anywhere“- Regelung haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen viel stärker die Möglichkeit gewählt, nicht hier zu sein. Irgendwann sind Einzelne auf uns zugekommen und haben mit uns gesprochen: Wir haben ja gar keine Kultur mehr, ich kenne die ganzen Leute nicht mehr. Unsere Azubis sind beim Einarbeiten nicht richtig reingekommen. Es gab sehr, sehr viele Absprachen, die viel längere Schleifen genommen haben. Deswegen haben wir uns entschieden zu sagen: Wir wollen wieder, dass ihr hier seid, mindestens drei Tage die Woche.
Wie kam das an?
Nicht so super ist ja klar. Die Leute fühlten sich zum Teil in ihrer Freiheit eingeschränkt. Ich glaube aber weiterhin daran, dass es uns als Unternehmen guttut. Man darf ja nicht vergessen: Die meisten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben überhaupt nicht die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Die stehen in unseren Filialen bis 19 Uhr abends. Wir haben gemerkt, dass diese Kluft zwischen Zentrale und Fachmärkten in den letzten Jahren immens gestiegen ist. Deshalb ist es für uns als stationäres Handelsunternehmen die richtigere Art und Weise zu sagen: Ein Teil der Arbeitszeit findet in Präsenz hier im Büro statt.
Hat sich die Unternehmenskultur seitdem verbessert?
Kultur ist sehr schwer zu messen, das ist bauchgefühlslastig. Ich habe das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Bei diesen ganzen Homeoffice-Diskussionen haben mein Bruder und ich lange diskutiert, dass es toll wäre, gar keine Regeln zu haben und nur eine Schar von intrinsisch motivierten Leuten, die das Beste geben wollen. So wie es Netflix-Gründer Reed Hastings in seinem Buch „No Rules Rules“ beschreibt. Das ist echt inspirierend. Aber wir haben gemerkt, dass es bei uns so leider nicht funktioniert.

















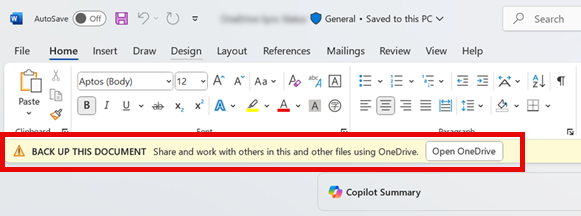
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8b/83/8b831e7ee5144419678a4ccb64a25668/0124252169v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7d/e9/7de9a309c98605ff6edea5151f61916e/0124302592v4.jpeg?#)

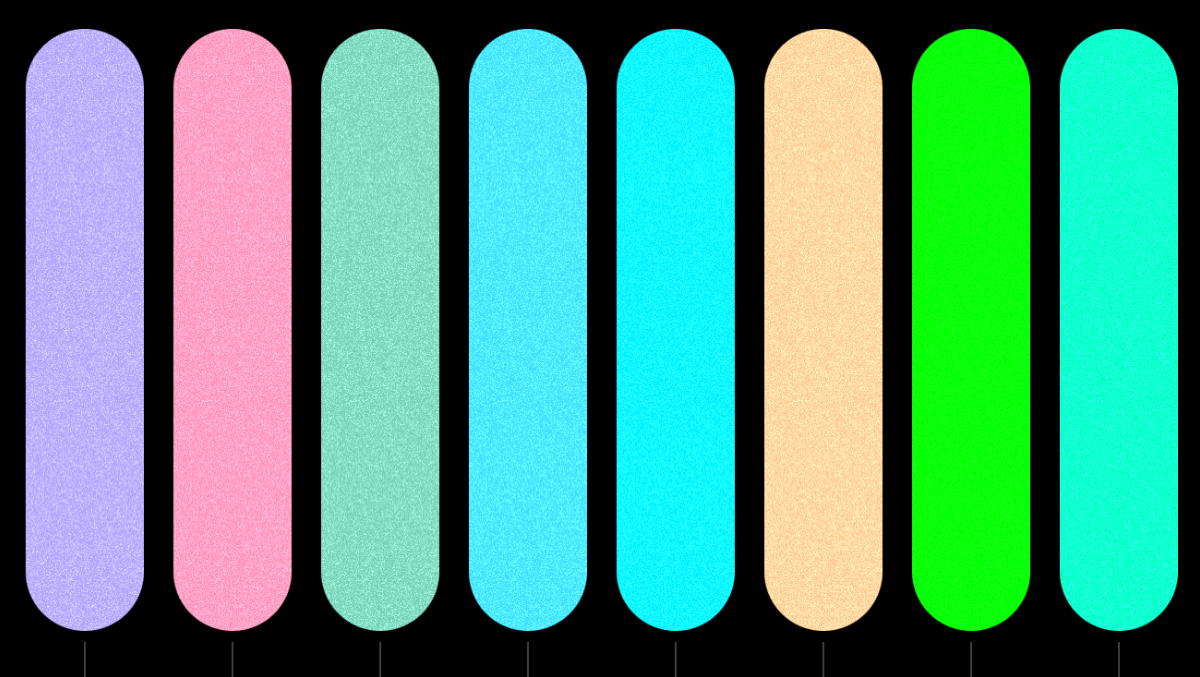


,regionOfInterest=(677,338)&hash=cc2d08e411ca756aea32ee659548a141930e5048f8a7d382f43b167228146dfd#)
,regionOfInterest=(783,360)&hash=12fe079e36c18ed5e790c55691c64106ce70642daf84b50edde961fad0cdbf8f#)
,regionOfInterest=(613,283)&hash=285a00084fc3ee0d1644ab92536fa71a0ab0a64de6b9dc5b4b6b87ab552ba5e4#)