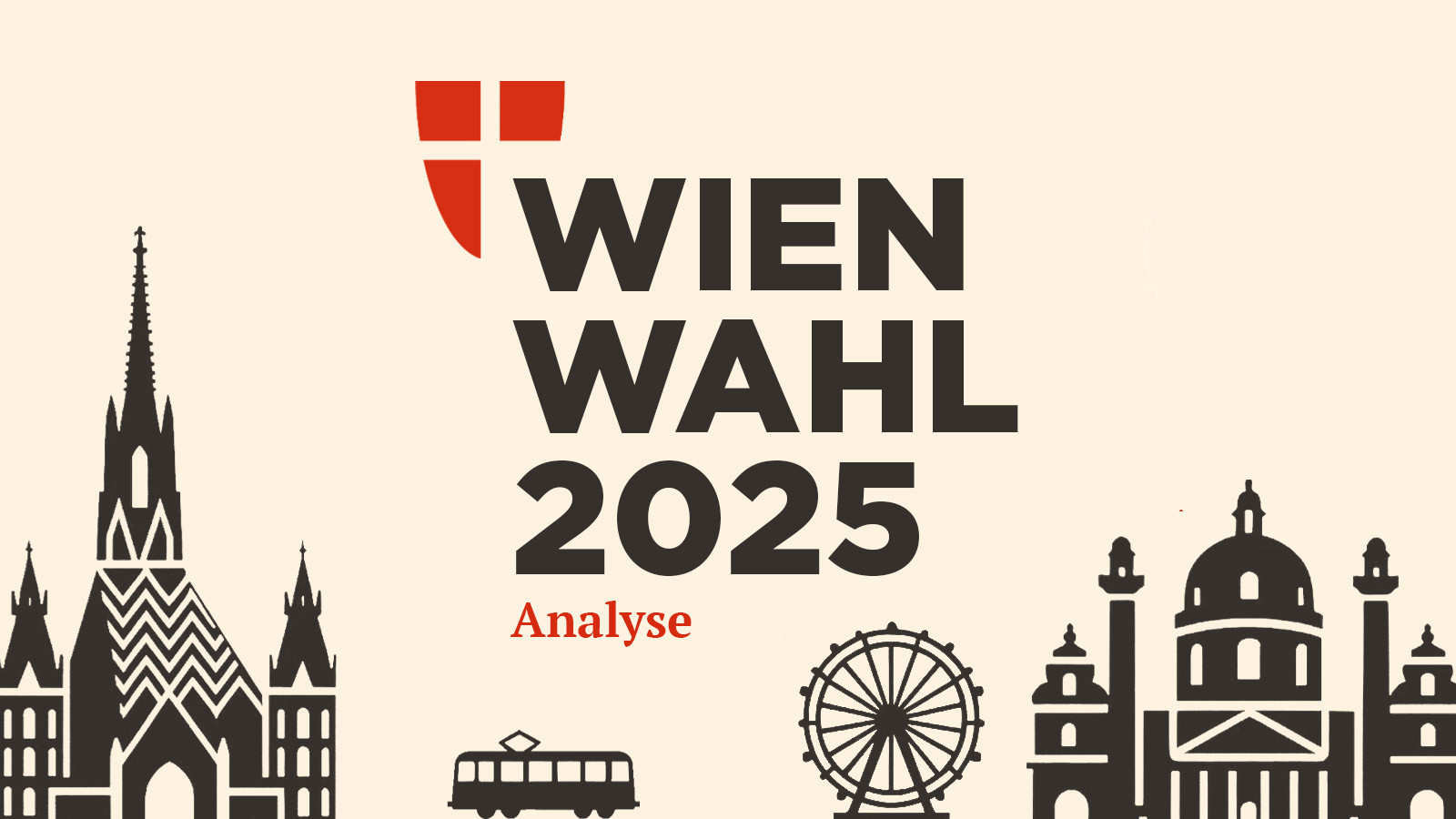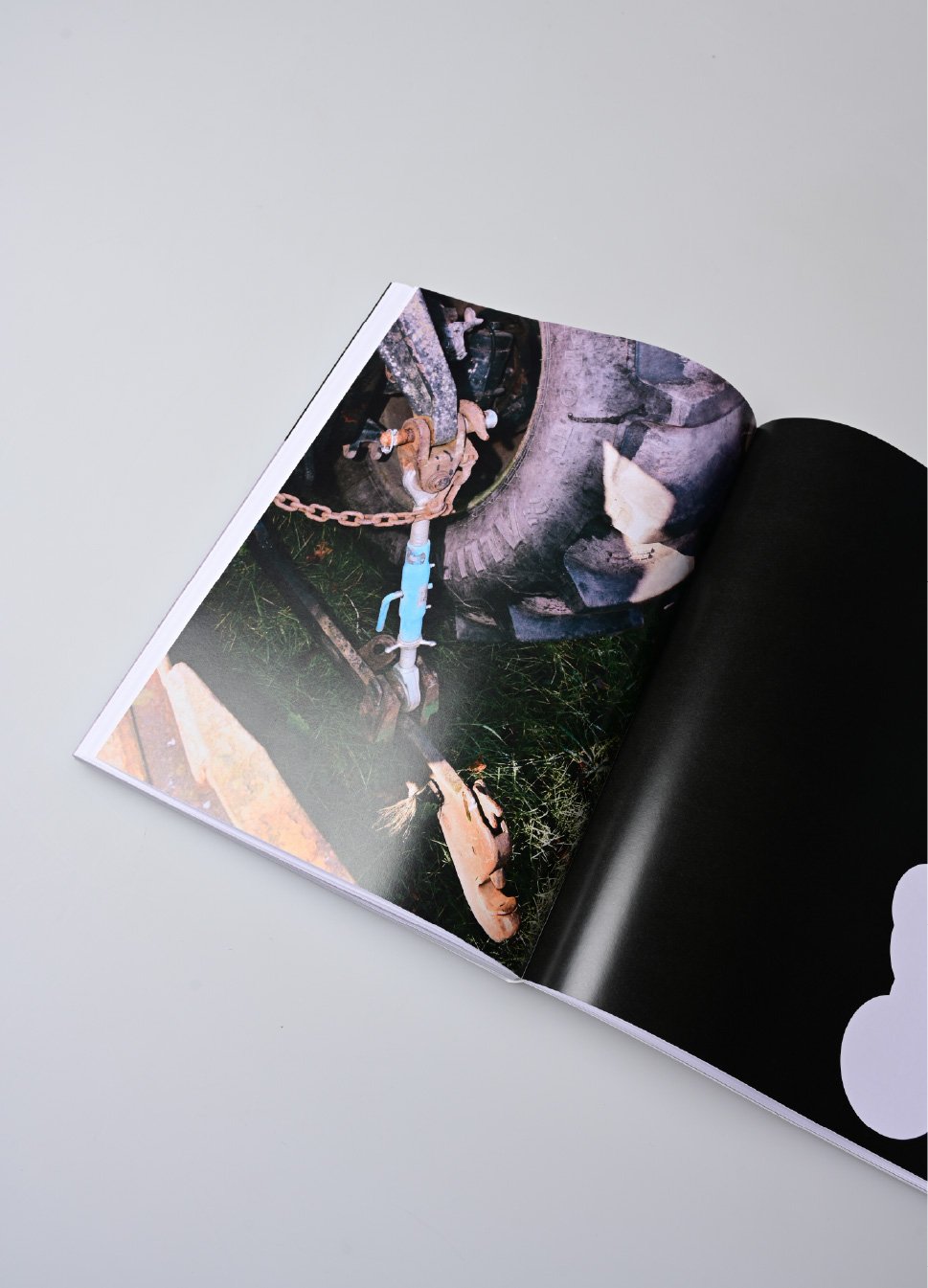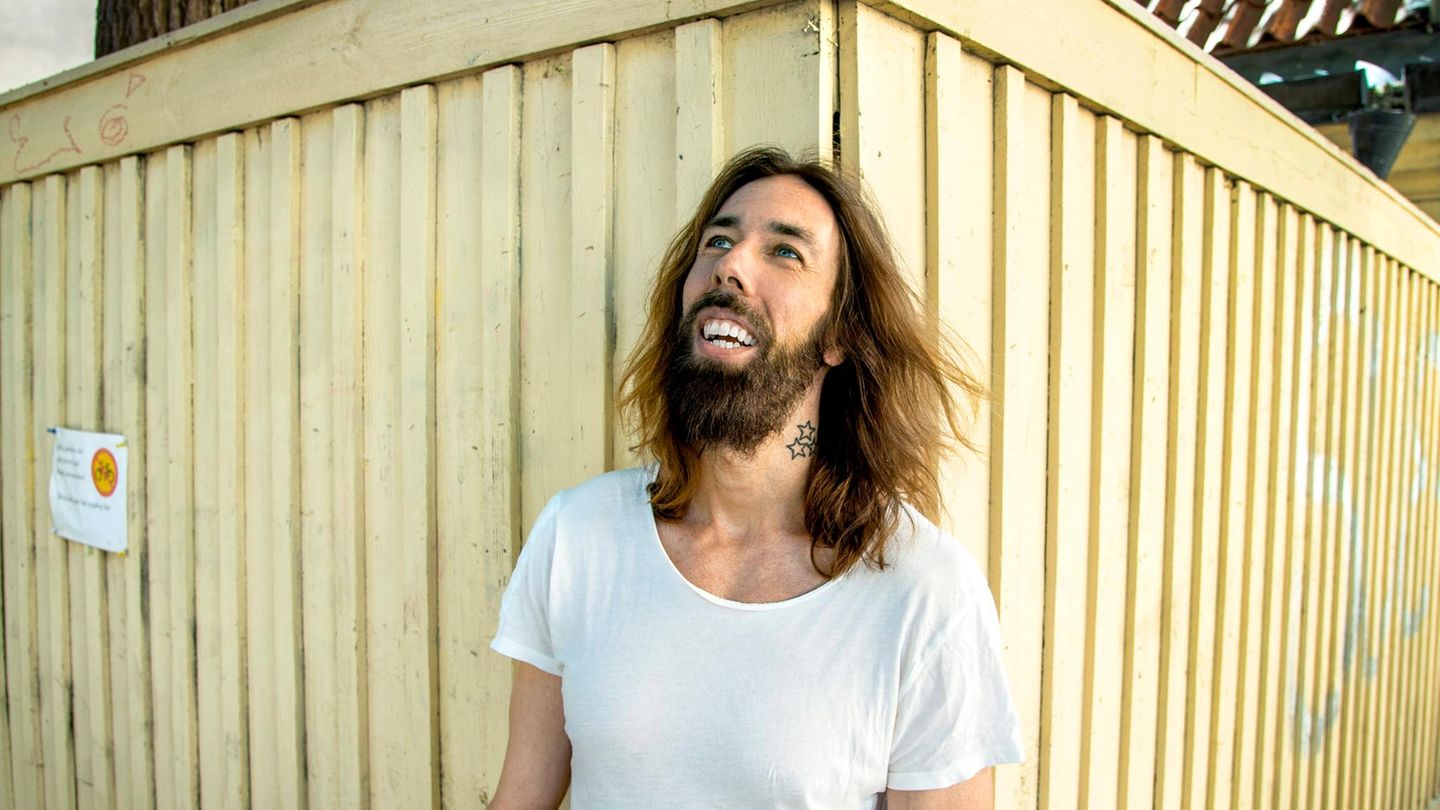Forschung: Kalte Jahreszeit, schlanke Taille? Wie der Zeugungsmonat unser Gewicht beeinflusst
Ob wir im Winter oder Sommer gezeugt werden, hat einer Studie zufolge Auswirkungen auf unsere spätere Figur: Kalte Temperaturen führen zu aktiveren braunen Fettzellen

Ob wir im Winter oder Sommer gezeugt werden, hat einer Studie zufolge Auswirkungen auf unsere spätere Figur: Kalte Temperaturen führen zu aktiveren braunen Fettzellen
Auf den ersten Blick mag es rätselhaft erscheinen: Während sich die einen nach Aperitif, Vorspeise und Hauptgang ganz selbstverständlich ein sahniges Dessert gönnen und dabei lässig die Jeans aus dem vergangenen Jahrzehnt tragen, verzichten andere konsequent auf solche Leckereien und kämpfen trotzdem ihr Leben lang mit Übergewicht. Doch unser Stoffwechsel arbeitet mitnichten willkürlich – schon vor unserer Geburt entscheiden verschiedene Faktoren, ob wir einmal zu Übergewicht neigen werden oder nicht. Unsere Gene beeinflussen etwa, wie wir Nahrung aufnehmen und das Gewicht unserer Eltern während der Schwangerschaft wirkt sich auf unseren Stoffwechsel aus.
Forschende der Universität Tokio haben noch einen weiteren Faktor ausfindig gemacht: Demnach hat auch der Monat der Empfängnis einen Einfluss darauf, ob wir tendenziell eher schlank oder übergewichtig sind. Genauer gesagt: die Temperatur zum Zeitpunkt unserer Zeugung. Wer in der kalten Jahreshälfte zwischen Mitte Oktober und Mitte April gezeugt wurde, ist demnach im Durchschnitt schlanker als Menschen, die in der warmen Jahreshälfte gezeugt wurden, schreiben die Forschenden in einer Studie im Fachmagazin "Nature Metabolism".
Der Grund dafür verbirgt sich im braunen Fettgewebe (BAT). Dieses wird bei Kälte aktiviert und produziert Wärme, wodurch automatisch Kalorien verbrannt werden. Wer aktive BAT-Zellen hat, bleibt also eher schlank. "Eine meteorologische Analyse hat gezeigt, dass niedrigere Außentemperaturen und größere Schwankungen der Tagestemperaturen während der Befruchtungszeit die BAT-Aktivität maßgeblich beeinflussen", schreiben die Forschenden.
In ihrer Studie teilten die Forschenden 356 junge, gesunde männliche Probanden anhand ihres Geburtsdatums – beziehungsweise des davon 266 Tage zurückgerechneten Zeugungsdatums – in eine Kalt- und eine Warmgruppe ein und setzten beide Gruppen zwei Stunden lang kühlen Temperaturen von 19 Grad aus. Anschließend maßen die Forschenden mit einer Kombination aus Computertomographie und Positronen-Emissions-Tomographie die Aktivität der braunen Fettzellen der Probanden. Dabei zeigte sich, dass die Kälte bei Männern, die in der kühlen Jahreszeit gezeugt wurden, das braune Fettgewebe signifikant häufiger aktivierte als bei Teilnehmern, die in der warmen Jahreshälfte gezeugt wurden. Die Temperatur während der Schwangerschaft und bei der Geburt hatte dagegen keinen Einfluss auf die BAT-Aktivität.
Kälte beeinflusst väterliche Spermien
Um zu überprüfen, ob sich die Ergebnisse auch auf andere Bevölkerungsgruppen übertragen lassen, untersuchten die Forschenden anschließend 286 weitere Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 78 Jahren. Auch hier waren die braunen Fettzellen bei den in der kühlen Jahreszeit gezeugten Personen nach der Kälteexposition deutlich aktiver. Gleichzeitig hatten diese Menschen einen höheren täglichen Gesamtenergieverbrauch, einen niedrigeren Body-Mass-Index, eine schlankere Taille und eine geringere Ansammlung von viszeralem Fett. "Da bei jungen, schlanken Personen (Kohorte 1) kein signifikanter Einfluss der Befruchtungssaison auf den BMI festzustellen war, gehen wir davon aus, dass die positive metabolische Effekt der Kälteexposition vor der Empfängnis bei Menschen mittleren Alters und älteren Menschen größer ist."
Dass die braunen Fettzellen ungeachtet des Alters aktiver sind, erklären die Forschenden mit der Epigenetik – biochemischen Prozessen, die beeinflussen, welche Gene an- und welche abgeschaltet werden. Die Außentemperatur beeinflusst demnach das Epigenom der väterlichen Spermien und sorgt dafür, dass sich in der kalten Jahreszeit häufiger der Stoffwechseltyp mit hoher BAT-Aktivität durchsetzt.
Weil starkes Übergewicht das Risiko für viele Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen erhöht und damit zu einer verkürzten Lebenserwartung führen kann, fordern die Forschenden weitere Untersuchungen – besonders im Hinblick auf die mit dem Klimawandel steigenden Temperaturen. "Die aktuelle Studie unterstreicht die Notwendigkeit, die Hypothese zu untersuchen, dass die globale Erwärmung zu den Störungen der Energiehomöostase und der anhaltenden Adipositas-Pandemie beitragen könnte", schreiben die Forschenden.
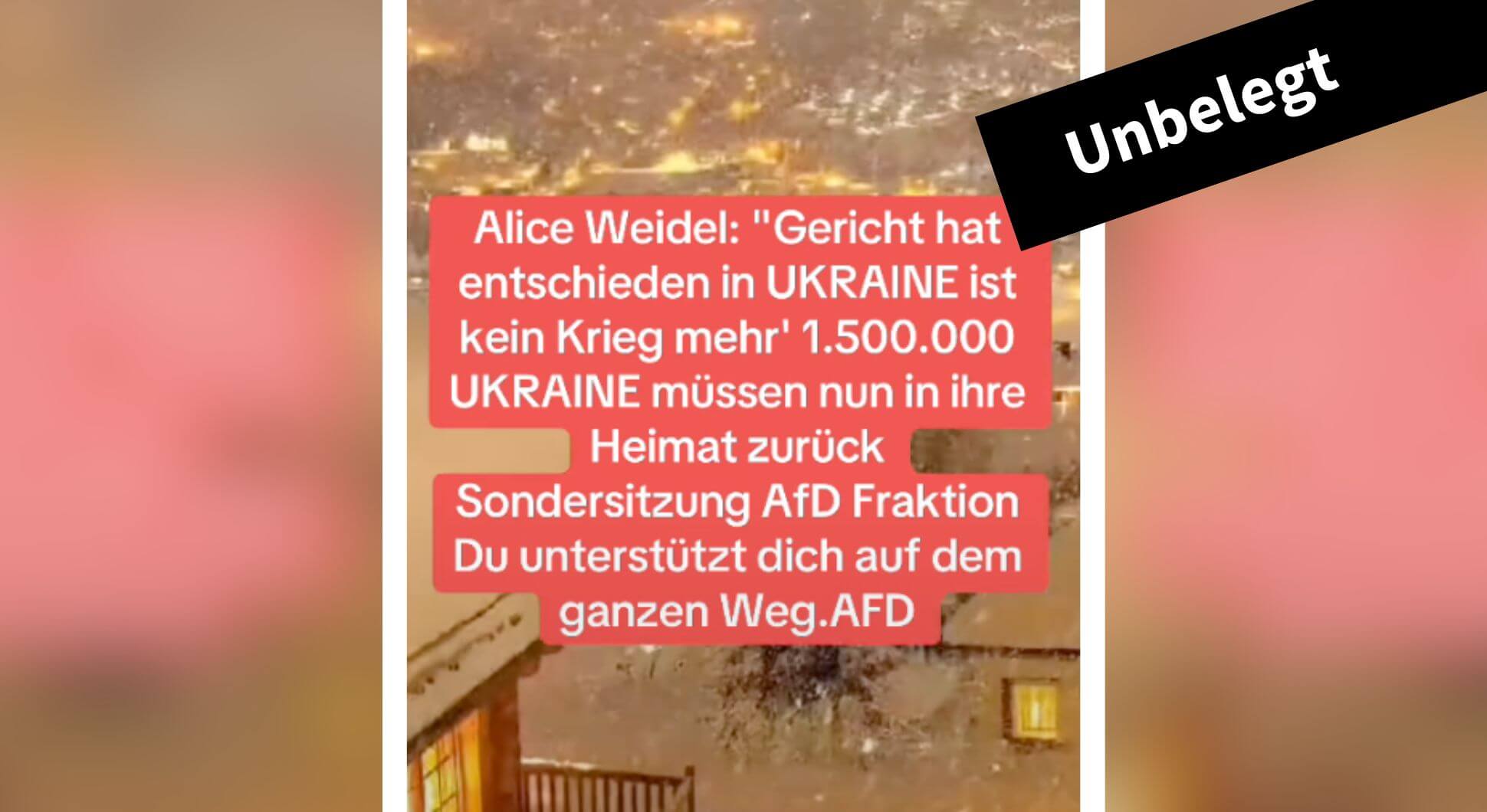




















:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/76/83/7683e641b7f3538cbc5f8e168e21528d/0124326674v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/81/bb818e1bdddd5bedf0c7b942fe8d5988/0123358373v1.jpeg?#)