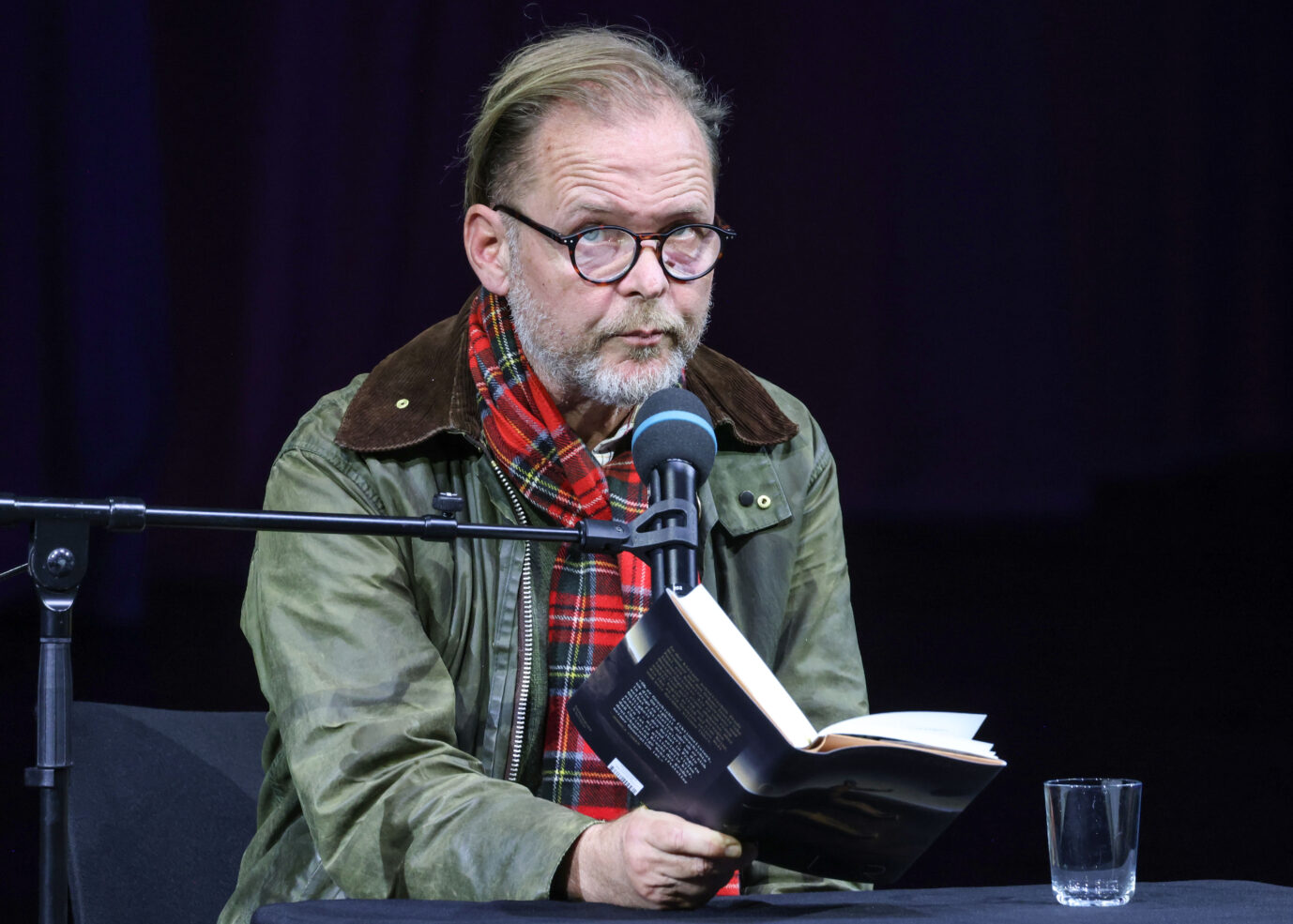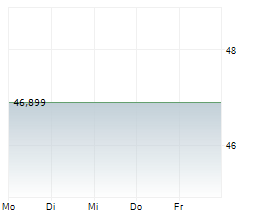Carina Schlüter: Ex-Spielerin über ihre Depressionen
Carina Schlüter erkrankte an einer Depression, als sie nicht Fußballspielen konnte. Das hat sie indirekt zu einer besseren Torhüterin gemacht.

Carina Schlüter, Sie sind Anfang 2021 psychisch erkrankt, als Sie Torhüterin beim FC Bayern München waren. Wie fiel Ihnen auf, dass was nicht stimmte?
Es ging mit Schlafstörungen los und mir kreisten die immergleichen negativen Gedanken durch den Kopf. Ich hatte damals eine Knieverletzung, und in der Reha habe ich das erste Mal den Begriff Depression gehört. Es hat aber etwas gedauert, bis ich ihn auf mich bezogen habe.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich damit haben behandeln lassen?
Nach ungefähr einem dreiviertel Jahr habe ich angefangen, ein- bis zweimal die Woche zur ambulanten Therapie zu gehen. Dort hat mich meine Therapeutin langsam darauf vorbereitet, dass es für mich der richtige Schritt wäre, in eine psychosomatische Klinik zu gehen.
Was haben Sie für eine Diagnose bekommen?
Ich hatte zum Glück keine chronische Depression, sondern das, was man Anpassungsstörung nennt oder Belastungsdepression. Ich bin in eine depressive Episode gekippt, weil bei mir viele Belastungsfaktoren zusammengekommen sind, die mich überfordert haben.
Wie lange sind Sie in der psychosomatischen Klinik geblieben?
Relativ lange, fast drei Monate. Aber ich wollte keine halben Sachen machen, sondern die Klinik erst verlassen, nachdem ich sagen kann: Jetzt geht es mir so gut, dass mir nichts mehr passieren kann. Ich habe die Chance genutzt, wirklich alles auf den Tisch zu legen, was mich beschäftigt. Dadurch verfüge ich jetzt über so viele Ressourcen und Werkzeuge, dass mich so schnell nichts mehr umhauen kann.
Welche Rolle hat Fußball in der Zeit gespielt?
Bei mir ist es tatsächlich andersherum, als viele denken. Die meisten Leute gehen davon aus, dass Profifußball ein großer Belastungsfaktor ist und Depressionen auslösen kann. Für mich war Fußball aber immer eine riesige Hilfe. Ich bin einfach das kleine Mädchen, das gerne Fußball spielt. Egal wo ich bin, wenn ich einen Ball dabei habe, geht es mir einfach gut.
War das in der Klinik auch so?
Ja, ich hatte immer einen Fußball dabei. Ich war zwischen den Therapiesitzungen immer draußen, und egal ob es geregnet oder geschneit hat, habe ich mit dem Ball jongliert. Sogar wenn ich auf dem Zimmer war und gemalt habe, was geschrieben oder Fernsehen geschaut habe, hatte ich den Ball entweder neben mir oder unterm Fuß und habe ihn hin- und herbewegt. Ohne Fußball geht es für mich nicht. Inzwischen glaube ich daher, der ausschlaggebende Punkt, warum es mir damals so schlecht ging, war meine Verletzung und dass ich nicht mehr spielen konnte. Dadurch konnte ich meine privaten Probleme nicht mehr durch Fußball kompensieren.
Sie waren die erste Fußballspielerin in Deutschland, die über Ihre Depression öffentlich gesprochen hat. Gibt es im Frauenfußball dafür besondere Hürden?
Nein, der Druck und die mediale Aufmerksamkeit ist bei den Männern deutlich größer. Vielleicht ist die Neugier aufseiten der Presse bei Frauen einfach nicht so groß. Mittlerweile gibt es viele Frauen, die über soziale Medien mitteilen, dass sie eine schwierige Phase durchmachen oder sich Hilfe holen, ohne ausdrücklich das Wort „Depression“ in den Mund zu nehmen.
War es im Rückblick eine gute Entscheidung, dass Sie das getan haben?
Ja, meine ursprüngliche Angst war unbegründet, dass es der sportlichen Karriere schadet. Hier bei SKN in Sankt Pölten war meine Erkrankung kein Problem, obwohl ich von Anfang an mit offenen Karten gespielt habe. Sie meinten hier auch gleich: Lass dir alle Zeit der Welt. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es bei einer chronischen Depression gewesen wäre. Dann muss man davon ausgehen, dass man wegen depressiver Phasen wiederholt ausfällt. Bei mir haben sie es gehandhabt wie einen Kreuzbandriss, bei dem man eine vernünftige Reha macht und hinterher wieder fit ist. Und so ist es letztlich bei mir gewesen.
Könnte es sein, dass Sie als Fußballspielerin sogar besser geworden sind?
Interessant, dass Sie das fragen. Denn es gibt viele Sachen, die mich vorher stark beeinträchtigt haben, die ich jetzt viel besser wegstecken kann. Über Kleinigkeiten, die mich früher mitgenommen hätten, sehe ich jetzt einfach hinweg. Früher war mir auch enorm wichtig, was andere Leute von mir denken, und es sollte alles immer total harmonisch sein. Als Torfrau ist das schon mal schwer, weil immer nur eine spielen kann. Heute lege ich den Fokus auch mal auf mich, das hätte ich früher nicht geschafft. Ich studiere neben dem Fußball noch Medizin, und wenn es mal super stressig wird, verschiebe ich was auf den nächsten Tag. Früher war ich so perfektionistisch, da musste alles sofort erledigt werden. Inzwischen kann ich einfach mal Fünfe gerade sein lassen, da habe ich in der Klinik sehr, sehr viel gelernt.
Welche Angebote im Fußball würden Sie sich für Menschen mit psychischen Erkrankungen wünschen?
Mehr vereinsunabhängige Sportpsychologen wären auf jeden Fall sinnvoll. Viele Sportlerinnen und Sportlern denken: Wende ich mich an unseren Vereinspsychologen, rennt er damit zum Trainer. Schulungen oder Workshops in den Vereinen wären auch gut, damit alle verstehen, dass psychische Erkrankungen ganz normal sind. Das kann jeden erwischen. So wie jeder eine Grippe bekommen kann. Viele Leute wissen zudem nicht, wie sie mit jemandem umgehen sollen, der psychisch krank ist. Sie denken sich: Frag ich jetzt nach, wie es ihr geht, oder frag ich besser nicht? Und woher sollen sie es auch wissen, wenn darüber nicht geredet wird?