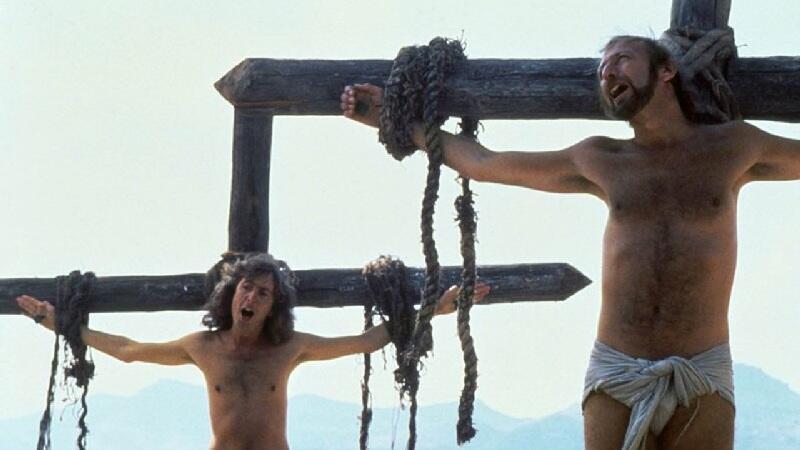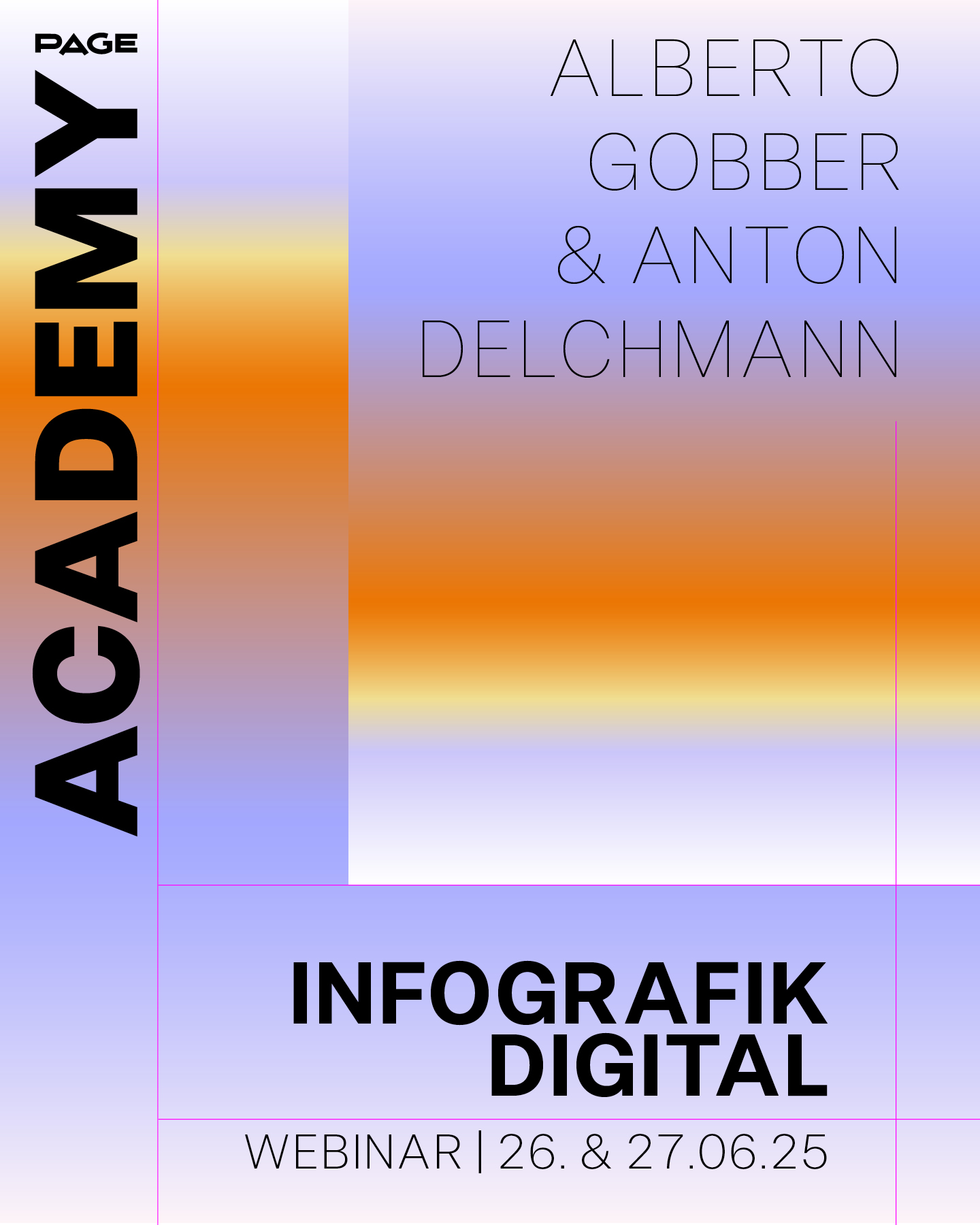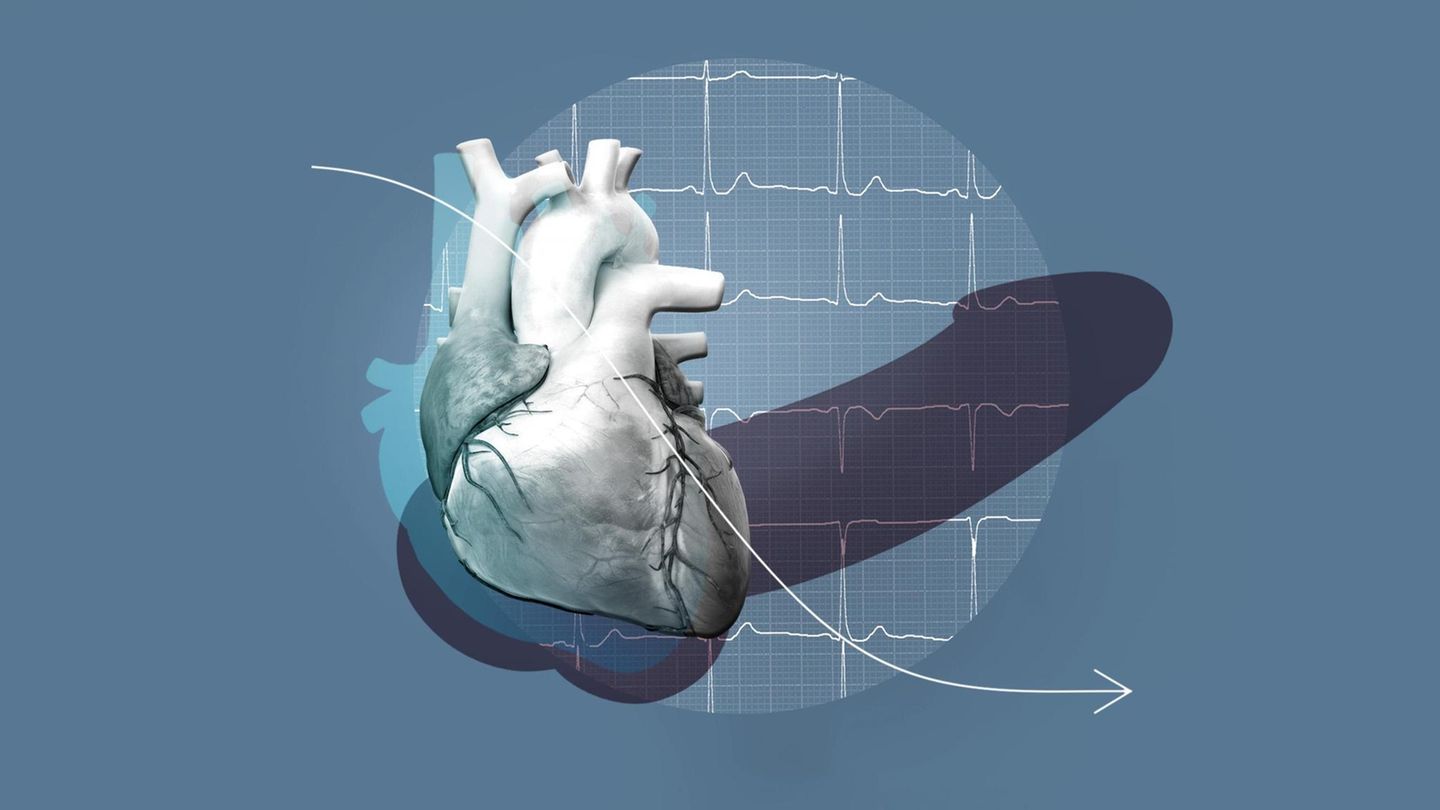Bitcoin und Bauxit im Regenwald
In Suriname verspricht die Präsidentschaftskandidatin Maya Parbhoe, einen Bitcoin-Standard einzuführen. Seitdem gilt das karibische Land als Geheimtipp unter den Bitcoin-Nationen, als das nächste und wahre El Salvador. Wir haben uns vor Ort umgeschaut und sogar Maya selbst getroffen.

In Suriname verspricht die Präsidentschaftskandidatin Maya Parbhoe, einen Bitcoin-Standard einzuführen. Seitdem gilt das karibische Land als Geheimtipp unter den Bitcoin-Nationen, als das nächste und wahre El Salvador. Wir haben uns vor Ort umgeschaut und sogar Maya selbst getroffen.
Hierzulande hat man gewisse Erwartungen an einen Politiker. Man könnte auch sagen, Vorurteile.
Als Maya Parbhoe begann, von „Shitcoins“ zu reden, als sie sagte, „we trojan horse into the financial system“, wir schleichen Bitcoin als trojanisches Pferd ins Finanzsystem hinein, als sie sich damit brüstete, mit Charlie Shrem, Phil Potter und Samson Mow in einer Telegram-Gruppe gewesen zu sein, – da ging ich instinktiv davon aus, dass hier eine Politikerin vor uns sitzt, die gelernt hat, ein bisschen Bitcoin-Slang zu sprechen, um Wähler zu beeindrucken. So kennt man es schließlich.

Maja Parbhoe
Aber wir sind nicht in Deutschland, sondern in Suriname. Wir sitzen im Hinterzimmer eines Hauses im besseren Viertel der Hauptstadt Paramaribo. Hier verkaufen die Supermärkte auch frisches Gemüse und Dosenspargel. Die Häuser sind weniger verfallen als im Rest der Stadt, die Balkone nicht vergittert, die Gärten nicht mit Stacheldraht umgürtet. Dafür bewacht ein Security mit Pistole im Halfter den Hauseingang.
Spätestens, als das Gespräch zu El Salvador und der Bitcoin-Reserve kommt, begreifen wir, dass Maya Parbhoe keine Politikerin ist, die Bitcoin spricht – sondern eine Bitcoinerin, die Politik macht, sogar eine Maximalistin, vielleicht gar eine Toxikalistin, — in jedem Fall eine Frau mit einem sehr eigenen Kopf.
Maya möchte bei den Wahlen, die in wenigen Monaten stattfinden, Präsidentin werden, um Suriname zur Bitcoin-Nation zu machen. Sie will unter anderem Bitcoin zur Währung des Landes ernennen. Seitdem gilt Suriname als neuer Hoffnungsschimmer für die nationale Bitcoin-Adaption, als eine Art Geheimtipp für Bitcoin-Reisende.
Ich hatte nun das Glück, als Teil einer deutsch-holländischen Reisegruppe, veranstaltet von Fulmo, Suriname und Maya kennen zu lernen.
Regenwald und Sümpfe
Weil Suriname früher eine holländische Kolonie war, heben wir in Amsterdam ab. Und es könnte keinen passenderen Auftakt geben.

Amsterdam aus dem Zug heraus.
Die Niederlande sind mit mehr als 500 Einwohnern je Quadratkilometer der am dichtesten besiedelte europäische Flächenstaat. Vom Flugzeug aus sieht man den flachen Boden, alles ist geordnet, betoniert, parzelliert und bebaut. Kein Zentimeter ist wild geblieben, alles ist dem planerischen Geist des Menschen unterworfen.
Suriname ist das glatte Gegenteil. Wir fliegen gut eine halbe Stunde von der Küste zum Flughafen. Man sieht … nichts: Sümpfe, Regenwälder, Bäume, die aussehen wie Brokkoli, selten Flächen mit rötlicher Erde. Keine Gleise, keine Straßen, Städte, Parzellen, Fabriken, – nur Grün und Braun in tausend Tönen.

Suriname ist eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Auf einer Fläche fast halb so groß wie Deutschland wohnen knapp 630.000 Menschen, was etwa 4 je Quadratkilometer sind. Gut die Hälfte der Einwohner lebt in und um die Hauptstadt Paramaribo. Die Armee des Landes hat 2.000 Soldaten, die Luftkräfte zwei Flugzeuge und drei Helikopter.
Paramaribo liegt an der Nordküste, wo der Suriname River in ein sumpfiges Delta hineinmäandriert und sich in Mangrovenwäldern verläuft. Paramaribo ist bekannt für seine schönen, alten Holzhäuser im Stil der Südstaaten. In der Hauptstadt kreuzen sich die zwei Hauptstraßen des Landes, die eine geht von West nach Ost, die andere von Norden nach Süden. Beide passieren einige immer dünner werdende Siedlungen und verschwinden dann im Dschungel, der rund 97 Prozent des Landes bedeckt.
„Eine idiotische Exceltabelle“
Ist Suriname eine Bitcoin-Nation? Das Potenzial ist definitiv vorhanden.
Zunächst einmal ist „die Adaption einfach, weil wir ein kleines Land sind,“ meint Maya. Man muss keine 10 oder 100 Millionen Menschen erreichen, sondern nur 630.000. Mit einer entschlossenen Kampagne und guter Mund-zu-Mund-Propaganda kann das schnell gehen.
Dann hat Suriname eine eigene Währung. „Anders als als El Salvador sind wir nicht dollarisiert. Wir spüren die Inflation und wir haben eine eigene Zentralbank, auch wenn sie beschissen ist und nicht funktioniert. Es ist dennoch ein Vorteil.“ Die hiesige Währung, der Suriname-Dollar, inflationiert in den letzten vier Jahren mit je 50-60 Prozent. Er ist seit zehn Jahren von 30 auf 2,7 Dollar-Cent gefallen. Die Wirtschaft wächst, wenn überhaupt, nur schwach, die Kaufkraft sinkt spürbar. Das Land ist auf dem Weg in die Hyperinflation.

Die Zentralbank von Suriname
Das Finanzsystem ist quasi nicht-existent. Banken vergeben zwar Darlehen, verlangen aber so hohe Zinsen, dass inländische Unternehmen automatisch im Nachteil sind. Maya hat als Unternehmerin damit ihre eigenen Erfahrungen gesammelt. Kapital ist teuer in Suriname.
Zwar gibt es eine Aktienbörse. Auf ihr werden aber nur zwölf Firmen gelistet, und der Handel findet nur am ersten und dritten Donnerstag eines Monats statt. Die Börse ist „eine verkackte Exceltabelle, die ein Mal im Monat herumgeht, und sie gehört der Familie meines Ex‘, der auch die Hälfte des Hafens gehört. Sie haben eine Seifenfabrik, eine Butterfabrik, und besitzen 20 Prozent der Banken. Es ist ein Witz!“
Suriname ist wohl das, was man eine Bananenrepublik nennen kann. Ein tropisches, schönes Land, das an Überschuldung und Korruption leidet. Bitcoin, meint Maya, könne das fixen, und wir nehmen diese Hoffnung gerne an. Wozu sonst wurde Bitcoin gemacht?
„Mit Bitcoin kann jeder sehen, wohin die Gelder fließen.“
Maya ist 36 bewegte Jahre alt. Als sie ein Teenager war, wurde ihr Vater ermordet. Er war ein bedeutender Mann, der gegen die Korruption gekämpft hatte. „Wir waren in Holland, weil wir bedroht wurden. Ich habe dann im Fernsehen gesehen, wie er erschossen wurde. Es wurde überall hin ausgestrahlt.“
Sie kommt so schnell darauf zu sprechen, dass ich mich frage, ob sie es gewohnt ist, es für den Wahlkampf zu erzählen. So haben wir es mit Politikern eben gelernt.

Die Partymeile Paramaribos bei Tag.
Der Tod ihres Vaters stürzte Maya in eine Depression. Ihre Noten wurden schlechter. Auf Rat eines Psychiaters suchte sie sich neue Idole und fand sie in amerikanischen Unternehmern. Sie erwähnt Jeff Bezos und Bill Gates, aber nicht Elon Musk. Macht sie das, weil der Name zu kontrovers ist? Aber ist Bill Gates das nicht auch?
Mit 15 gründete sie ihre erste Firma, etwas mit Import und Export. Sie gründete noch ein Startup, soweit ich es verstanden habe, auch im Straßenbau. Dabei lernte sie die Probleme kennen, die Unternehmer in Suriname haben – etwa das fehlende Finanzsystem oder die geringe Währungsliquidität -, und als sie auf Bitcoin stieß, leuchtete ihr sofort ein, wie Bitcoin ihrem Land helfen kann.Sie fiel mit Haut und Haaren in den berühmten Kaninchenbau hinein, den so viele Bitcoiner nur zu gut kennen …
Was Bitcoin für Suriname tun kann
Zunächst das Offensichtliche: Bitcoin kann die Inflation beseitigen, an der Suriname zunehmend leidet.
Mit Bitcoin können Surinamer Geld, das sie übrig haben, auch dann speichern, wenn sie keinen Zugang zu ausländischen Kapitalmärkten haben. Eine nationale Währung Bitcoin würde die Masse der Menschen, die vom Suriname-Dollar abhängig sind, emanzipieren. Selbst im tiefsten Bärenmarkt speichert Bitcoin Werte besser als der Suriname-Dollar.
Dann ist Bitcoin viel liquider als der Suriname-Dollar. Man kann ihn mit einer beliebigen Währung in viel größerer Menge und mit viel geringeren Gebühren und Kursverlusten kaufen und verkaufen. Bitcoin würde den Außenhandel von Suriname massiv vereinfachen und skalieren.

Schwer zu glauben: Das Innenministerium von Suriname.
Maya will auch das Finanzsystem durch Bitcoin ersetzen. Soweit ich es verstanden habe, denkt sie dabei an sogenannte Second Layer wie Lightning und Nostr sowie Token. Einen Teil der Infrastruktur dafür schafft sie mit einem Startup selbst Daedalus Labs, das sie 2023 mitgegründet hat, um einen Bitcoin-Immobilienfonds zu entwickeln.
Wenn Bitcoin das Geld und Token auf Bitcoin den Kapitalmarkt ersetzen, wäre das ein großartiger Fortschritt. Es könnte dem Land die Liquidität bringen, die Unternehmer brauchen. Token könnten Aktien abbilden, Smart Contracts Verträge, und alles wäre transparent, sicher und jederzeit aktuell.
Transparenz gegen Korruption
Die Transparenz von Bitcoin ist für Maya ein großer Vorteil. „Bitcoin ist vollständig transparent. Jeder sieht, wohin Geld fließt, welche Ministerien welche Einnahmen und Ausgaben haben. Wie verkackt nochmal können sie da überhaupt noch korrupt sein? Ich träume davon, dass wir ein Corruption Bounty einführen, wie ein Bug Bounty, jeder auf der Welt kann nachforschen, ob es Korruption gibt.“
An der Stelle begreife ich langsam, dass Maya nicht nur gerne flucht. Sie redet nicht wie eine Politikerin, um Punkte zu sammeln. Sie hat sich gründlich eigene Gedanken gemacht.
Jeder, mit dem wir geredet haben, beklagt sich über die Korruption. Sie ist in Suriname das, was in Deutschland die Bürokratie ist – man klagt über sie, lebt aber mit ihr. Wegen der Korruption wird illegal Gold abgebaut, verfallen die historischen, von der UNESCO geschützten Holzhäuser in Paramaribo, einschließlich der Ministerien, betreiben Chinesen 98 Prozent aller Supermärkte, inflationiert der Suriname-Dollar und so weiter.
Maya preist nun die Transparenz von Bitcoin. Sie hat dabei, finde ich, gute Gründe, und ich teile ihre Vision. Aber die meisten Bitcoiner mögen nicht die Transparenz, sondern die Privatsphäre einer Kryptowährung, sie schätzen die Autonomie, die sie gewähren, nicht die Kontrolle, die sie erlauben.
Für Transparenz zu sein, bringt einem keine Punkte bei Bitcoinern. Aber darum geht es Maya nicht. Das wird noch klarer, als sie über die Strategische Reserve spricht.
Norwegen statt El Salvador
Maya ist derzeit hochschwanger. Wir hatten einen Termin mit ihr um 16 Uhr in der Bitcoin Embassy in ihrem Firmengebäude. Wir waren etwa um 14 Uhr von einem dreitägigen Dschungel-Ausflug zurückgekehrt. In Paramaribo regnete es, braunrotes Wasser füllte knietiefe Schlaglöcher auf den Straßen, das bald verdampft und die Luft noch schwüler macht.
In Suriname hat es durchgehend 25-35 Grad. Es gibt keine Jahreszeiten in unserem Sinn, sondern nur Trocken- und Regenzeit. Gerade sind wir in der kleinen Regenzeit, erklärt mir die Rezeptionistin im Hotel, ich vermute, sie hat indonesische Ahnen. In der kleinen Regenzeit ist der Himmel meistens bewölkt und es regnet häufig, aber nur sanft, wie ein Sprühregen, und die Tropfen verdampfen, noch ehe sie sich am Boden sammeln können.
In den Hotelzimmern läuft die Klimaanlage permanent. Wenn man sie ausschaltet, breitet sich der Schimmel aus. Sobald man das Zimmer verlässt, erschlägt einen die Luft wie eine warme, feuchte Wand, und man fühlt sich einen Moment so, als bewege man sich durch Öl.

Sieht man häufig in Paramaribo: Stacheldraht und Gitter.
Ein Taxi bringt uns zur Bitcoin-Embassy, wo wir einen Termin mit Maya haben und danach von der Bitcoin-Community zum Barbecue eingeladen sind. Im Taxi lief Reggae, der Fahrer schrieb auf seinem Smartphone in Chats und gab Sportwetten ab, während er uns durch die Stadt steuerte.
Die Bitcoin Embassy ist in einem eher mittelmäßigen Viertel von Paramaribo. Überall, wo es etwas zu holen gibt, schützen Gitter, Mauern und Stacheldraht die Grundstücke. Selbst die Balkone sind vergittert; aus manchen Mauern starren einzementierte zerbrochene Glasflaschen.

Die Bitcoin-Embassy
Aber Maya ist noch nicht da. Wir schauen uns um, begutachten den Bitcoin-Automaten und reden mit ihrem Mitarbeiter. Der ruft Maya an, die eben noch geschlafen hat, und erklärt unserem Taxifahrer, wie wir zu ihr kommen, wo das Interview stattfinden soll.
„Wir sind nicht El Salvador“
Bei Maya warten wir noch ein Weilchen in einem Hinterzimmer. Dann kommt sie schlaftrunken hinein, setzt ihren kugelrunden Bauch aufs Sofa uns gegenüber, seufzt erschöpft von der kurzen Bewegung, und beginnt, noch ehe jemand eine Frage stellt, zu reden. Mehrmals im Gespräch hält sie inne, um Wasser zu trinken oder sich frische Luft zu zu fächern. „Ich überhitze,“ sagt sie dann, redet aber sofort weiter.
Maya hat Bitcoin schon früh entdeckt, ungefähr 2012 oder 2013. Sie war auf vielen Konferenzen, kennt Szene-Promis wie Samson Mow, Max Keiser oder Stacy Herbert, die seit ungefähr fünf Jahren bei Regierungen für Bitcoin trommeln. Stacy war es auch, die Maya riet, in die Politik zu gehen, um ihre Ziele zu erreichen.
Wenn man in Suriname von Bitcoin spricht, ist man schnell bei El Salvador. Das Land ist nahe, und es ist das erste, das vorgemacht hat, dass es möglich ist – dass eine Regierung Bitcoin annehmen kann. in El Salvador entstand auch das Konzept einer Strategische Bitcoin Reserve, das, was die USA nun auch bekommen, China indirekt hat, und das Bundesland Sachsen wie eine heiße Kartoffel weggeworfen hat.
Zu unserer Überraschung lehnt Maya eine solche Strategische Reserve entschieden ab. Sie begründet es libertär: „Die Reserve wird von der Regierung kontrolliert, richtig?,“ entrüstet sie sich, „Warum sollte ich die beschissene Regierung mächtiger machen wollen? Ich will sie doch abschaffen. Wir brauchen sie nicht. Alles geht besser ohne sie. Die Regierung baut keine Straßen, das machen die Unternehmen.“
Unsere Gruppe stutzt überrascht. Wirklich? „Ja, wirklich nicht. Ich will stattdessen einen Nationalen Staatsfonds, der Bitcoins akkumuliert, so wie Norwegen,“ erwidert Maya.
Aber ist das nicht dasselbe in Grün, fragt jemand perplex?
Nein, erklärt sie, „ein Staatsfonds gehört dem Volk, nicht der Regierung, man kann und muss in die Verfassung schreiben, dass sie den Fonds nicht einfach so ausgeben darf. Wir müssen sowieso seit langem unsere Verfassung ändern.“
Nach einem kurzem Moment des Staunens leuchtet uns der Unterschied ein. Die Bitcoins von El Salvador gehören der Regierung Nayib Bukele, der Staatsfonds in Norwegen dem Volk. Die Regierung darf nur wenige Prozent von ihm jährlich anzapfen.
Man sollte Maya in ihrem Redefluss, der wie der Suriname River durchs Gespräch mäandriert, nicht unterschätzen. Sie hat über das, worüber sie redet, nachgedacht. Dieser Fonds soll, meint sie, mit Einnahmen aus dem Export von Gold und Öl gefüllt werden.
„Wir sind nicht El Salvador. Wir haben eine Export-Wirtschaft, wir haben viele Güter, die wir gegen Bitcoin verkaufen können.“
Eigentlich ein reiches Land
Tatsächlich könnte Suriname ein reiches Land sein, und der Suriname-Dollar, dessen Rückseite mit Szenen des Regenwaldes bebildert ist, eine starke, stolze Währung, die die reichen Bodenschätze des Landes hinter sich weiß. Es gibt keinen endgültigen Grund, weshalb Suriname so tief verschuldet ist und die Kaufkraft der Menschen schwindet.
Wenn man von Paramaribo aus nach Süden reist, wird der Boden bald rötlich, wie Rost. Die Erde ist reich an Bauxit, ein Erz, aus dem Aluminium erzeugt wird. Suriname hat genügend Bauxit für die ganze Welt. Im zweiten Weltkrieg war es für den Flugzeugbau der USA so wichtig, dass die deutsche Flotte ein Handelsschiff im Suriname River versenkt hat, um den Hafen zu blockieren. Man kann das Wrack noch immer sehen.

Der rotbraunrostige Bauxit ist überall.
In den 60ern hat Suriname den Brokopondo-Staudamm sowie ein Alumiumwerk gebaut, um Bauxit selbst zu verarbeiten. Doch nach Problemen mit der Stromversorgung, manche sagen, weil der Klimawandel den Pegel des Stausees senkt, stellte man die Produktion ein. Das Aluminiumwerk, das größte Gebäude des Landes, rostet seitdem an der Nord-Süd-Straße vor sich hin und unterbricht die grüne Monotonie des Dschungels.
Der Staudamm verdeutlicht die Dimensionen, um die es in Suriname geht: Er produziert 108 Megawatt, wenn alle acht Turbinen laufen, also etwa ein Zehntel Atomkraftwerk. Damit versorgt er das ganze Land, bei tieferen Pegeln laufen zusätzlich Dieselgeneratoren.

Das Aluminiumwerk in Suriname
Am Staudamm wurden wohl mal Bitcoins gemined, von jemandem, den Maya auch kannte. Aber als sie erfuhr, dass der Gewinn nur an die Regierung und die Miner ging, machte sie es öffentlich und stoppte es damit – so in der Art erzählt sie es uns.
Rund um den Staudamm wird kein digitales, sondern physisches Gold geschürft. Teilweise mit Lizenzen, die die korrupte Regierung chinesischen Goldgräbern ausgestellt hat, oft aber illegal, durch Goldgräber, die von Brasilien aus die Grenze überschreiten. Die Grenze ist viel zu lang und der Urwald zu tief, als dass Suriname mit seinen wenigen Menschen in der Lage wäre, den Zustrom zu kontrollieren.
Die meisten Leute, mit denen wir hier reden, sagen nur Schlechtes über die Goldgräber: sie gelten als kriminell und gefährlich. „Wie sollte ich gegen sie kämpfen?,“ lacht eine Aktivistin, die mit uns auf eine Insel im Stausee gefahren ist, „ich kämpfe gegen sie und sie erschießen mich.“ Die Aktivistin ist eine Nachfahrin der Sklaven und lebt in Holland. Sie trägt ein leuchtend blaues Kleid und sagt, dass sie keine Angst habe. „Wenn man das richtige macht, muss man keine Angst haben.“
Gold ist wegen der steil steigenden Preise derzeit das Hauptexportgut von Suriname. Aber man mag es nicht. Mehr Hoffnung setzt man in einen Ölbohrturm, der derzeit vor der Küste errichtet wird. Von vielen Orten aus sieht man am Horizont eine Flamme, die das von der Bohrung entweichende Gas verbrennt, wie ein Leuchtfeuer an der Küste. Vom Öl erhofft sich Suriname gut fließende Einnahmen, die hoffentlich, nach dem Vorbild Norwegens, in einen Staatsfonds mit grundgesetzlicher Kontrolle fließen, am besten in Bitcoin.
Aus Prinzip kein Zucker
Mit dem fruchtbaren Boden und dem feuchten, warmen Klima bietet Suriname eigentlich ideale landwirtschaftliche Bedingungen. „Man steckt einen Zweig in die Erde und hat am nächsten Tag einen Baum“, sagte unser Stadt- und Dschungelführer Sandro.
Überall wachsen Palmen, Kokos-, Dattel-, Goldfrucht-, Traubenpalmen, dazu Bananenstauden, Mangobäume, Köstliche Fensterblätter und mehr. Das Klima wäre geeignet, um Rohrzucker, Kakao, Tabak und Kaffee anzubauen. Allerdings sieht man in Suriname sehr wenig Landwirtschaft, meistens nur Kokospalmen und Bananenstauden.
Sandro erklärt uns den Grund. Er ist plausibel, aber nicht leicht zu akzeptieren. Wir besichtigen Fort Nieuw Amsterdam, eine halb in der sumpfigen Erde versunkene Festungsanlage aus Lehm. Sie sollte früher Küstenpiraten aufhalten, heute ist in ihr das Nationalmuseum. Zwischen den Ruinen stehen zwei große, eiserne Töpfe. Sandro und sein Assistent stimmen ein surinamisches Volkslied an, in dem es um warme Hände geht. In den Töpfen, erklärt er, wurde früher Zuckermelasse gekocht. Das Lied beklagt die Qualen, die die Sklaven dabei erlitten.
„Die Arbeit auf den Plantagen war so grausam, dass heute niemand mehr Zuckerrohr anbauen will. Wir importieren unseren Zucker aus Europa, den Weißen.“ Ähnlich ist es mit Kaffee, Tabak und Kakao, vermutlich auch Getreide. In jedem Fall sahen wir kein Getreidefeld. So als würde ein kollektives Trauma aus der Sklaverei die Surinamer bis heute davon abhalten, ihre landwirtschaftlichen Schätze auszubeuten.

Kathedrale aus Zedernholz in Paramaribo
Im ehemaligen Gefängnis des Forts gibt es eine Ausstellung. Jede der Volksgruppen, aus denen sich die 630.000 Surinamer zusammensetzen, hat eine Zelle. Es sind die afrikanischen Sklaven, die die Holländer einschleppten; dann die Inder und Indonesier, welche sie als Gastarbeiter ersetzten, nachdem die Sklaverei im 19. Jahrhundert abgeschafft wurde. Weil sie so schlechte Verträge und Arbeitsbedingungen hatten, gelten sie auch als Opfer des Systems. Neben ihnen gibt es auch Juden, Chinesen und Libanesen sowie einige Holländer.
Suriname ist, gemessen an seiner Bevölkerungsanzahl, extrem divers. Mit seiner Kathedrale, der Synagoge, der Moschee und dem Mandir, ist das kleine Paramaribo wie ein Treffpunkt der Weltreligionen. Die Kulturen, Ethnien und Religionen scheinen hier in Frieden zusammenzuleben, selbst Juden und Muslime. Das Bewusstsein, einmal Sklave gewesen zu sein, verbindet die Menschen, erklärt Sandro.
Sich als Opfer zu verstehen schweißt eben zusammen. Wir Weißen und Europäer, vor allem die Holländer, gehören nicht dazu.
Ökologie durch Chaos
Während der Reise denke ich immer wieder, dass es falsch ist, Suriname durch die westliche geschäftige Brille zu betrachten. Man wünscht den Menschen instinktiv, dass ihr Land mehr so wird wie Deutschland oder Holland, zu einer stabilen Demokratie, einem Industrieland mit Wohlstand, Sicherheit und Wachstum.
Und wir, als Bitcoiner, wünschen uns, dass Bitcoin ihnen dabei hilft. Darum sind wir schließlich hier.
Nehmen wir den Abfall. Der liegt hier überall. Am Rand des Dschungels bei einem Indianer-Dorf, das wir besichtigten, am rostroten Strand des Brokopondo-Staudamms, am Rand von Straßen und Wegen, unter Bäumen und auf öffentlichen Plätzen – man macht das halt so. Man wirft seine Dosen, Plastikflaschen und Tüten wohin. Selbst das Flugzeug, mit dem wir zurück geflogen sind, war voll Müll, als es in Amsterdam landete.

Ein seltener Anblick: Menschen sammeln Müll auf, hier am Brokopondo-Stausee.
Viele in unserer Gruppe stört dies. Wir, als saubere Deutsche und Holländer, wittern eine ökologische Sünde, wenn man Abfall nicht in Mülleimer, sondern in die Natur wirft. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn man das auf jeden Zentimeter parzellierte, behaute und verbetonierte Holland vergegenwärtigt, und es mit dem wilden, unbesiedelten, grünen Suriname vergleicht, wo die Lunge der Erde noch mit voller Kraft atmen kann und wo das auf- und abschwellende Rauschen der Zikaden durch die Nächte lärmt — dann fragt man sich, ob es nicht eben das Fehlen jenes ordnenden Verstandes ist, das die Erde rettet?
„Ich konnte nicht in Holland leben,“ sagt Maya, „ich fühlte mich nicht frei.“ Ich frage sie, ob es daran liegt, dass alles so voll ist, weil Holland so dicht besiedelt ist und Suriname so dünn. „Nicht nur das,“ antwortet sie, „ich kann auf einem Schweizer Berggipfel stehen, dort habe ich auch gelebt, und ich fühle Frieden. Aber frei fühle ich mich nur hier.“
Wenn die Surinamer unseren geschäftigen, ordnenden Geist hätten, dann würden sie dafür sorgen, dass man Müll aufhebt. Sie würden aber auch mehr Straßen bauen, mehr Gleise, mehr Fabriken, mehr Betonmauern, mehr Plantagen; sie würden, wie damals die Holländer, Personal für die Fabriken importieren und den Wald roden, um Dörfer für es zu bauen.
Die Welt sauber und ordentlich zu halten, bedeutet auch, sie zu beherrschen und sich untertan zu machen. Es bedeutet, sie in ökonomischen Mustern und Begriffen zu deuten und zu rationalisieren – sie auszubeuten. Und genau das macht Suriname eben nicht, und das ist in gewisser Weise auch das, was Sandro, unserem Guide, unendlich fehlte, als er mehr als sechs Monate in Holland lebte:
„Hier kann ich mein Zelt aufschlagen, wo ich will, und wenn ich Hunger habe, kann ich mir einen Fisch fangen oder im Wald jagen. In Holland fehlt mir das und ich fühle mich unfrei.“
Bereit für den Bitcoin-Standard?
Die Unterschiede zum westlichen Denken fallen an so vielen Stellen auf. Die Zeit vergeht anders, alles dauert länger, wirkt weniger organisiert. Viele Menschen sitzen in Paramaribo einfach nur da, sie daddeln nicht, lesen nicht, reden nicht, werkeln nicht.
Die hübschen, von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannten Holzhäuser der Altstadt sind oft verfallen und morsch. In manchen türmen sich Müllberge im Erdgeschoss. Aus anderen ragen stählerne Skelette hervor, ohne dass jemand baut. Oft sind Dächer eingefallen, ohne dass man weiß, ob das Haus bewohnt ist oder nicht. Selbst bei manchen Ministerien weiß man nicht, ob es eine Ruine ist oder nicht. Paramaribo ist eine trostlose Stadt im Verfall.
Verträgt sich all das mit einem Bitcoin-Standard? Braucht man nicht einen gewissen Sinn für Ordnung, Ökonomie und Gründlichkeit, wenn nicht gar für Penibilität, um, wie Maya es vorhat, die Zentralbank aufzulösen, den Suriname-Dollar abzuschaffen und Bitcoin zum neuen Zahlungsmittel zu machen (sie will aber Währungsfreiheit einführen)?
Es gibt in der Tat einige Läden, die Bitcoin akzeptieren, hier ein Restaurant, dort ein Tätowierstudio; laut den Karten im Internet mehr als 120 Akzeptanzstellen in Paramaribo allein. Die meisten Leute haben einen Begriff, was Bitcoin ist, und als wir unseren Guide Sandro, seinen Assistenten und unsere Busfahrer auffordern, eine Wallet zu installieren, um einige Sats Trinkgeld zu bekommen, machen sie bereitwillig mit.

Straßensszenerie in Paramaribo
Das mobile Netz ist entlang der Straßen und Städte hervorragend, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal in einem Funkloch waren. Die Voraussetzungen sind also gut.
Dennoch glaubt niemand in unserer Gruppe, dass man den Suriname-Dollar aus Papier durch Bitcoin ersetzen könnte. Die meisten Geschäfte akzeptieren keine Kreditkarten, man kann mit Dollarscheinen bezahlen, die dann mit großzügigem Kurs umgetauscht werden.
Wie soll es mit Bitcoin funktionieren? Welche Wallet benutzen die Leute? Kennen sie den Unterschied zwischen Onchain und Offchain?
Wissen sie, dass sie bei der hier populären Blink-Wallet einer dritten Partei ihr Geld anvertrauen? Und was das bedeutet? Will Maya die Menschen echt dazu zwingen?
Wie man 4.000 Dollar verliert
Selbst Mayas eigenes Team schafft es nicht, Bitcoins sicher zu haben. Sie erzählt uns, wie ihr ehemaliger Assistent Bitcoins verwaltet hat, die sie für eine Fußballmannschaft aus einem Dorf südlich des Brokopondo-Stausees gesammelt hatten.
Der Assistent betrieb eine eigene Wallet. Dann aber entdeckte er eine verdächtige Transaktion, und fragte in einer Telegram-Gruppe um Rat. In dieser wurde er aufgefordert, die Seed-Phrase einzugeben. Er machte das, und … – jeder ahnt, wie es weitergeht. Wenn selbst ein Bitcoiner, ein Mitarbeiter von Maya auf einem so einfachen, offensichtlichen Trick aufläuft – wie wird es dann erst einem ganzen Land ergehen? Einzelhändlern, die noch nicht mal ein Bankkonto kennen? Wie soll man 630.000 Menschen erklären, dass sie niemals einen Seed teilen dürfen?
Dazu gibt es noch nicht einmal eine Börse. Maya wollte einmal eine gründen, sie arbeitete dafür mit einem Unternehmen zusammen, das auch in El Salvador aktiv ist. Die Zentralbank war an sich nicht dagegen, aber irgendwie ist das Projekt dennoch gescheitert.
Wie soll man überhaupt die Suriname-Dollar gegen Bitcoin wechseln? Wie bringt man genügend Bitcoin in Umlauf?
Warum Bitcoin dennoch sinnvoll wäre
Nichtsdestoweniger wäre es sinnvoll, den Suriname-Dollar überall, wo es nur geht, durch Bitcoin zu ersetzen. Selbst bei schlechten Kursen und selbst mit verlorenen Schlüsseln würde dies den Wohlstand besser erhalten als der Suriname-Dollar.
Mayas Stiefvater, der sie später zum Barbecue auf der vergitterten Dachterrasse der Bitcoin-Embassy begleitet, erzählt mir, dass er eine Fischfabrik betreibt und Fisch exportiert. Er bringt Dollar ins Land, den Suriname-Dollar braucht er, um seine Arbeiter zu bezahlen, aber er stört vor allem, da er Reibung und Verluste mit sich bringt. Bitcoin könnte hier aus dem Stand heraus helfen.
Eine Adaption des Dollars hingegen, wie in El Salvador, würde zunächst vertrauter wirken. Die Menschen hier akzeptieren fast überall den Dollar, es wäre für sie ein viel kleinerer Schritt, einfach die Suriname-Dollar aus dem Verkehr zu ziehen. Aber dies würde erst Dollar-Strukturen benötigen und Abhängigkeit von den Dollarbanken schaffen. Bitcoin wäre schon heute bereit und verlangt nichts.
Ebenfalls sinnvoll wäre es, die Überschüsse aus dem Export als Bitcoin in einen Nationalen Staatsfonds überzuführen. Das Land exportiert schon jetzt viel und kann noch sehr viel mehr exportieren. Es kann seinen Export im Grunde endlos hochskalieren, die Grenze bildet allein, was das Land an Dschungel und Boden erhalten will.
Suriname hat zudem so viel Sonne, dass es mit Photovoltaik-Strom leicht zur Mining-Großmacht werden könnte. Das Potenzial, das Bitcoin für das kleine Land hat, ist also gewaltig.
Keine Illusionen
Allerdings sollte man sich keine Illusionen machen. Maya tritt für die zweitgrößte Partei an und steht auf dem dritten Listenplatz. Sie hat hervorragende Aussichten, es ins Parlament zu schaffen, vielleicht sogar Teil der Regierung zu werden. Aber dass sie Präsidentin wird ist sehr unwahrscheinlich.
Und selbst wenn … Maya ist eine Bitcoinerin aus Leidenschaft und vermutlich eine begabte Unternehmerin, die den Geist von Tech und Startup atmet. Aber vieles, was sie macht, scheint zu versanden oder an Konflikten zu scheitern.
Terence, der sympathische und engagierte Mitarbeiter, den wir Anfang der Woche kennengelernt hatten, war am Ende der Woche entlassen, und Maya zog ausführlich über ihn her. Die Firma, die ihr eine Börse aufbauen sollte, hat es in ihren Erzählungen verbockt. Ihre eigene Firma, Daedalus Labs, hat seit zweieinhalb Jahren eine Webseite, aber seit zwei Jahren keine Neuigkeit auf dem Blog, das sie betreibt.
Wie soll eine Frau, die daran scheitert, eine Börse aufzubauen, ein Bitcoin-Startup hochzuziehen, einen engagierten Assistenten zu halten – wie soll sie ein ganzes Land auf einen Bitcoin-Standard bringen?
… und selbst wenn …
Und selbst wenn, wenn Maya Präsidentin wird und es schafft, ihre Bitcoin-Ideen durchzusetzen – selbst dann sind die Aussichten eher düster.
Denn Suriname steht beim Internationalen Währungsfonds, dem IWF, tief in der Kreide. Das Volumen des Kreditprogramms ist, in absoluten Zahlen, mit 430 Millionen Dollar eher mittelklein, es ist aber, in Proportion zu Einwohnern und Wirtschaftskraft, gewaltig. Die Schulden beim IWF entsprechen rund einem Siebtel des Bruttoinlandsprodukts, 700 Dollar je Einwohner.
Der IWF hat nun, wie wir wissen, nicht viel Liebe für Bitcoin. Selbst El Salvador, ein größeres und besser organisiertes Land, musste klein beigeben und das Bitcoin-Projekt abwickeln, um eine weitere Kreditlinie zu bekommen. Selbst El Salvador – mit gesundem Wachstum, wenig Inflation und einer viel geringen Schuldenquote – schaffte es nicht, unabhängig vom IWF zu werden.
Wie soll es dann Suriname schaffen? Die Aussichten sind nicht besonders gut, weder für einen Bitcoin-Standard noch für einen Bitcoin-Staatsfonds.
Aber wer weiß? Vielleicht gelingt es Maya, die Politik für Bitcoin zu öffnen, und wenn es nur kleine Schritte sind, die nur einen Teil des gewaltigen Potenzials einlösen, das Bitcoin für das Land hat. Aber man sollte nicht zu viel erwarten.











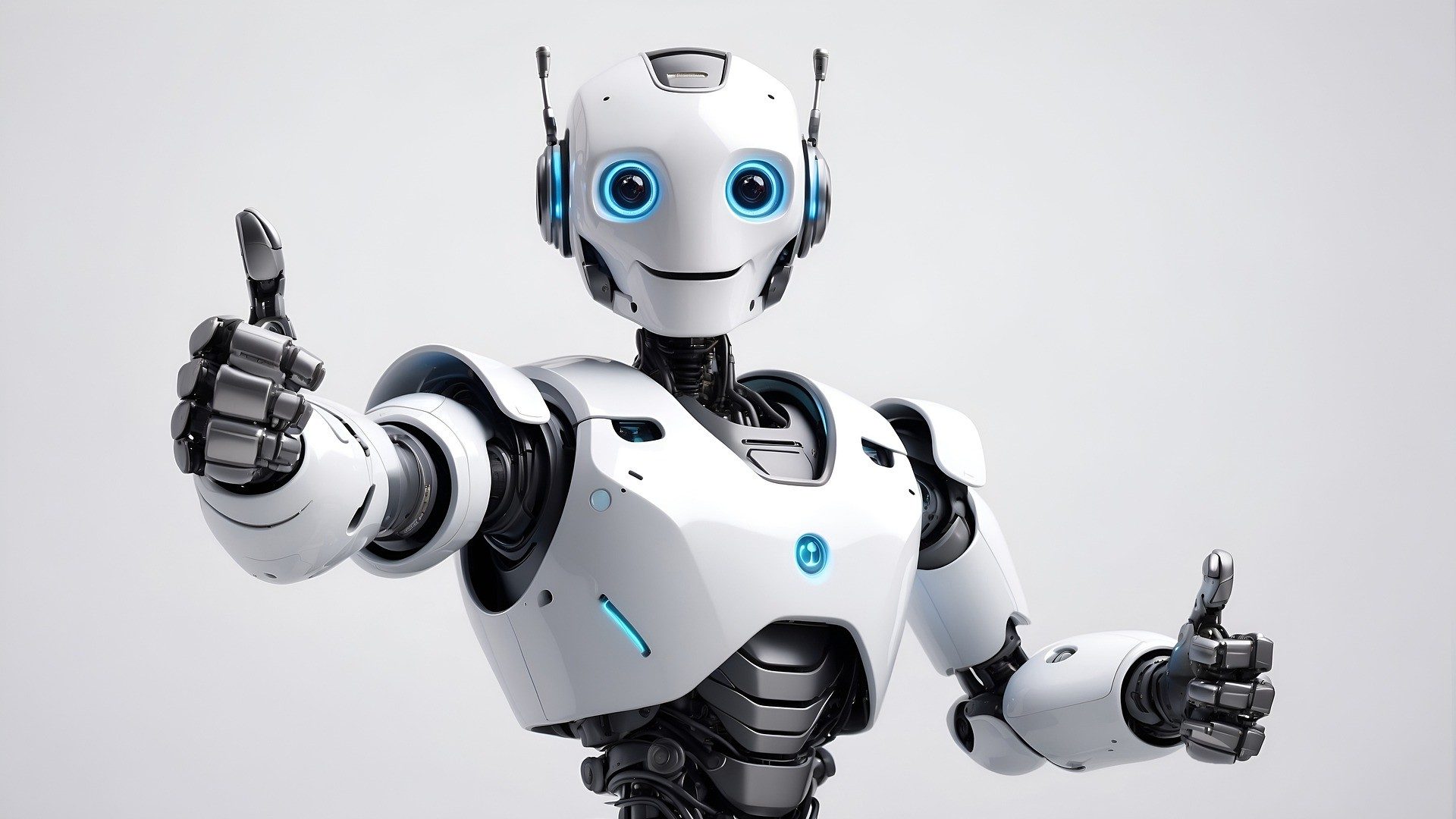


:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/aa/be/aabe28802bb6011fa4674c0846129ada/0124123611v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/b5/c4b5f9ba2c6a913088a84b641e36de3f/0124266663v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/de/f0/def067848e797d06aca429fd2ba256d6/0124161043v2.jpeg?#)








,regionOfInterest=(421,235)&hash=563d7ceba99c8538c47d3677e79ea117ac082439800358d71d2b276656adf34a#)
,regionOfInterest=(252,185)&hash=09053a2fb809e5c3a74b9c989deb989d3bc278d8228766a50920fe218474a604#)