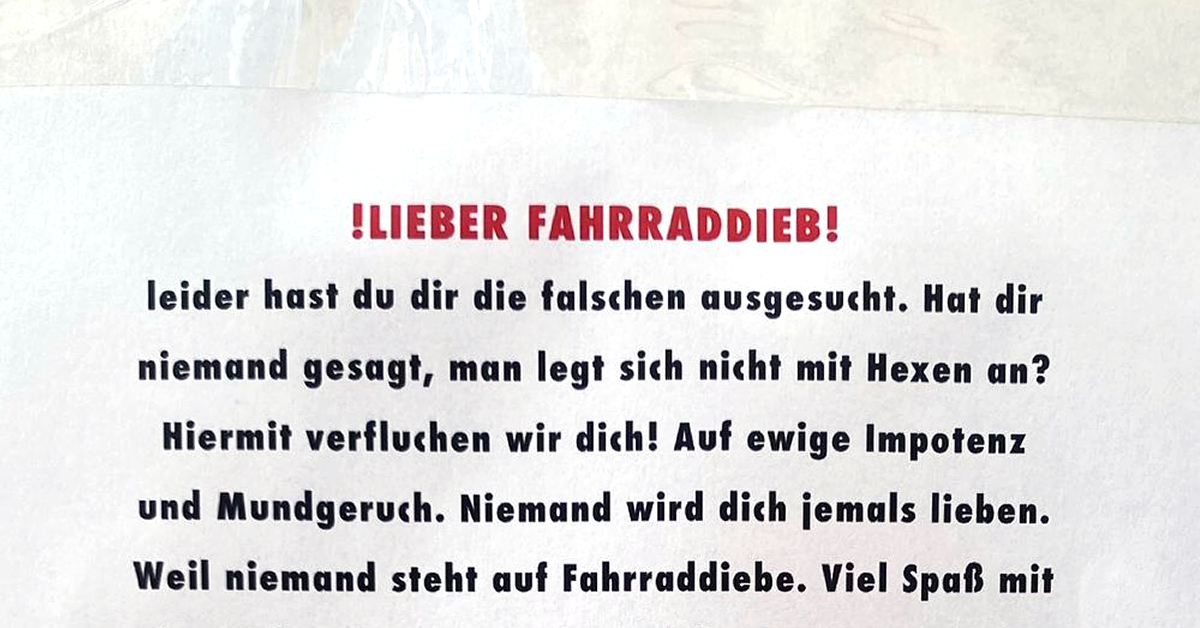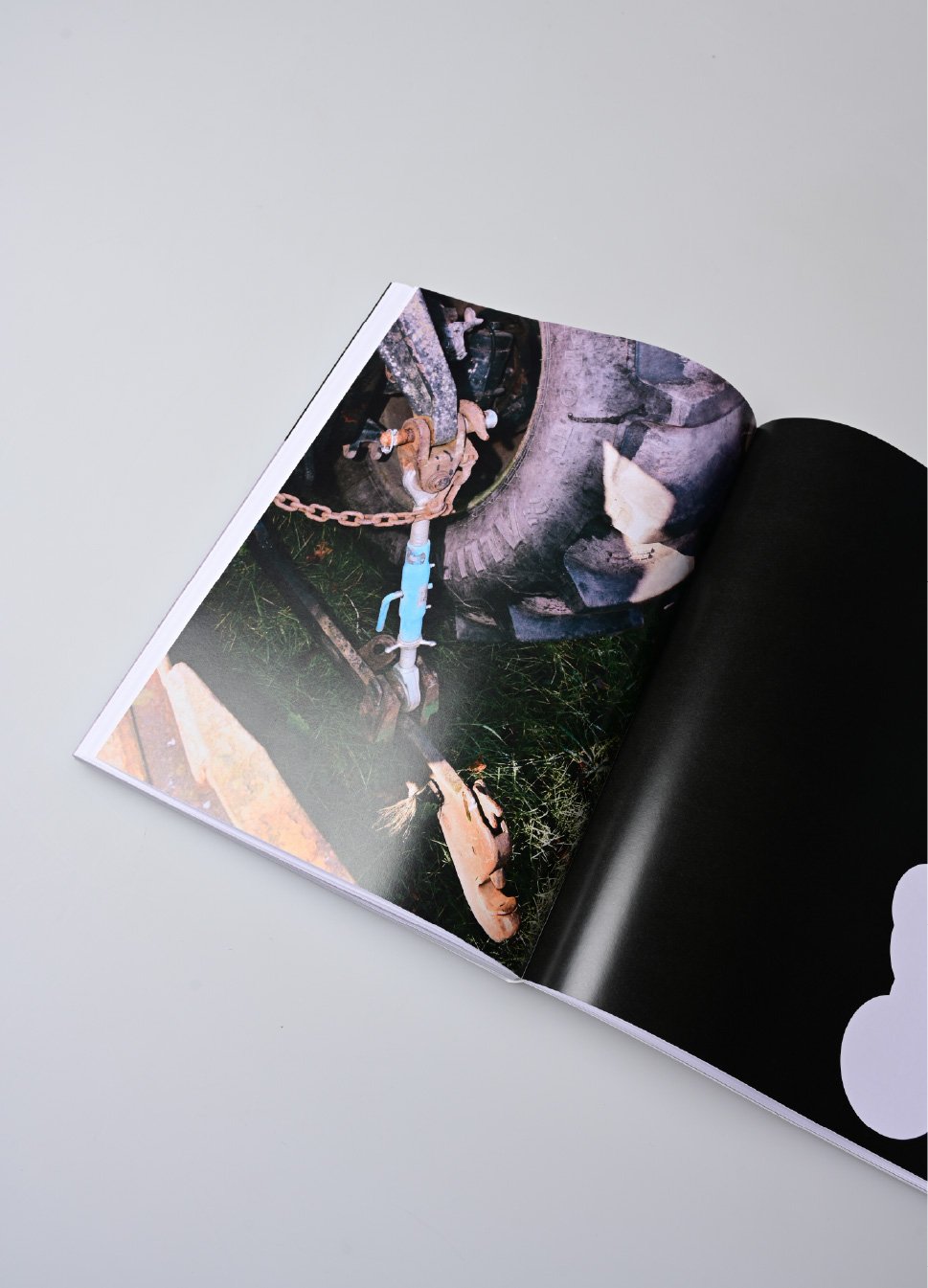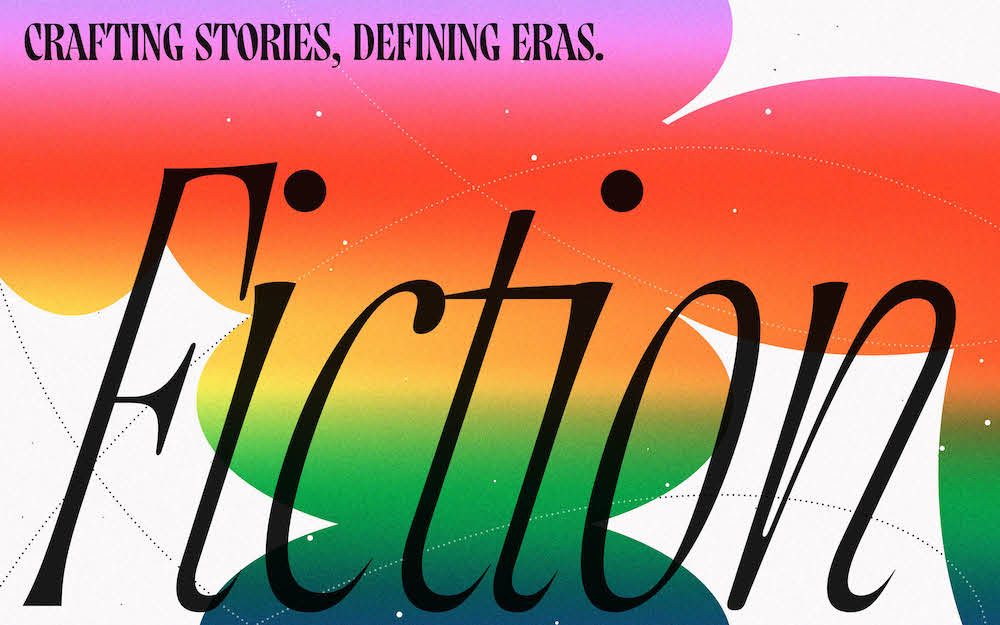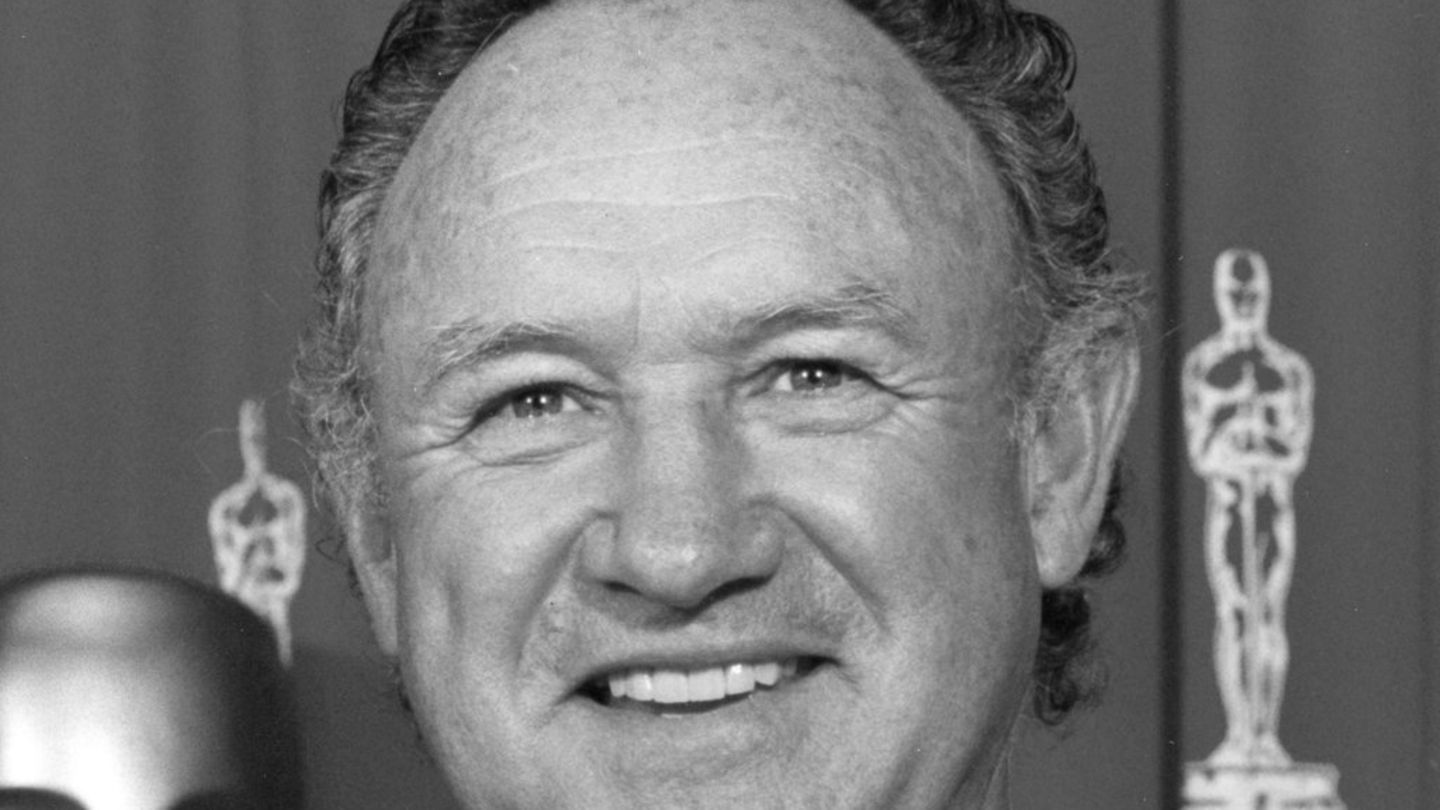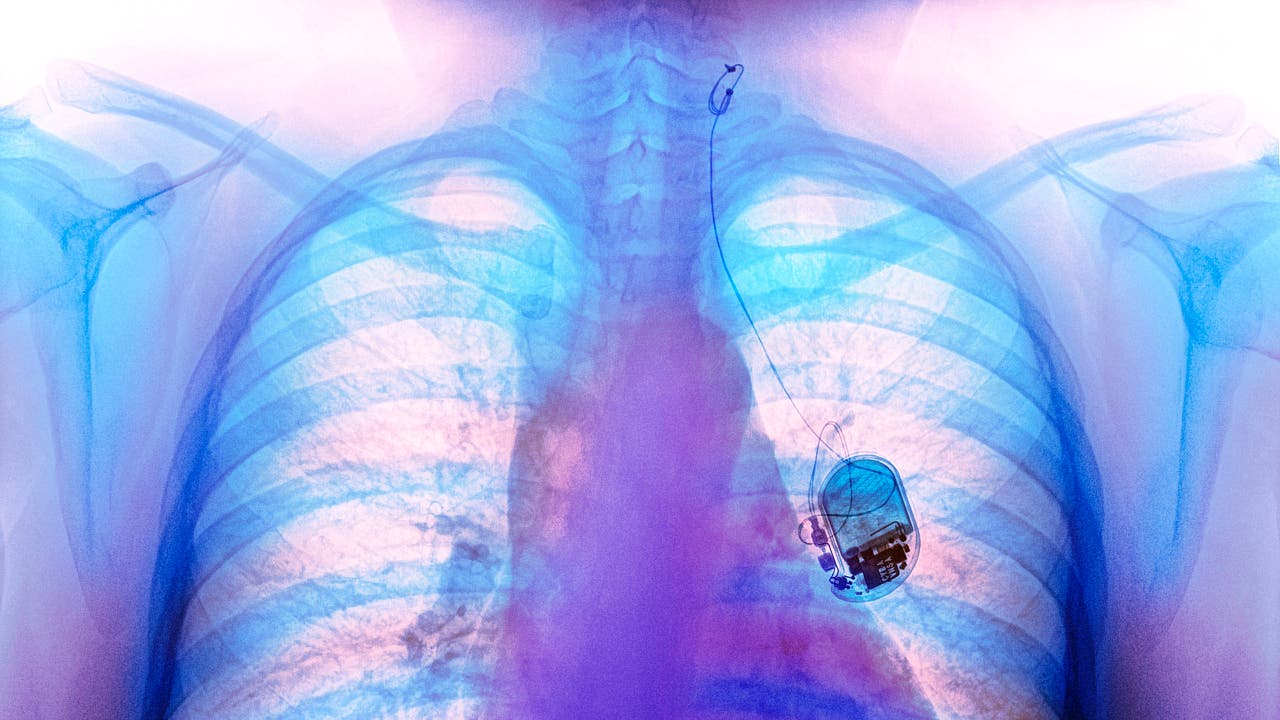Auf Reisen – 45. Spurenworkshop in Salzburg [blooDNAcid]
Ende Februar findet jedes Jahr der Spurenworkshop der Spurenkommission der DGRM statt. Zur Erinnerung: Der historische Zweck des Spurenworkshops war, die Ergebnisse der beiden jährlichen GEDNAP-Ringversuche für forensisch-molekularbiologische Labore vorzustellen und zu diskutieren. Inzwischen ist die Veranstaltung, die tatsächlich einmal als ganz kleiner Workshop ihren Anfang nahm, aber zu einer großen internationalen Tagung mit Hunderten…
![Auf Reisen – 45. Spurenworkshop in Salzburg [blooDNAcid]](https://scienceblogs.de/bloodnacid/files/2025/03/sw45.jpg)

Ende Februar findet jedes Jahr der Spurenworkshop der Spurenkommission der DGRM statt.
Zur Erinnerung: Der historische Zweck des Spurenworkshops war, die Ergebnisse der beiden jährlichen GEDNAP-Ringversuche für forensisch-molekularbiologische Labore vorzustellen und zu diskutieren. Inzwischen ist die Veranstaltung, die tatsächlich einmal als ganz kleiner Workshop ihren Anfang nahm, aber zu einer großen internationalen Tagung mit Hunderten Teilnehmern und zahlreichen Industrieausstellern geworden, auf der auch immer etliche wissenschaftliche Vorträge präsentiert werden und seit 2024 steht nun auch ein „neuer“ Ringversuch und die Diskussion von dessen Ergebnissen im Zentrum.
Das letzte Mal waren wir in Frankfurt wo meine Doktoranden Kathrin, Annica und der Medizindoktorand Dagobert über eine Methode zur Identifikation forensisch relevanter Organgewebe (Kathrin), ein „spin-off”-Produkt ihres Doktorthemas, in dem wir untersucht hatten, warum es so schwierig ist, RNA aus der Spurenart Speichel mittels MPS zu analysieren (Annica) und über eine Meta-Analyse zum „Shedder Status“ oder besser: der „individuellen Abscheideneigung“ (Dagobert) gesprochen hatten.
Dieses Jahr ging es also nach Salzburg. Die Anreise war ein bißchen stressig, weil ich ja am Vorabend noch einen Vortrag in meiner Lieblingsstadt Wien hatte und daher erst um Mitternacht – bei strömendem Regen – mit dem Zug in Salzburg ankam. Am nächsten Tag, an dem ich, wie in den Jahren zuvor, 7 Stunden mit dem Abhalten von Fortbildungsveranstaltungen für unsere Community verbrachte, präsentierte sich Salzburg wesentlich freundlicher: als eine sehr nette, schöne, perfekt gelegene Stadt von angenehmer Größe, die auch im Abendlicht etwas hermacht:

Wie damals schon in Innsbruck liebe ich es ja, wenn man von den Straßen aus die Berge um sich herum sehen kann. Natürlich hat mir aber auch die Allgegenwart Mozarts sehr gefallen und damit meine ich nicht das wirklich penetrante Merchandise (man bekommt in Salzburg alles (!) mit Mozartschriftzug oder -konterfei), sondern daß hier seine Wohn- und Geburtshäuser, aber auch Straßen, Plätze, Museen und Statuen an dieses unbegreifliche, unsterbliche Genie erinnern.


So bin ich fest entschlossen, noch einmal mit mehr Zeit und Muße nach Salzburg zurückzukommen.
Am Donnerstagabend nach den Fortbildungen gab es ein get-together im M32 über den Dächern Salzburgs mit phantastischer Aussicht und am Freitagmittag, nach den Usermeetings der Industrieaussteller, begann das wissenschaftliche Programm, das diesmal keinen von mir wahrnehmbaren inhaltlichen Schwerpunkt hatte.
Faszinierend fand ich das von J. Berger vorgestellte Projekt aus der Rechtsmedizin Bern. Dort haben sie ein (extrem teures) DEP-Array-Gerät, mit dem man Zellgemische trennen und einzelne Zellen nach ihrem Typ (z.B. Blutzellen) isolieren kann. Das nutzen sie, um aus solchermaßen vereinzelten Zellen DNA-Profile zu erzeugen. Oft sind diese Profile aber nicht vollständig, weisen System- oder Allelausfälle auf. Man kann dann aber aus (unvollständigen) Profilen mehrerer Einzelzellen (aus derselben Teilspur) sog. „Kompositprofile“ (,die dann wiederum vollständig sind,) generieren. Die Gruppe entwickelte ein statistisches Verfahren für die Erstellung solcher Profile, zeigte, daß es auch für haploide Zellen (Zellen mit einfachem Chromosomensatz wie z.B. Spermien) funktioniert und hat sogar Richtlinien vorgelegt, die sich auch für mittels anderer Methoden (als dem DEP-Array) isolierte Einzelzellen anwenden lassen.
Auch sehr spannend war der Vortrag von L. Schmelzer aus der Rechtsmedizin Freiburg. Sie hatte versucht, die Körperflüssigkeitsbestimmung mittels Methylierungsanalyse mit der standardmäßigen STR-Analyse zur Identifizierung von Personen zu vereinen, um weniger Spurenmaterial verbrauchen zu müssen, aber auch, um Körperflüssigkeitskomponenten in einer Mischung einer bestimmten Person zuordnen zu können (s. auch Jans Vortrag unten). Das ist nicht einfach, da die differentiell (körperflüssigkeitsspezifisch) methylierten DNA-Bereiche ja in unmittelbarer Nähe der bzw. in den STR-Systemen gesucht werden mußten. Dennoch haben sie in 18 STR-Systemen solche differentiell methylierten Positionen gefunden und konnten zeigen, daß es grundsätzlich möglich ist, die Informationen „STR-Allel X“ und „Methylierungsgrad Y“ aus demselben DNA-Abschnitt simultan zu erheben. Allerdings ist ihre Methode sehr kompliziert, da sie nicht nur die nicht unproblematische Bisulfitkonvertierung sondern auch den Einsatz von MPS und aufwendigen biostatistischen Analyseverfahren erfordert.
Etwas „außer der Reihe“ war der interessante forensisch-entomologische Vortrag von L. Thümmel aus Frankfurt: um die Art der leichenbesiedelnden Insekten, die Puparien (also Puppenreste, nachdem das fertige Insekt daraus geschlüpft ist) auf einem Leichnam hinterlassen haben. Eine Liegezeitbestimmung ist damit, im Gegensatz zu aufgefundenen noch lebenden Insekten (z.B. Puppen) nicht möglich, wenn man aber die Art bestimmen kann, kann wenigstens auf die Jahreszeit der Eiablage oder bestimmte saisonale Aktivitätsphasen geschlossen werden. Unter dem Mikroskop können jedoch selbst erfahrene Entomologen aus einem Puparium nicht zuverlässig auf die entsprechende Insektenart schließen. Daher nutzte die Gruppe abgeschwächte Totalreflexions-Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (ATR-FTIR), um aus der damit erfassbaren biochemischen Information, (frische und gealterte) Puparien vierer relevanter leichenbesiedelnder Fliegenarten zu unterscheiden. Unter Einsatz eines auf Stützvektoren basierenden statistischen Modells gelang das mit einer Genauigkeit von 97%. Hinzukam, daß auch die die frischen von den gealterten Puparien mit hoher Genauigkeit unterscheiden ließen, so daß evtl. mit diesem Verfahren eine genauere Eingrenzung des Todeszeitpunkts bei sehr langen Leichenliegezeiten gelingen könnte. Thümmel erhielt am Ende sogar den „Peter-Schneider-Young-Scientist-Award“ für den besten Vortrag.
Auch Jan, mein ehemaliger Doktorand aus Kiel, hat einen Vortrag gehalten. In Kiel sind sie, nachdem ich weg bin, nämlich, was mich sehr freut, der forensischen RNA-Analyse treu geblieben (Jan hat kürzlich sogar eine DFG-Förderzusage für ein Projekt zur forensischen RNA-Analyse erhalten, was ich ganz phantastisch finde!) und er berichtete daher von einem RNA-basierten Verfahren, das nicht die aufwendige MPS-Methode erfordert, um bei Spurenmischungen, die unterschiedliche Körperflüssigkeiten, darunter Speichel, enthalten, den Speichel einer bestimmten Person zuordnen zu können (treue Leser wird das an das Projekt von Doktorand Max erinnern (hier beschrieben, s. auch [1]), da ging es um eine ähnliche Fragestellung, nur für alle relevanten Körperflüssigkeiten, wozu aber die teure und aufwendige MPS-Methode eingesetzt werden muß, die nicht überall verfügbar ist; die Kieler Methode kann man hingegen auch in einem Standard-Labor einsetzen).
Und ja, er hat immer noch einen guten T-Shirt-Geschmack  Weiterlesen
Weiterlesen












:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/81/bb818e1bdddd5bedf0c7b942fe8d5988/0123358373v1.jpeg?#)



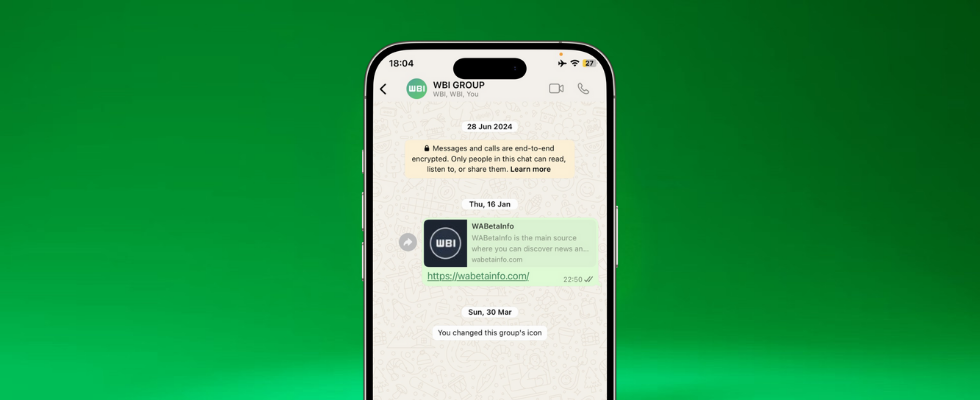


:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d1/22/d122b73b7f9be7a99616009871c601ad/0124369392v2.jpeg?#)



,regionOfInterest=(264,143)&hash=f738bdb2bf278bf58f3bc757afebffa0aeb62e1bfa971c195e7c7d9494e9d3d7#)

![Nina Warken wird Bundesgesundheitsministerin [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)