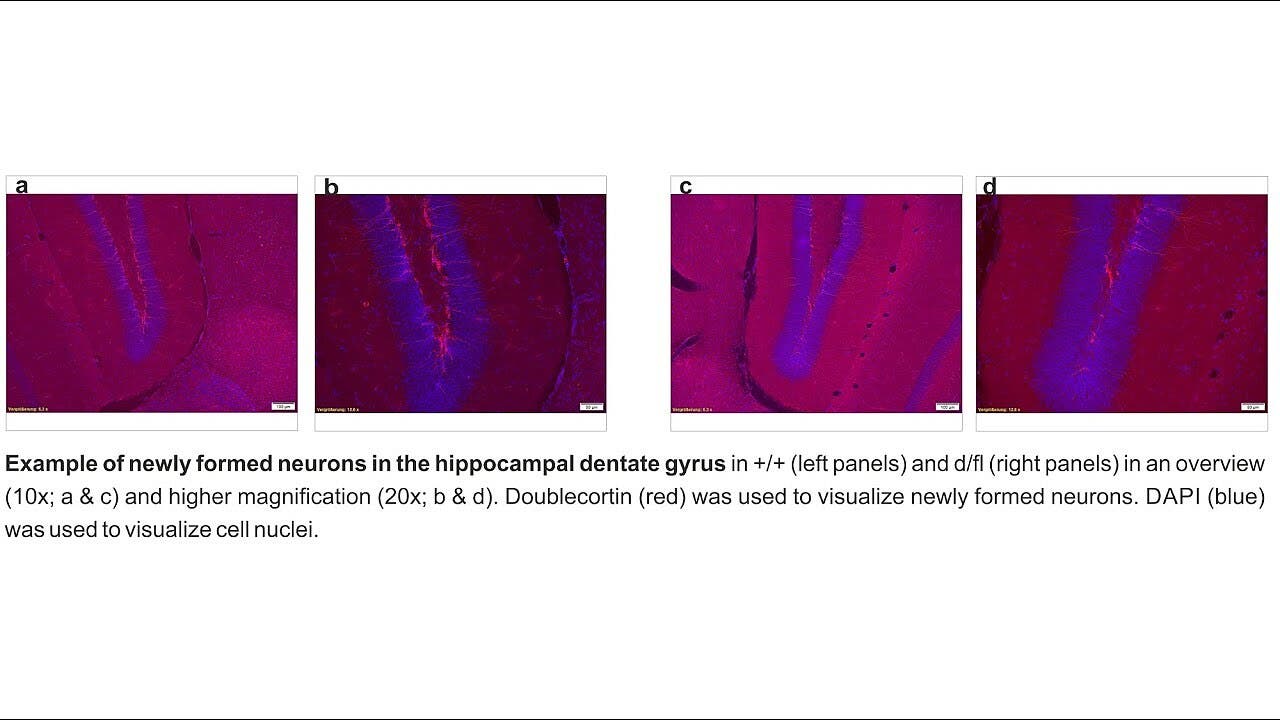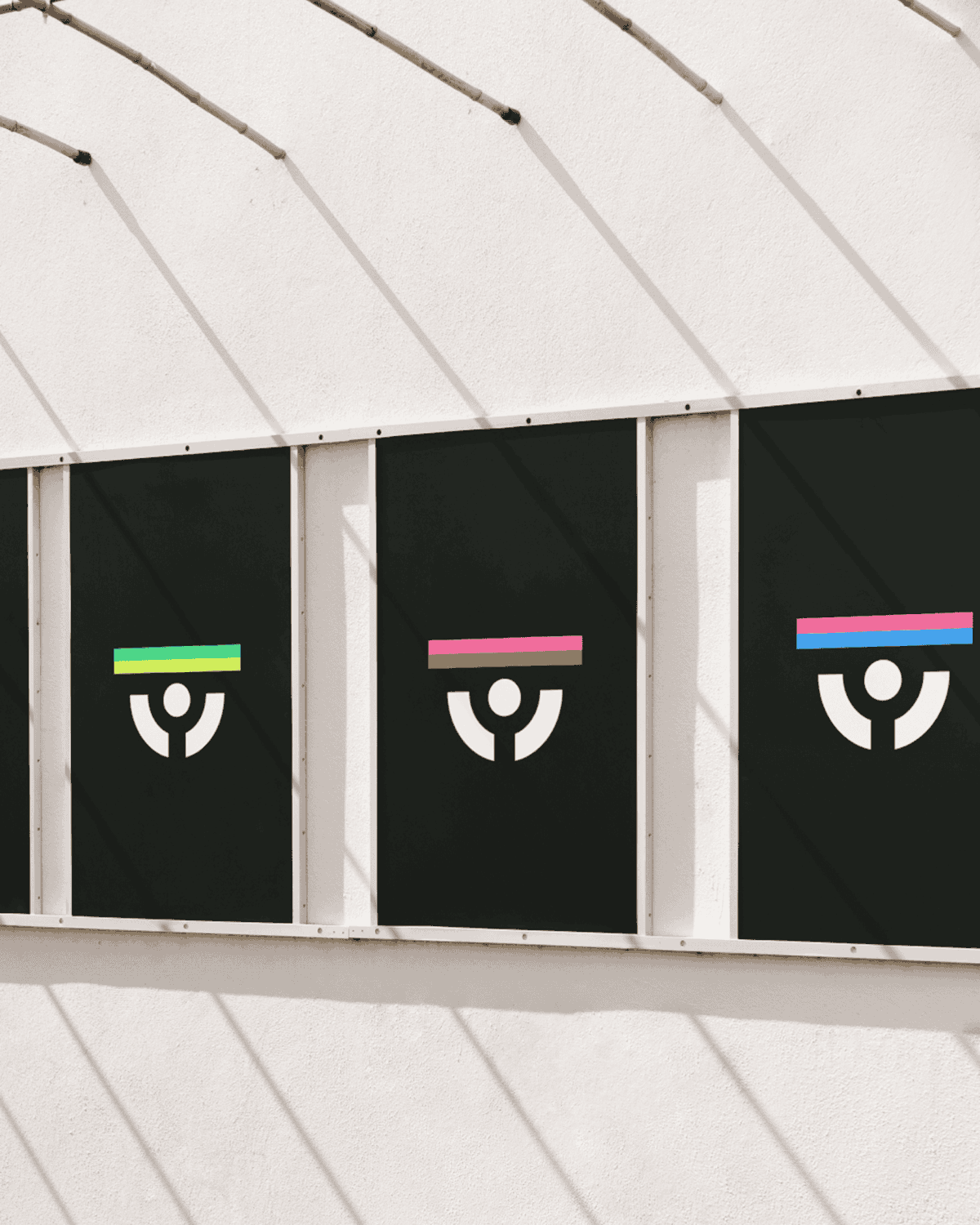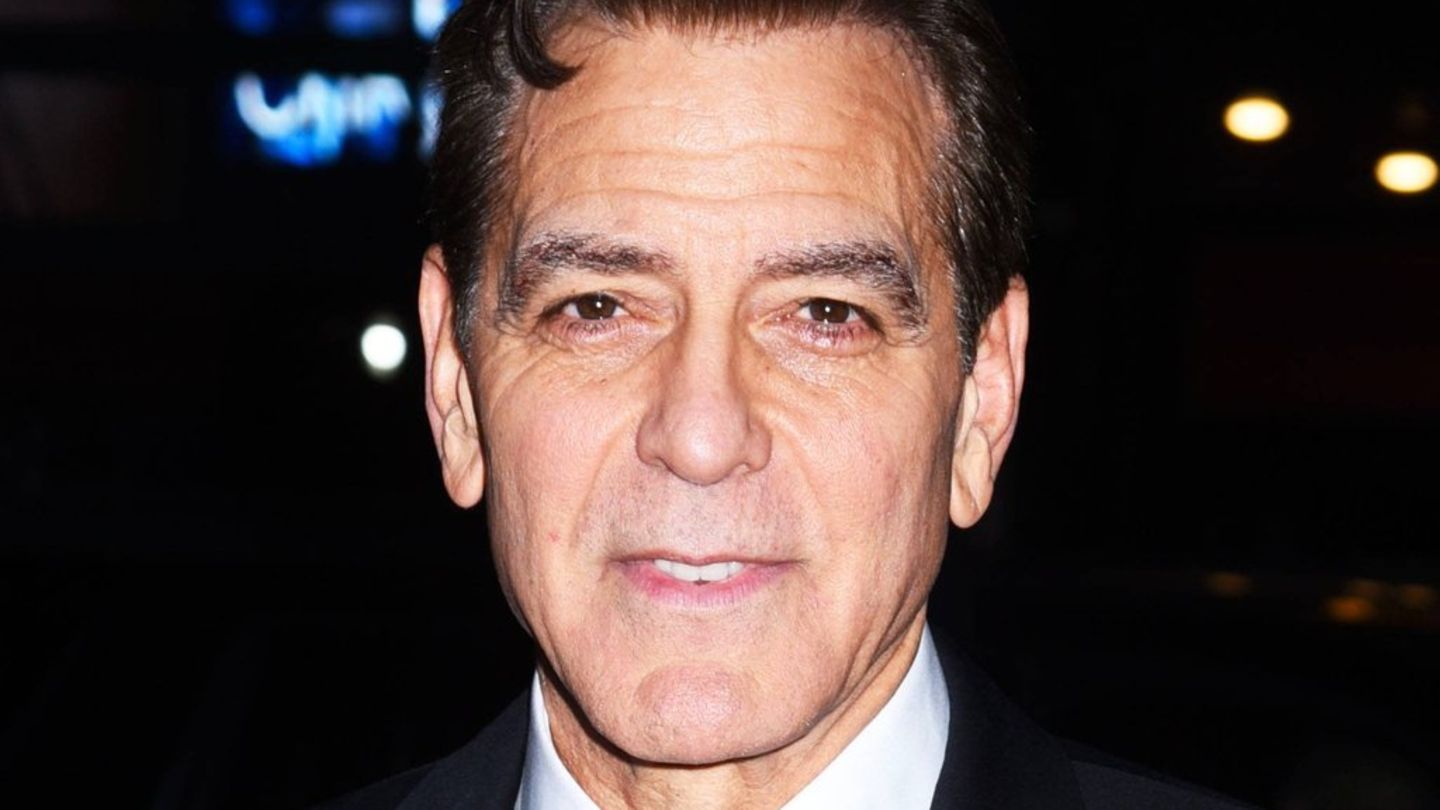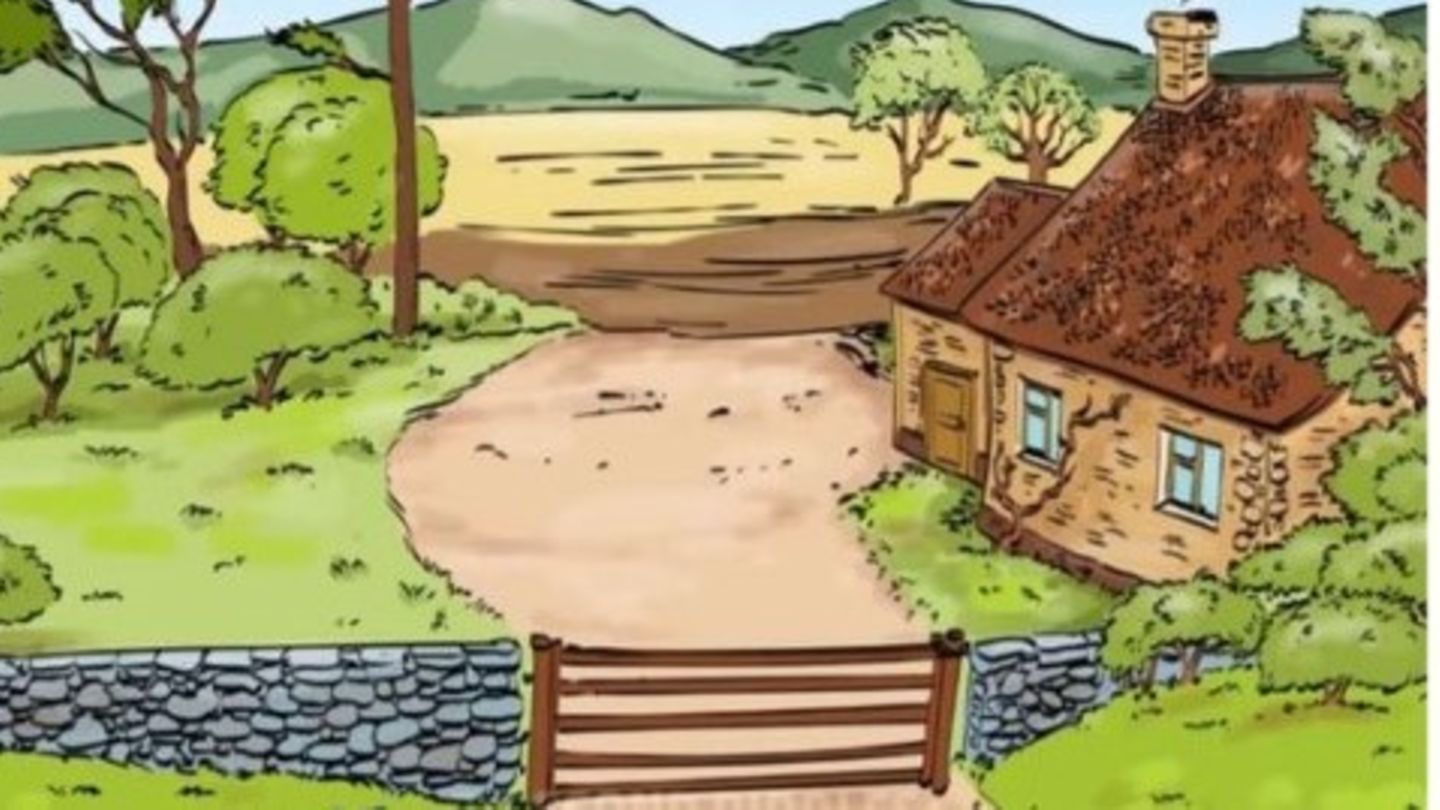Arbeitskampf: So erstreikten sich Arbeiter den ersten deutschen Tarifvertrag
Der 1. Mai ist Tag der Arbeit – und damit auch ein Feiertag für Gewerkschaften. Der Grundstein der deutschen Streikgeschichte wurde vor fast 150 gelegt. Ein Rückblick

Der 1. Mai ist Tag der Arbeit – und damit auch ein Feiertag für Gewerkschaften. Der Grundstein der deutschen Streikgeschichte wurde vor fast 150 gelegt. Ein Rückblick
Wer sich die Bilanz des ersten großen Streiks im Deutschen Reich anschaut, der wird sehen, dass die Arbeiter damals viele Dinge erstritten, die in der heutigen Arbeitswelt als Selbstverständlichkeit gelten. 1873 legten die Buchdrucker ihre Arbeit nieder, vier Monate dauerte der Ausstand. Aber am 8. Mai endete der Arbeiterprotest mit der Unterschrift unter dem ersten flächendeckenden Tarifvertrag der deutschen Geschichte.
Dieser sah vor, dass sich der Preis der Druckerarbeit fortan nach Schriftgattung regelte, dass die Arbeiter einen Mindestlohn erhalten sollten, dass die Arbeitszeit pro Tag auf zehn Stunden begrenzt sein sollte, dass Überstundenzuschläge ausgezahlt werden sollten und dass die Arbeiter nicht einfach auf der Straße landen konnten, sondern eine 14-tägige Kündigungsfrist hatten.
283 Streiks hat das Jahr 1873 in Deutschland insgesamt gesehen. Zwei Jahre nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches steckte die Wirtschaft in einer Zeit radikalen Umbruchs. Im letzten Drittel des 19. Jahrhundert veränderte sich das bis dahin noch fast ausschließlich agrarisch geprägte Land zu einer Industrienation. Zwischen 1871 und 1914 versechsfachte sich die industrielle Produktion, auch die Exporte des jungen Landes nahmen um das Vierfache zu.
Es war ein Krieg, der den Deutschen einen gigantischen Sprung nach vorne bescherte. 1870 zogen Deutschland und Frankreich gegeneinander ins Feld. Frankreich verlor ein Jahr später und musste daraufhin fünf Mrd. Franc Reparaturen an die Deutschen abtreten. Zuerst entstand nach dem Krieg 1871 das Deutsche Reich, dann schossen überall in Deutschland große Geschäftsbanken aus dem Boden. Das erste Mal gab es viel Geld für langfristige und große Investitionen.
Die Wirtschaft floriert, die Belegschaft krepiert
Aus dem Land, in dem bis dahin hauptsächlich kleine Betriebe existiert hatten, wurde eines der Konzerne wie Thyssen, wie Krupp, wie AEG oder Siemens. Die Börsenkurse schienen nur eine Richtung zu kennen: steil bergauf. Das Bürgertum erfasste ein Spekulationsfieber, Spekulationen trieben Boden- und Mietpreise immer weiter nach oben. Die Wirtschaft geriet in einen Rausch, auch Gründerboom genannt.
Doch schnell folgte auf den Rausch der Kater – und den bekamen vor allem die Schwächsten der deutschen Bevölkerung zu spüren. Während die Wirtschaft florierte, blieben die Bedingungen in den Fabriken und Produktionsstätten schlecht. Schichten von 12 bis 14 Stunden waren an der Tagesordnung, freie Wochenenden gab es nicht, die Arbeit am Band war gefährlich, immer wieder kam es zu Unfällen, bei denen viele Arbeiter ums Leben kamen. Die soziale Ungleichheit hatte die Menschen fest im Griff. In den großen Städten lebten sie unter fürchterlichen Bedingungen, in überfüllten Mietskasernen. Krankheit, Elend, Tod waren die Folge.
Doch bald begannen die ersten Arbeiter ihrem Unmut durch Streiks Ausdruck zu verleihen. Die Wirtschaftskrise, die 1873 auf den Boom folgte war dann das Ende der Party für alle. Doch auch der „Gründerkrach“, der auf die Hochzeit folgte, traft besonders die Arbeiter schwer. Denn in vielen Unternehmen verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen weiter und trieb die Arbeiter wiederum auf die Straßen. Um sich besser zu organisieren, gründeten sie Parteien, Verbände, Gewerkschaften.
Sozialistengesetze als Streikbrecher
Die oberen Gesellschaftsschichten beobachteten diese Entwicklung mit Missfallen. Denn die Arbeiterbewegungen wuchsen immer schneller – und mit ihnen die Angst des Bürgertums vor einer Revolution: Autoren wie Marx und Engels prägten mit ihren Werken die Idee von der Diktatur des Proletariats. Und schließlich erschütterten zwei Anschläge auf den Kaiser 1878 die politische Elite – nicht zuletzt weil man die Attentate der Sozialistischen Arbeiterpartei zuschrieb.
Reichskanzler Otto von Bismarck reagierte auf die Entwicklungen mit dem Gesetz „wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“. Mit diesem Sozialistengesetz verbot Bismarck sozialistische Parteien, Organisationen, Druckschriften und politische Versammlungen.
Doch der Zorn der Straße ließ sich auch nicht durch Verhaftungen zügeln. Nachdem 1872 das erste Mal die Arbeiter im Ruhrgebiet in den Ausstand traten, nahm der Arbeitskampf kein Ende mehr. 1889 – also noch während der Sozialistengesetze – gingen im Ruhrgebiet fast 90.000 Menschen auf die Straße, um gegen die sozialen Missstände zu demonstrieren. 14 Menschen starben bei den Auseinandersetzungen. Und weil die Sozialistengesetze ihre Wirkung verfehlten, wurden sie bald nicht mehr verlängert. Längst waren die Arbeiterbewegungen zu den stärksten politischen Kräften des Landes geworden, nur hatten sie ihre Hand eben nicht am Kapital.
Der Arbeitskampf nimmt zu
Der Arbeitskampf dauerte weiter an, und nahm in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg sogar noch weiter zu. Von 1896 bis 1904 waren fast eine Million Arbeiter an Streiks beteiligt, zwischen 1905 und 1914 waren es rund zwei Millionen. Mal legten die Textilarbeiter, mal die Hafenarbeiter, dann wieder die Bergarbeiter die Arbeit nieder. 1906 folgte schließlich der erste politische Streik Deutschlands. 80.000 Arbeiter protestieren gegen die Einschränkung ihres Wahlrechts durch eine Reform, die den Stimmen von Nierdrigverdienern weniger Gewicht gab.
Doch all das ist nichts verglichen mit den Streiks, die nach dem Ersten Weltkrieg auf das Land zukommen sollten. In den wirtschaftlichen Turbulenzen der Weimarer Republik wurde der Streik zu einem fast alltäglichen Mittel des Arbeitskampfes. Allein im Jahr 1922 gab es mehr als 4700 Arbeitsniederlungen in ganz Deutschland.
Bis in die frühen 30er-Jahre blieb es unruhig in Deutschland. Dann lösten die Nazis die Gewerkschaften und Arbeiterverbände auf. In der Bundesrepublik durfte nach dem Zweiten Weltkrieg zwar wieder gestreikt werden, doch bis auf wenige Ausnahmen, ging es dabei relativ zivilisiert zu.
Jeder Tarifvertrag, der seitdem unterzeichnet wird, ist ein Nachfolger des allerersten, den die Buchdrucker 1873 erstritten haben.
















:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cc/33/cc3393816b43d08b4e2649cc42d26914/0124321622v1.jpeg?#)






:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cc/6e/cc6e604a0f95ebe06907e5cae3e83039/0124347036v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/53/d253f5adf5b46e8f7605c495b2bdd791/0124215186v1.jpeg?#)