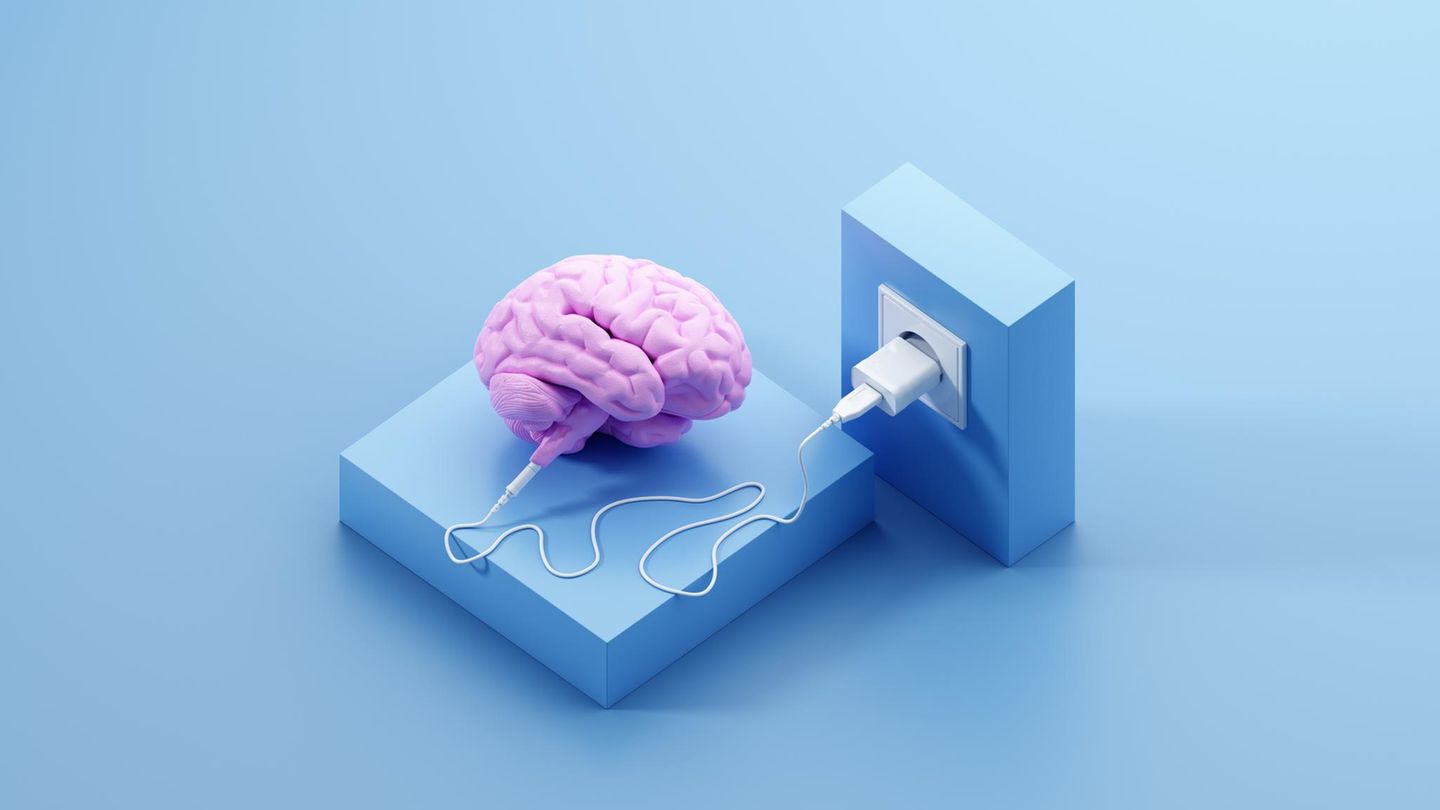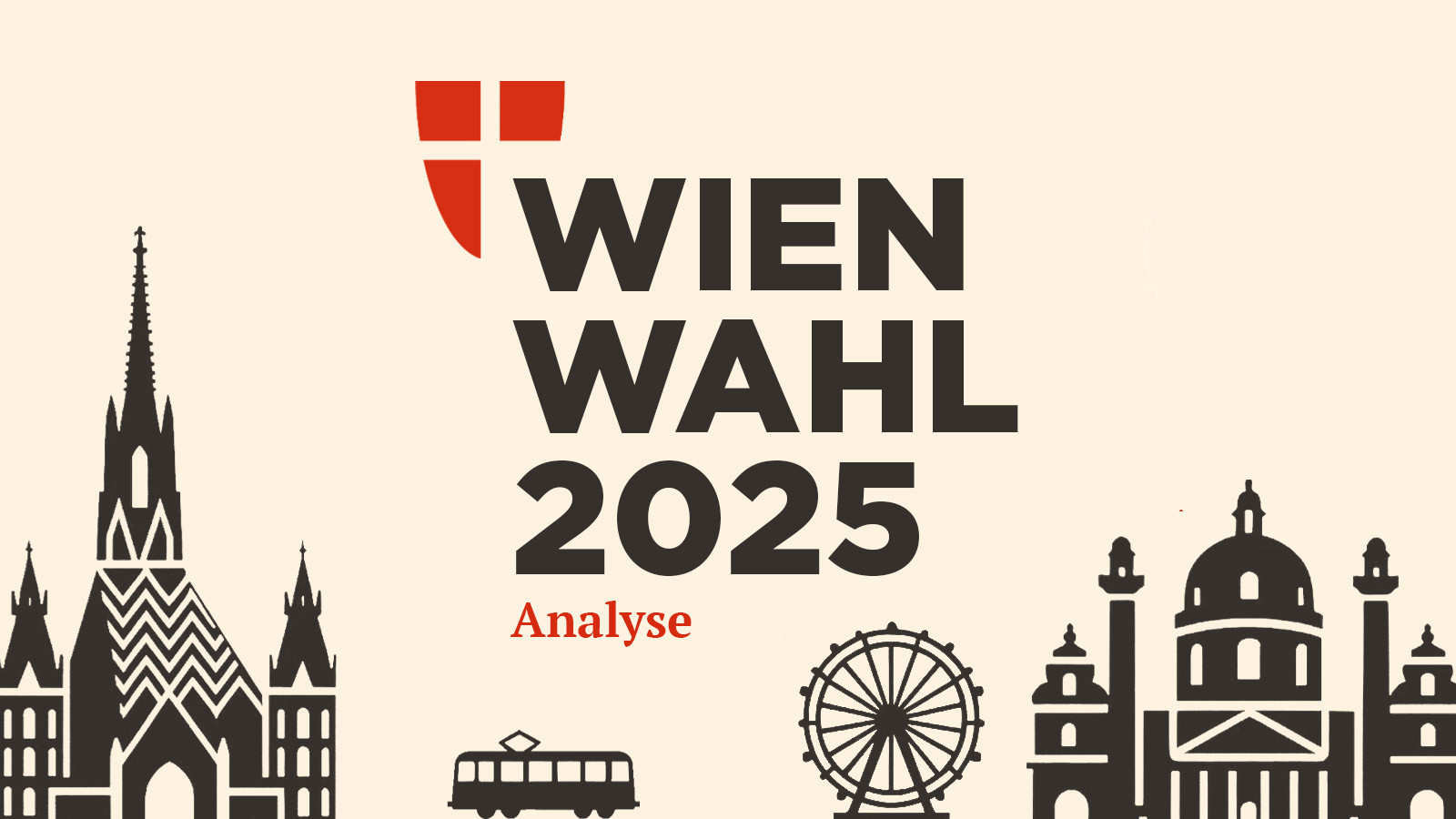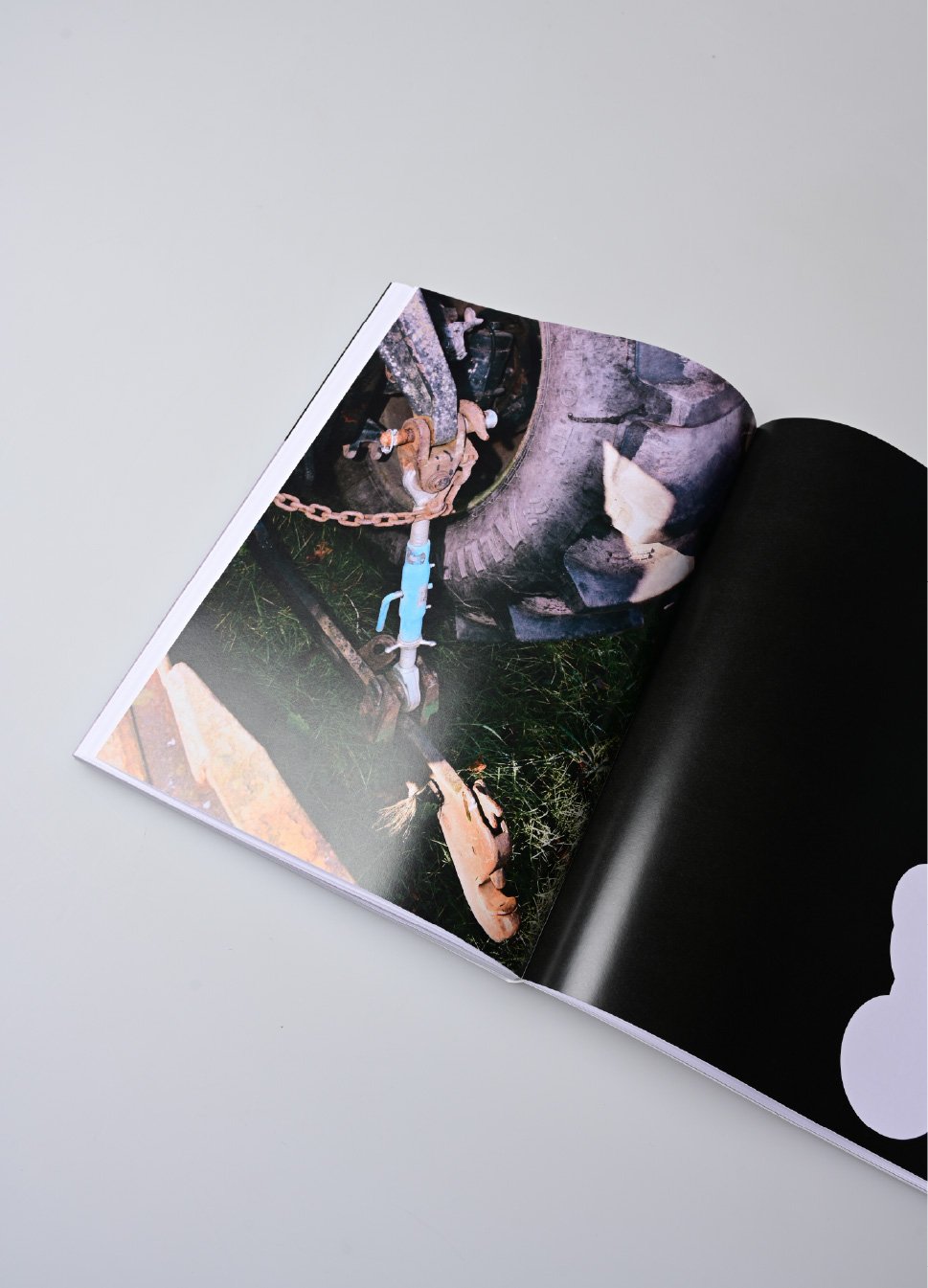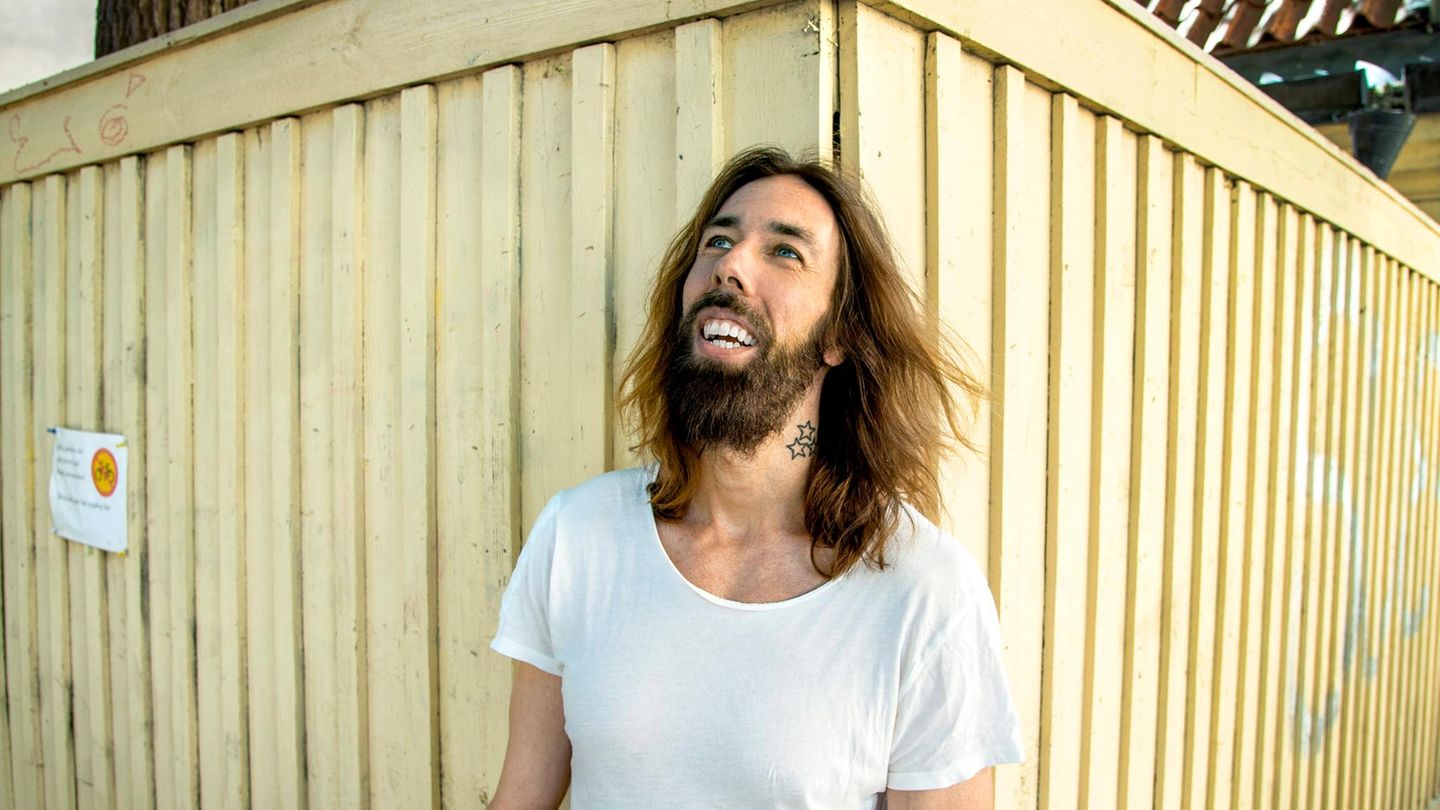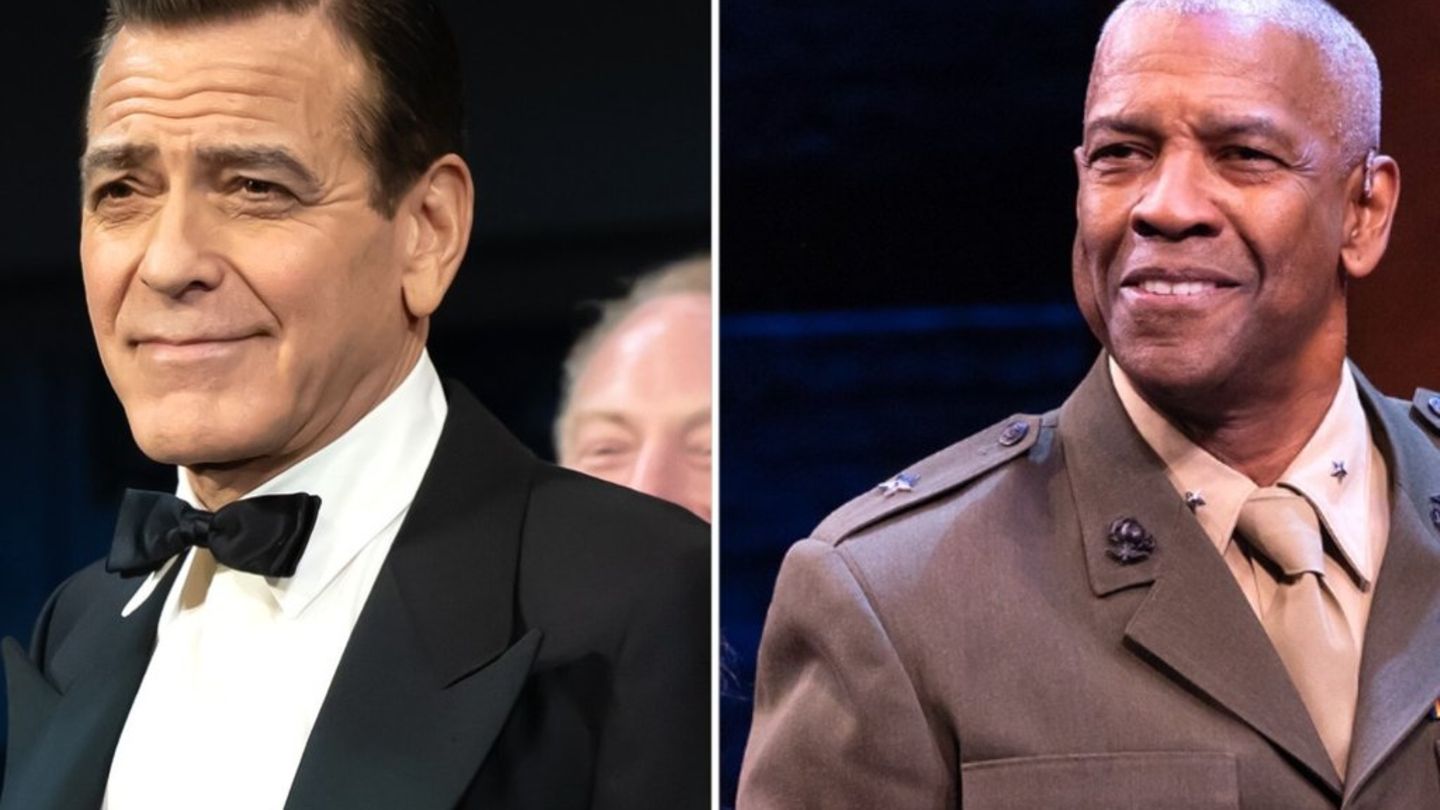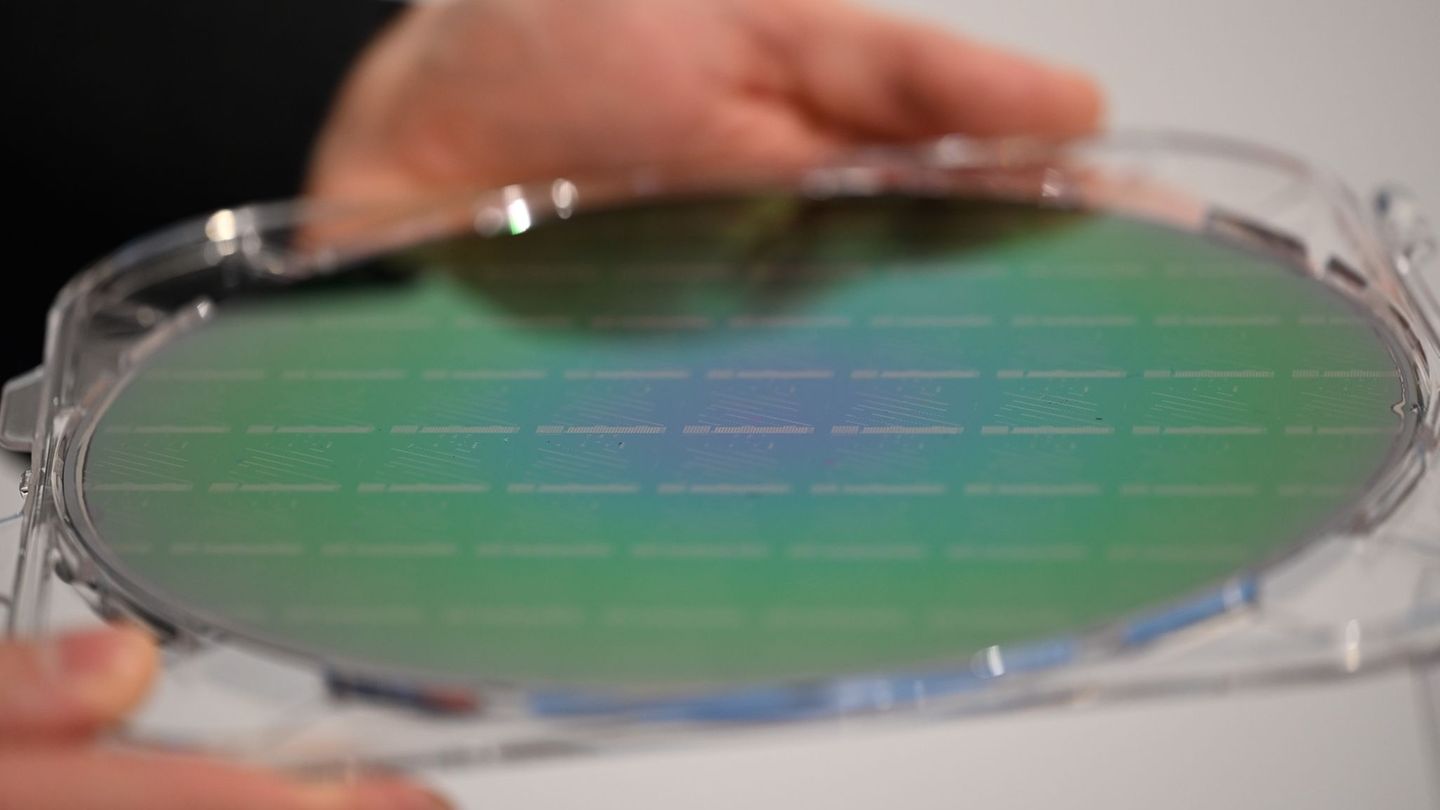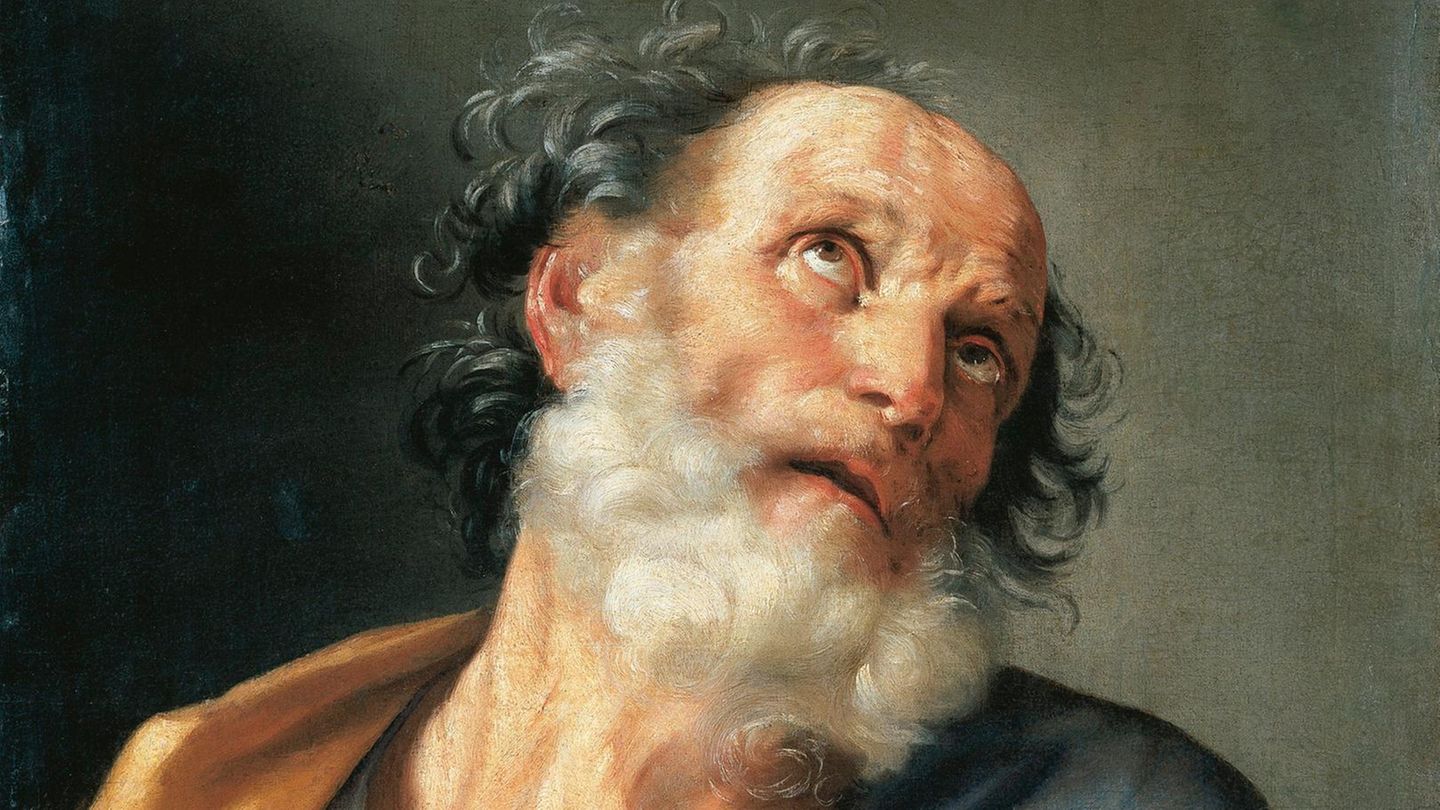Alternativmedizin, Skeptizismus und Relativismus: Neue Texte von Udo Endruscheit
Udo Endruscheits aktuelle Beiträge zusammengefasst: Es geht um Alternativmedizin, Skeptizismus und das Gegenspiel von Relativismus und Rationalismus. Weiterlesen →

Udo Endruscheit schreibt derzeit fleißig zu den Themen Aufklärung, Alternativmedizin und Skeptizimus. Grund genug, einen Blick auf seine jüngsten Texte zu werfen. Seine fünf aktuellen Beiträge werden in diesem Blogbeitrag auszugweise vorgestellt.
Von der staatlich geförderten Märchenmedizin – und dem stillen Rückzug der Aufklärung
In einem Beiträg für den Humanistischen Verband Österreich widmet sich Udo der systematischen Bevorzugung pseudomedizinischer Verfahren in den DACH-Staaten. Er geht dabei sowohl auf den politischen Umgang mit evidenzfernen Heilmethoden ein als auch auf die zunehmende Marginalisierung aufklärerischer Stimmen.
Dass Wissenschaft nicht immer populär ist, wird man hinnehmen müssen. Dass sie aber strukturell benachteiligt wird, während ungesicherte Methoden aufgewertet und geschützt werden, ist ein Symptom tiefer liegender kultureller Abwehrmechanismen.
Gerade in der Schweiz offenbart sich für ihn die Absurdität dieser Praxis besonders deutlich:
Dort zeigt sich die Groteske in nahezu reiner Form: Die Homöopathie hat es trotz ihrer evidenzfreien Natur in die Grundversorgung geschafft – mehrfach wurde ihre Wirksamkeit überprüft, mehrfach lautete das Ergebnis: nicht belegt. Und doch versuchte man jedes Mal aufs Neue, die Quadratur des Kreises zu vollziehen. Die politische Formel lautete sinngemäß:
Wir wissen, dass es nicht wirkt – aber das müssen wir ja nicht auch noch betonen.
Vernünftige Stimmen sind dabei oft auf sich allein gestellt:
Aufklärerinnen und Aufklärer, die sich aus Überzeugung gegen institutionalisierte Irrationalität stellen, oft ohne Rückendeckung, ohne sichtbare Anerkennung. Die ihre eigene Geschichte hinterfragt haben, die sich dem öffentlichen Irrtum entgegenstellen, die nicht schweigen, wenn es leichter wäre. Es sind diese Stimmen, die ein demokratisches Gesundheitswesen eigentlich dringend bräuchte – nicht als einsame Rufer in der Wüste, sondern als Teil eines Diskurses, der Fakten nicht gegen Stimmungen abwägt, sondern Verantwortung ernst nimmt.
Zum vollständigen Beitrag:
Vom guten Willen zur Vernunft
Auch auf Udos eigenem Blog Science and Sense ging es weiter. Im Beitrag vom 08. April fragt er:
In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung, wachsender Wissenschaftsverachtung und politischer Rhetorik ohne erkenntnistheoretisches Fundament steht auch der Skeptizismus vor einer Weggabelung. Ist er lediglich die Kunst des methodischen Zweifelns im Labor des Denkens? Oder darf, ja muss er sich als Haltung in einem weiteren Sinne begreifen – als Mitverantwortung für die Rationalität des Gemeinwesens?
Dabei geht er auch auf den GWUP-Streit des vergangenen Jahres ein, bei dem unter anderem die Forderung nach einem unpolitischen Skeptizismus vorgebracht wurde:
Dabei ist der Gedanke, Skeptizismus dürfe sich nicht politisch positionieren, historisch wie logisch schwer haltbar. Skeptizismus, richtig verstanden, ist nie neutral im Sinne der Inhaltsleere. Er ist parteiisch – für Vernunft, für Transparenz, für Überprüfbarkeit. Was er nicht ist und nicht sein darf: parteipolitisch oder ideologisch gebunden. Gerade daraus erwächst seine republikanische Kraft und Relevanz.
Ein vernünftiger Skeptizismus steht also ganz im Dienste der Wahrheitsfindung:
In diesem Sinne ist Skeptizismus nicht die Überlegenheit der Aufklärer über das Volk, sondern eine demokratische Tugend: die Bereitschaft, sich der Wahrheitssuche zu öffnen, ohne „die Wahrheit“
zu besitzen. Ganz im Popperschen Sinne.
Erkenntnisse müssen jedoch auf politischer Ebene ausgehandelt werden:
Ein moderner Skeptizismus erkennt diese Spannung an. Er unterscheidet zwischen Sachentscheidungen, die auf nachvollziehbarer Evidenz beruhen müssen, und Wertentscheidungen, die einer öffentlichen Auseinandersetzung bedürfen, ohne dabei die Schwierigkeit der Grenzziehung zwischen beiden Sphären zu verkennen. Er fordert Rationalität nicht als Dogma, sondern als Methode der Begründung und des Dialogs. Deshalb ist es auch nicht Sache des Skeptikers, bestimmte Entscheidungen oder Haltungen von der Politik einzufordern. Er ist Anwalt der Ratio.
Möglicherweise schärfen die jüngsten Spannungen in der Skeptikerszene auch den Blick darauf, was den Skeptizismus im Kern ausmacht:
Vielleicht ist genau das der notwendige Schritt in der „Erholungsphase“ vieler Skeptikerorganisationen: ein kleiner republikanischer Neuaufbruch. Nicht in der Pose der Weltverbesserer, sondern in der Haltung derer, die wissen, dass Rationalität keine Selbstverständlichkeit ist. Sondern eine Errungenschaft, die verteidigt werden will.
Hier geht’s zum ganzen Artikel:
Relativismus in der Moderne – ein Überblick – (Erkenntnisrelativismus Teil 2)
In seiner Relativismus-Reihe auf Science and Sense zeichnet Udo nach, wie sich der epistemologische Relativismus im 20. Jahrhundert zu einer einflussreichen Denkrichtung entwickeln konnte. In Teil 1 ging es einleitend um die Spannung zwischen dem kritischen Rationalismus und dem Relativismus. Im zweiten Teil steht vor allem die aufstrebende Relevanz des Relativismus im 20. Jahrhundert im Zentrum von Udos Artikel:
Während der Antike und des Mittelalters blieb er eine marginale Strömung, oft als skeptische Provokation verstanden oder als Denkfigur, die vor allem dazu diente, Argumente gegen einen absoluten Wahrheitsbegriff zu testen. Doch mit dem 20. Jahrhundert änderte sich dies grundlegend: Der epistemologische Relativismus entwickelte sich von einer philosophischen Randerscheinung zu einer einflussreichen Strömung, die in vielen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen prägend wurde.
Das Zeitgeschehen hatte Auswirkungen auf die aufklärerischen Werte:
Die Erschütterung der Aufklärungsideale durch zwei Weltkriege, die Verbrechen totalitärer Regime und das Scheitern von Fortschrittsnarrativen führten zu einem tiefen Misstrauen gegenüber den traditionellen Wahrheitsansprüchen westlicher Rationalität.
Udo gibt noch eine kurze Vorschau auf die nächsten Beiträge der Reihe. Es wird in den Folgeteilen der Reihe um folgende postmodernen bzw. relativistischen Philosophen gehen: Foucault, Lyotard, Derrida, Kuhn/Feyerabend und Judith Butler.
Der ganze Beitrag:
Michel Foucault: Originärer oder missverstandener Relativist? (Erkentnisrelativismus Teil 3)
Teil 3 zu Foucault erschien am Sonntag. Udo leitet ihn dort folgendermaßen ein:
Foucaults Werk konzentriert sich auf die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Wissen und Macht. Er argumentiert, dass Wissen niemals unabhängig von Machtstrukturen existiert, sondern vielmehr durch sie produziert wird.
In Die Archäologie des Wissens (1969) führt er die Methode der Diskursanalyse ein, mit der er untersucht, wie bestimmte Wahrheiten in einem historischen Moment durch Sprache und institutionelle Praktiken erzeugt werden. Später verfeinert er diese Perspektive mit dem Konzept der Genealogie, das er in Werken wie Der Wille zum Wissen (1976) anwendet. Hier zeigt er, dass gesellschaftliche Normen und Wahrheiten nicht das Ergebnis rationaler Einsicht oder wissenschaftlicher Fortschritte sind, sondern durch historische Kämpfe und Machtdynamiken geformt werden.
Auch wenn sich Foucault nicht per se als Relativist verstand, so sorgte er doch dafür, dass sich diese Denkrichtung etablieren konnte:
Foucaults Arbeiten haben unbestritten dazu beigetragen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Wissen nicht neutral ist und dass Wissenschaftsgeschichte oft von Machtinteressen geprägt ist. Doch sein radikaler Historismus führt in der Konsequenz dazu, dass sich kaum mehr Kriterien für eine objektive Unterscheidung zwischen „wahren“ und „unwahren“ Behauptungen finden lassen. Das hat insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu einem stark relativistischen Denken geführt, das sich oft gegen universalistische Wahrheitsansprüche richtet.
Foucaults Wirken bietet zwar fruchtbare Perspektiven, es eröffnet sich jedoch ein Relativismus-Problem:
Genealogie und Archäologie des Wissens sind zweifellos faszinierende Instrumente zur Analyse historischer Diskurse, aber sie tendieren dazu, Erkenntnisprozesse primär als Ausdruck von Machtstrukturen und historischen Kontingenzen zu begreifen. Damit rückt die Möglichkeit eines fortschreitenden Erkenntnisgewinns oder einer Annäherung an objektive Wahrheit, die diese Zeitbedingtheit zunehmend hinter sich lässt, stark in den Hintergrund.
Zum vollständigen Text:
Jean-François Lyotard: Das Ende der großen Erzählungen? (Erkenntnisrelativismus Teil 4)
Ganz frisch erschienen: Udos Beitrag zu Lyotard. Der Begriff der Metanarrative ist bei Lyotard zentral:
Was meint Lyotard mit „Metanarrativen“? Gemeint sind die großen Sinn- und Geltungserzählungen der Moderne – etwa der Fortschrittsglaube der Aufklärung, der Historismus des Marxismus, die universelle Vernunft der Wissenschaft oder auch die Idee des gesellschaftlichen Fortschritts durch technische Rationalität. All das wird bei Lyotard nicht in erster Linie „widerlegt“, sondern delegitimiert – weil es seiner Ansicht nach den Anspruch erhebt, Wahrheit zu „besitzen“ und damit andere Stimmen zu marginalisieren.
Es ergeben sich epistemologische Schwierigkeiten:
Lyotard plädiert für eine Pluralität von „Sprachspielen“, die nicht auf einen einheitlichen Maßstab gebracht werden können. Dabei übernimmt er Wittgensteins Idee der kontextabhängigen Sprachspiele, überspitzt sie jedoch in Richtung eines unversöhnlichen Nebeneinanders.
Für den erkenntnistheoretischen Diskurs birgt das aber erhebliche Gefahren: Wenn sich Wissenschaft nicht mehr durch methodisch begründbare Geltungsansprüche auszeichnen darf, sondern nur noch als eines von vielen gleichwertigen Sprachspielen gilt, dann droht nicht Vielfalt, sondern Beliebigkeit.
Lyotards Vermächtnis ist für Udo ein zweischneidiges Schwert:
Als skeptischer Humanist stehe ich Lyotards berühmter These vom Ende der großen Erzählungen mit zwiespältigen Gefühlen gegenüber. Zu sehr widerspricht der radikale Zweifel an universalen Wahrheitsansprüchen dem Geist der wissenschaftlichen Aufklärung, der mich geprägt hat. Diese baut auf der Idee auf, dass es intersubjektiv überprüfbare Wahrheiten und verlässliche Methoden gibt – ein Fundament, das Lyotards Postmoderne kühn in Frage stellt. Und doch ist seine Diagnose nicht einfach von der Hand zu weisen. Spätestens nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts – von Auschwitz bis Hiroshima – ließ sich der naive Glaube an einen geradlinigen Fortschritt und an allumfassende Heilsversprechen kaum aufrechterhalten. In diesem Licht erscheint Lyotards Skepsis gegenüber den großen Erzählungen verständlich: Sie traf – und trifft – einen Nerv der ernüchterten Spätmoderne und mahnt uns, die eigenen Gewissheiten kritisch zu hinterfragen.
Jedoch darf die Wissenschaft nicht einfach als Metanarrativ abgetan werden:
Lyotard verkennt, dass gerade ein kritisch reflektierter Wahrheitsbegriff – wie ihn Popper oder auch Habermas entwickeln – ein wirksames Mittel sein kann, um sich eben nicht in ideologische Großnarrative einfangen zu lassen. Wissenschaft etwa beruht nicht auf einem unverrückbaren Dogma, sondern auf kritikfähigen Theorien, auf dem Prinzip der Falsifizierbarkeit, auf öffentlicher Nachvollziehbarkeit. Sie ist selbst kein Narrativ (womit immer wieder versucht wird, sie zu delegitimieren) ,sondern ein offener, prinzipiell zur Selbstkorrektur fähiger Diskurs.
Nicht jede Behauptung von Wahrheit ist Herrschaftsstrategie. Und nicht jedes gemeinsame Orientierungssystem ist ein ideologischer Käfig.
Udo betont die konkrete Stelle, an der sich die Wege von Lyotard und vom Rationalismus trennen:
Gerade dieser Punkt – dass sich aus der Erkenntnis des „Legitimationsverlusts der großen Erzählungen“ nicht das Ende von Wahrheit ergibt, sondern der Bedarf nach einem neuen Wahrheitsbegriff – ist die entscheidende Weggabelung. Lyotard biegt links ab, der humanistische Skeptiker geht geradeaus. Und genau an diesem Kreuzungspunkt wird deutlich, dass kritisches Denken nicht in Beliebigkeit münden muss, sondern in verantwortbare Erkenntnisfähigkeit, auch und gerade angesichts der Fragilität ihrer Grundlagen.
Zur ganzen Analyse:
Freuen wir uns auf die weiteren Beiträge dieser Reihe.
Zum Thema:
- Artikel: Erkenntnis, Relativismus und die Krise des Diskurses (Erkenntnisrelativismus Teil 1), Science and Sense vom 07.03.2025
- Homepage: INH
Hinweis:
- Falls ihr Ideen, Anregungen oder Empfehlungen habt bzw. selbst ein Gastkapitel für den GWUP-Blog schreiben möchtet, kontaktiert uns unter: blog@gwup.org.
- Wenn ihr noch nicht im Skeptischen Netzwerk angemeldet seid, möchten wir euch herzlich dazu einladen. Dort finden GWUP-Mitglieder und Interessierte eine Plattform für Diskussionen und Austausch rund um skeptische Themen:












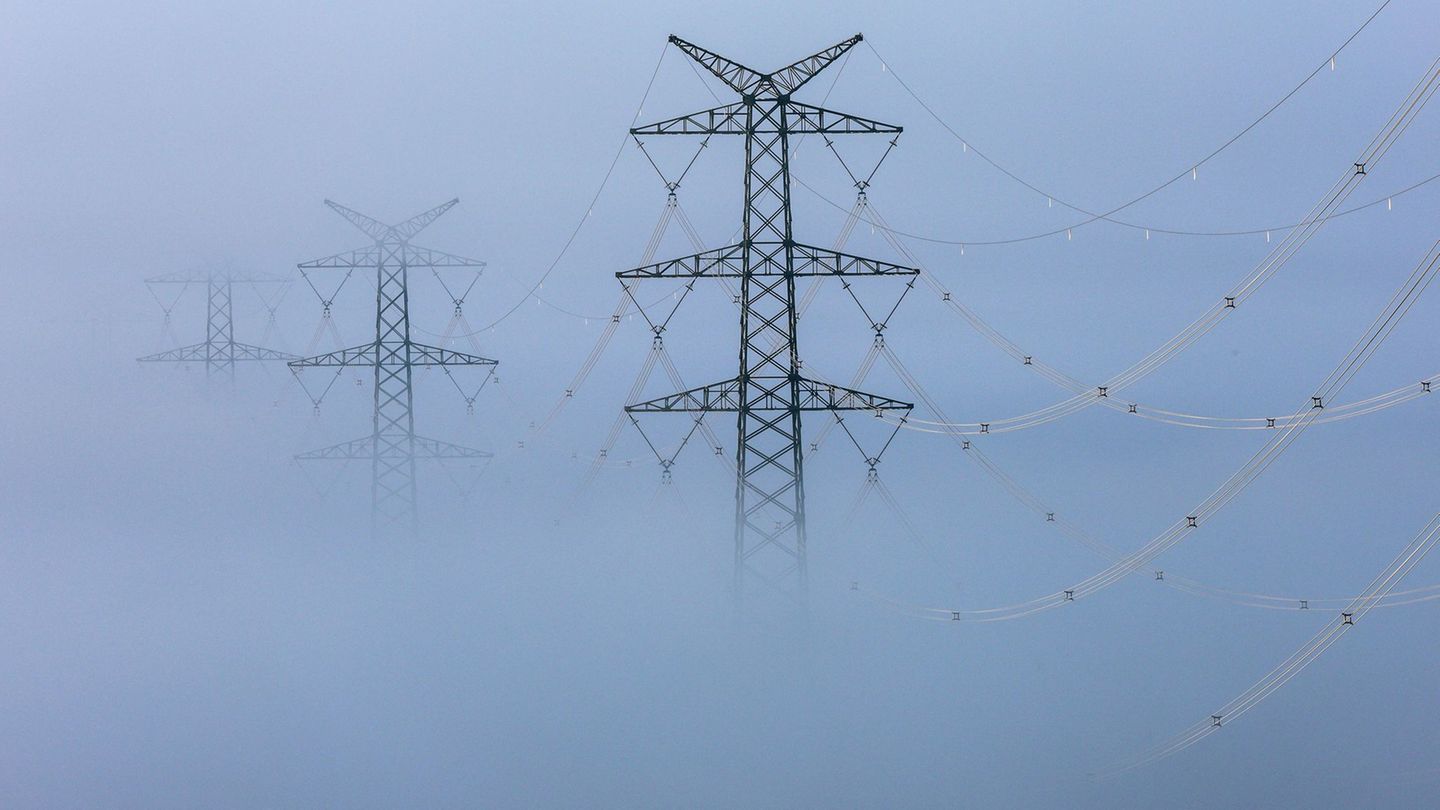
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/76/83/7683e641b7f3538cbc5f8e168e21528d/0124326674v1.jpeg?#)







:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/81/bb818e1bdddd5bedf0c7b942fe8d5988/0123358373v1.jpeg?#)