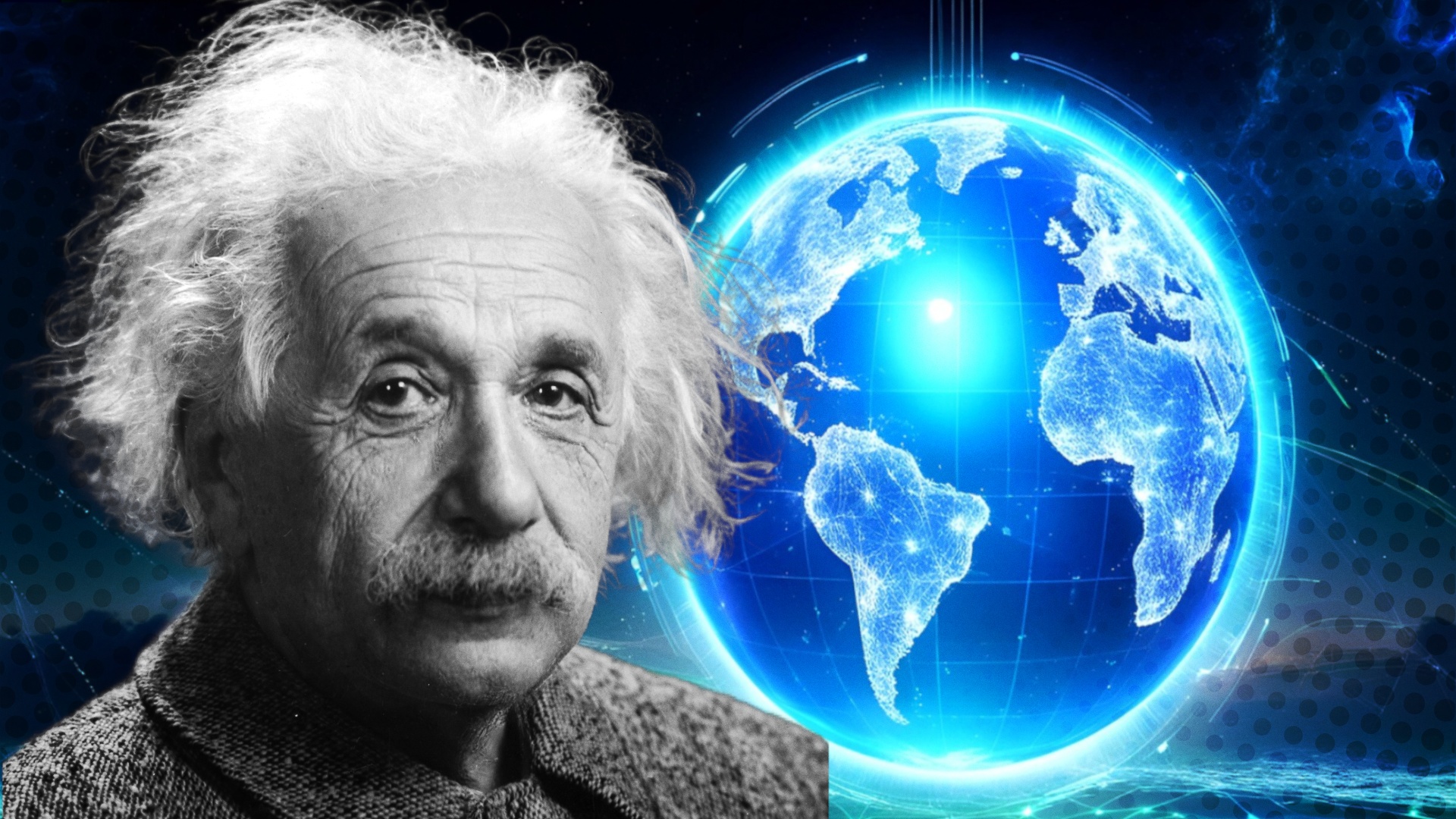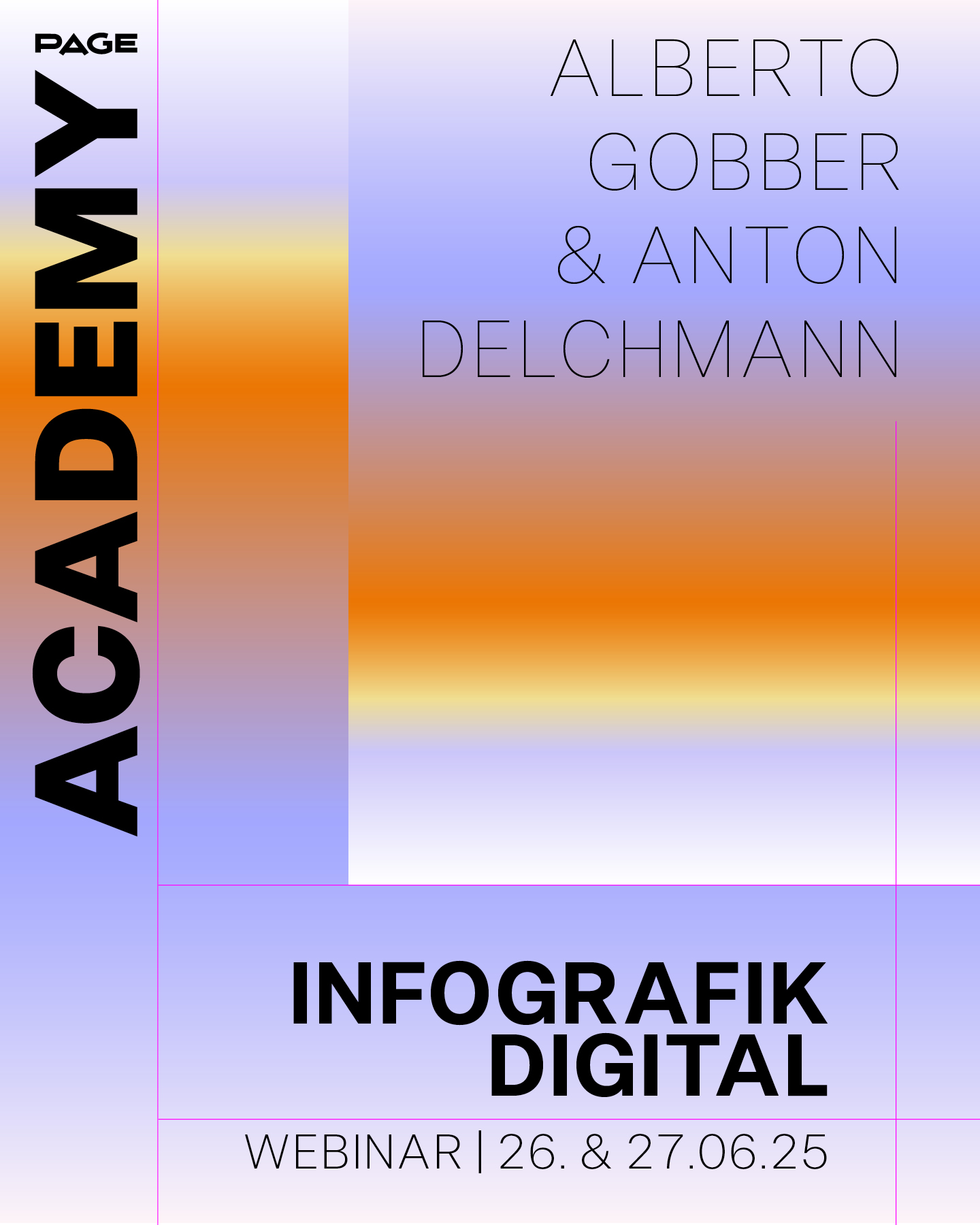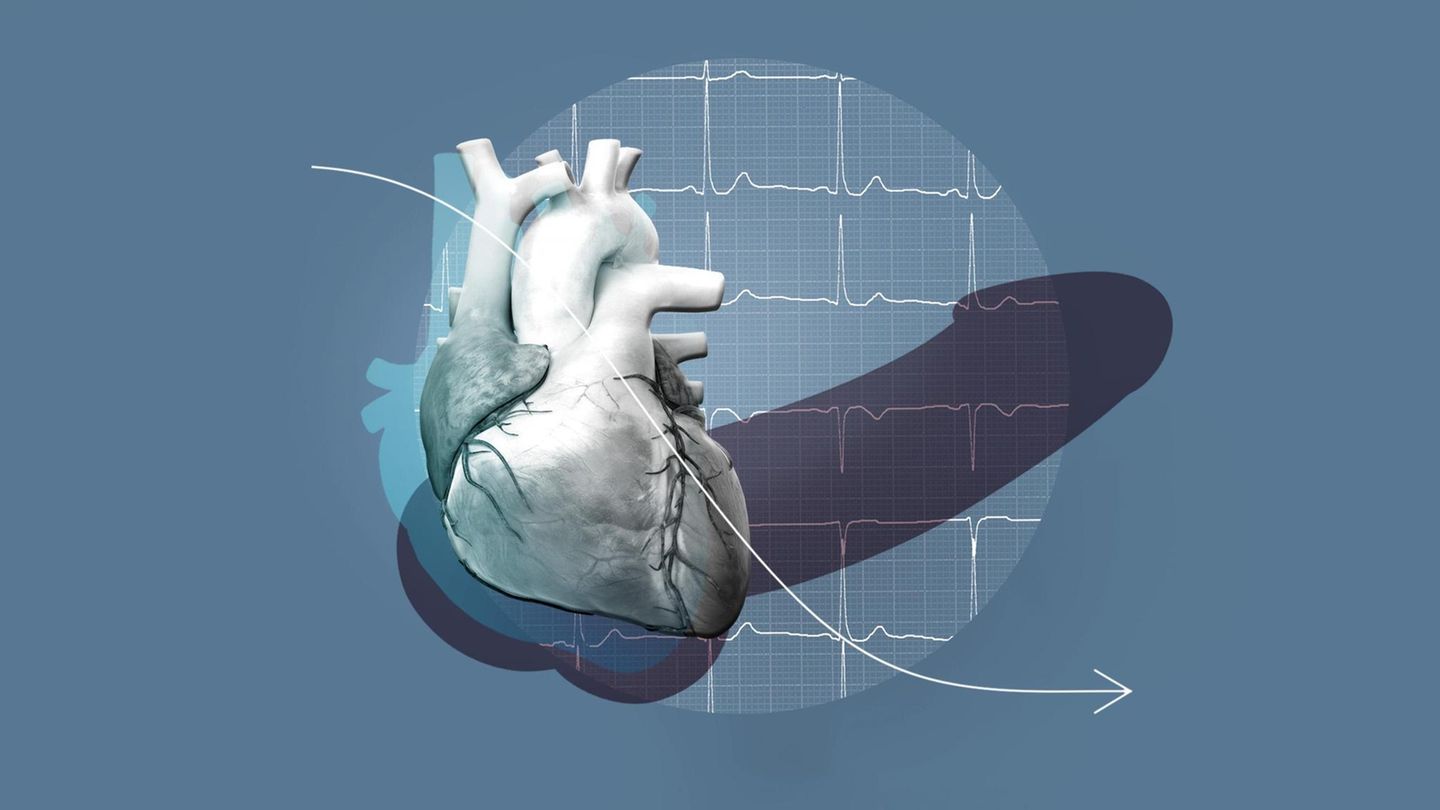Wissenschaft unter Trump: Deutsche Forschungsinstitute wollen keine US-Forscher abwerben
Donald Trump schießt gegen Harvard – und schränkt die Wissenschaftsfreiheit ein. Die EU-Länder werben daher aktiv um Top-Forscher aus Amerika. Doch Deutschland will offenbar eine weitere Eskalation verhindern

Donald Trump schießt gegen Harvard – und schränkt die Wissenschaftsfreiheit ein. Die EU-Länder werben daher aktiv um Top-Forscher aus Amerika. Doch Deutschland will offenbar eine weitere Eskalation verhindern
Deutsche Forschungsinstitute wollen sich nicht aktiv um US-Wissenschaftler bemühen, die aufgrund der Trump-Regierung auswandern. Das zeigt eine Umfrage von Capital unter mehreren Instituten sowie dem Deutschen Hochschulverband. Hintergrund sind die massiven Einschnitte im amerikanischen Wissenschaftsbetrieb unter US-Präsident Donald Trump. Vor allem dem National Institute for Health wurden Mittel gekürzt – viele Forschungsstipendien stehen vor dem Aus. Auch die Environmental Protection Agency wird zusammengestrichen, laut „New York Times“ könnten über 1000 Wissenschaftler gefeuert werden. In einer nicht-repräsentativen Umfrage des Magazins „Nature“ gaben drei Viertel der 1200 befragten Wissenschaftler an, darüber nachzudenken, die USA verlassen zu wollen.
Zuletzt traf es die amerikanische Eliteuniversität Harvard: Die US-Regierung kündigte an, der Universität mehrjährige Zuschüsse in Höhe von 2,2 Mrd. US-Dollar zu streichen, weil sich die Leitung widersetzt hatte, gemäß Trumps Forderungen, Diversitätsprogramme zu schließen und die Behörden beim Durchleuchten ausländischer Studierende zu helfen. Trump schrieb online, Harvard sei ein „Witz, lehrt Hass und Dummheit und sollte keine öffentlichen Gelder mehr bekommen“.
Frankreichs und Belgiens Universitäten sind offensiver als Deutschland
Im Gegensatz zu Deutschland bemühen sich andere europäische Institute und Universitäten sehr aktiv darum, Spitzenforscher anzulocken: Die französische Centrale Supélec steckt rund 3 Mio. Euro in ein Programm für Forschungsprojekte, die in den USA nicht weiterlaufen können. Die Pariser Universität schließt sich damit einer Initiative der Aix-Marseille Universität an, die ein 15 Mio. Euro schweres „Safe Place for Science“-Programm ausgerufen hat. In Belgien hat die Freie Universität Brüssel 12 Post-Doc-Stellen für internationale Wissenschaftler geschaffen, mit „besonderem Fokus auf amerikanische Forscher“.
In Deutschland ist die Reaktion deutlich verhaltener. „Stimmen, die nun eine aktive Anwerbung von Spitzenforschern aus den USA fordern, halten wir für kurzsichtig“, sagt das größte deutsche Forschungsinstitut, die Helmholtz-Gemeinschaft, auf Anfrage von Capital. Auch die Leibniz-Gemeinschaft erteilt dem Buhlen um US-amerikanische Wissenschaftler eine Absage: „Eine gezielte Abwerbung von amerikanischen Kolleginnen und Kollegen birgt das Risiko, die amerikanische Wissenschaft nur noch mehr zu schwächen und wird von uns daher nicht aktiv betrieben.“ Die Fraunhofer-Gesellschaft und die Max-Planck-Gesellschaft haben ebenfalls keine Programme zur Anwerbung amerikanischer Forscher geplant – auch wenn es in der aktuellen Situation gelingen könne, „den ein oder anderen Top-Forscher bzw. Top-Forscherin zu rekrutieren“, teilt die Max-Planck-Gesellschaft mit.
Donald Trump: Abbau von Klimaforschung?
Auch ohne aktive Anwerbung rechnen die Befragten damit, dass mehr amerikanische Wissenschaftler in die Bundesrepublik kommen wollen – auch wenn es bisher noch keinen „größeren Exodus“ gebe. „Dies betrifft übrigens nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die derzeit in den USA beschäftigt sind, sondern auch Forschende aus aller Welt, die nun Alternativen zu einem angestrebten oder bereits geplanten Aufenthalt in den USA suchen“, sagt die Helmholtz Gesellschaft. „Eine ähnliche Tendenz haben wir nach dem Brexit gesehen.“
Wenn es in den USA zu einem substanziellen Abbau von Klima- oder Infektionsforschung komme, müsse diese Expertise bewahrt werden, so die Leibniz-Gemeinschaft. Sollte die Forschungseinrichtung Anfragen nach alternativen Betätigungsmöglichkeiten erhalten, wolle die Forschungseinrichtung die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler „sehr gern unterstützen“.
Es gibt allerdings auch prominente deutsche Wissenschaftlerinnen wie Monika Schnitzer und Moritz Schularick, die ein offensives Vorgehen fordern. In einem Gastbeitrag im „Spiegel“ warben sie kürzlich für ein „Meitner-Einstein-Programm“, um US-Wissenschaftler nach Deutschland zu holen. Unter dem Dach der Deutschen Forschungsgemeinschaft und mit Geld aus dem Bildungsministerium könnten 100 Stellen geschaffen werden. Der Vorschlag stieß jedoch sowohl bei den Forschungsinstituten als auch in der Politik auf Ablehnung.
Deutschland delegiert an die EU
Stattdessen warben Noch-Forschungsminister Cem Özdemir (Grüne) und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen im März mit einem gemeinsamen Statement für den Standort: „Deutschland und seine Wissenschaft stehen für die weltweite Wissenschaftsfreiheit“, sagte Özdemir. „Zugleich machen wir deutlich: Forscherinnen und Forschern, die in ihrer Heimat nicht mehr die Möglichkeit sehen, frei zu arbeiten, können und wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten im deutschen Wissenschaftssystem eine Perspektive bieten.“
Özdemir wollte sich um eine europäische Lösung bemühen: Gemeinsam mit zwölf Amtskollegen sandte er einen Brief an die EU-Kommission. „Um diesen historischen Moment zu nutzen, muss die Europäische Union einen Akt der Solidarität und einen Attraktivitätsboom für die Aufnahme brillanter Talente aus dem Ausland zeigen, die unter der Einmischung in die Forschung und brutalen Mittelkürzungen aus falschen Motiven leiden könnten“, heißt es darin. Dafür müsse man die existierenden Instrumente „voll ausnutzen“. Auf Capital-Anfrage teilt die EU-Kommission mit, dass ein Koordinierungstreffen geplant werde: „Natürlich stellen diese Szenarien eine Gelegenheit für Europa dar, deswegen sehen wir uns diese Vorschläge an.“
Plan von CDU/CSU und SPD
Von der designierten Bundesregierung wird wohl keine Anwerbe-Initiative kommen. Hier hat mancher offenbar Angst, Trump gegen sich aufzubringen. „Wir sollten und werden keine Abwerbeinitiative machen“, sagt Thomas Jarzombek (CDU), Sprecher der Unionsfraktion für Bildung und Forschung, zu Capital. „Die USA sind unser Partner und es wäre falsch, hier weiter zu eskalieren.“
Im Koalitionsvertrag findet sich stattdessen eine „Hightech-Agenda“ und ein Innovationsfreiheitsgesetz. Diese Maßnahmen sollen unter anderem Förderbürokratie abbauen. „Es muss schneller gehen, Förderungen und Forschungsgenehmigungen zu bekommen. Der Standort Deutschland ist attraktiv, aber Forschende brauchen hierzulande mehr Möglichkeiten“, so Jarzombek. Die Koalition habe außerdem ein „1000-Köpfe-Programm“ erfunden. Insbesondere der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Max Weber Stiftung sollen gestärkt werden. Außerdem solle die Visavergabe vereinfacht werden. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die konkrete Umsetzung dieser Pläne ist noch unklar und das Geld dafür muss auch erst im Haushalt gefunden werden.
„Von der Trump-Regierung enttäuschte und verprellte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden vor allem dorthin gehen, wo sie ansprechende Arbeitsbedingungen und Standortfaktoren vorfinden“, sagt Lambert Koch, Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, zu Capital. Da habe Deutschland noch Hausaufgaben zu erledigen.
Dem stimmt auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Ruppert Stüwe zu: Um internationale Forschende zu gewinnen, brauche es enormes Geld und Investitionen in die Forschungsinfrastruktur mit langfristiger Perspektive. „Denn zusätzlich zum Gehalt des Wissenschaftlers geht es um den Transfer von Teams und Ausstattung.“















,regionOfInterest=(240,151)&hash=5390aa4521f70a5cca126b5909b7cd598957b6af2bf94138f860a160b14c5007#)






:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/e9/18e9a988d3ca7593fb3324e8abc33e56/0124025380v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)