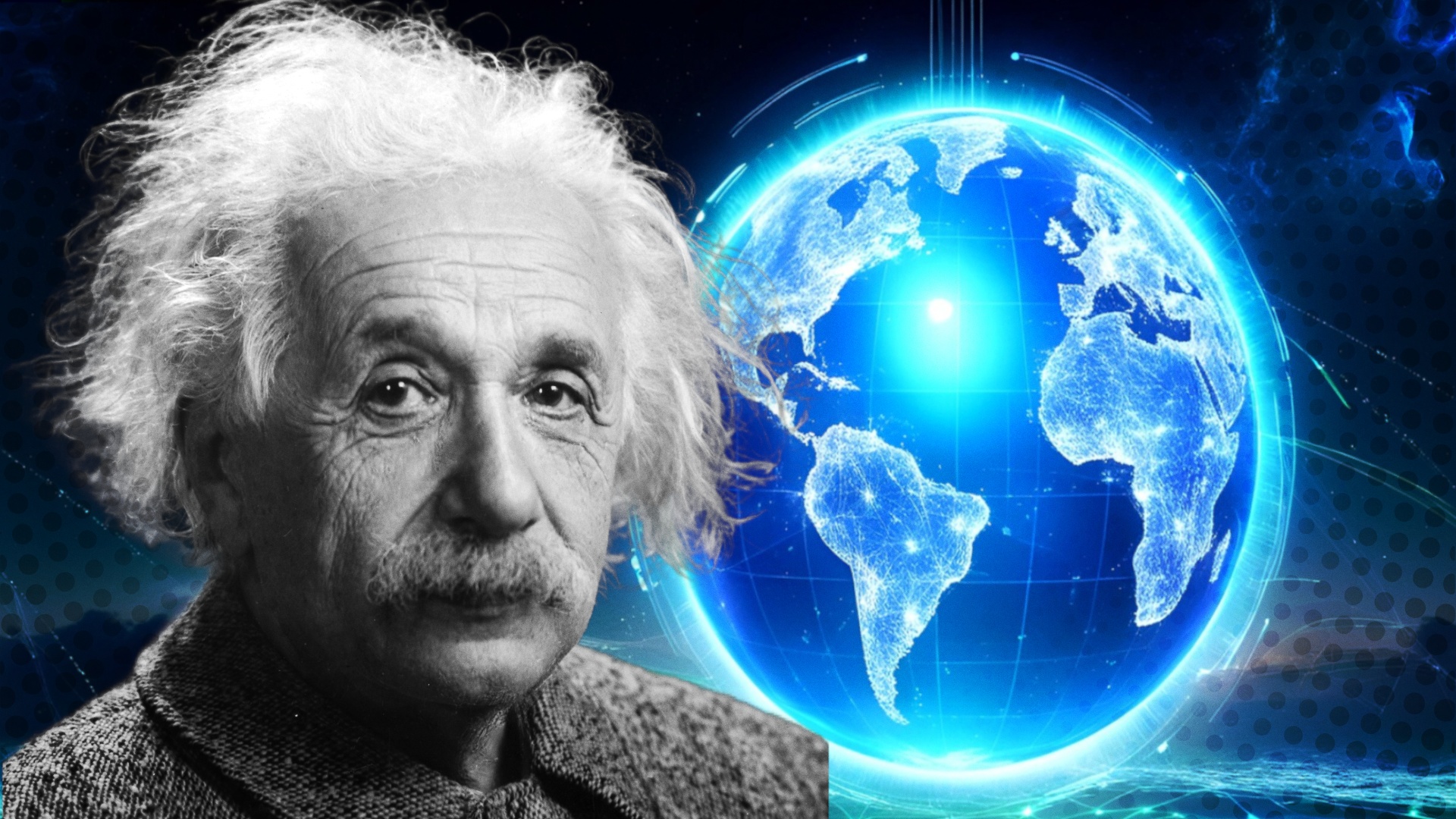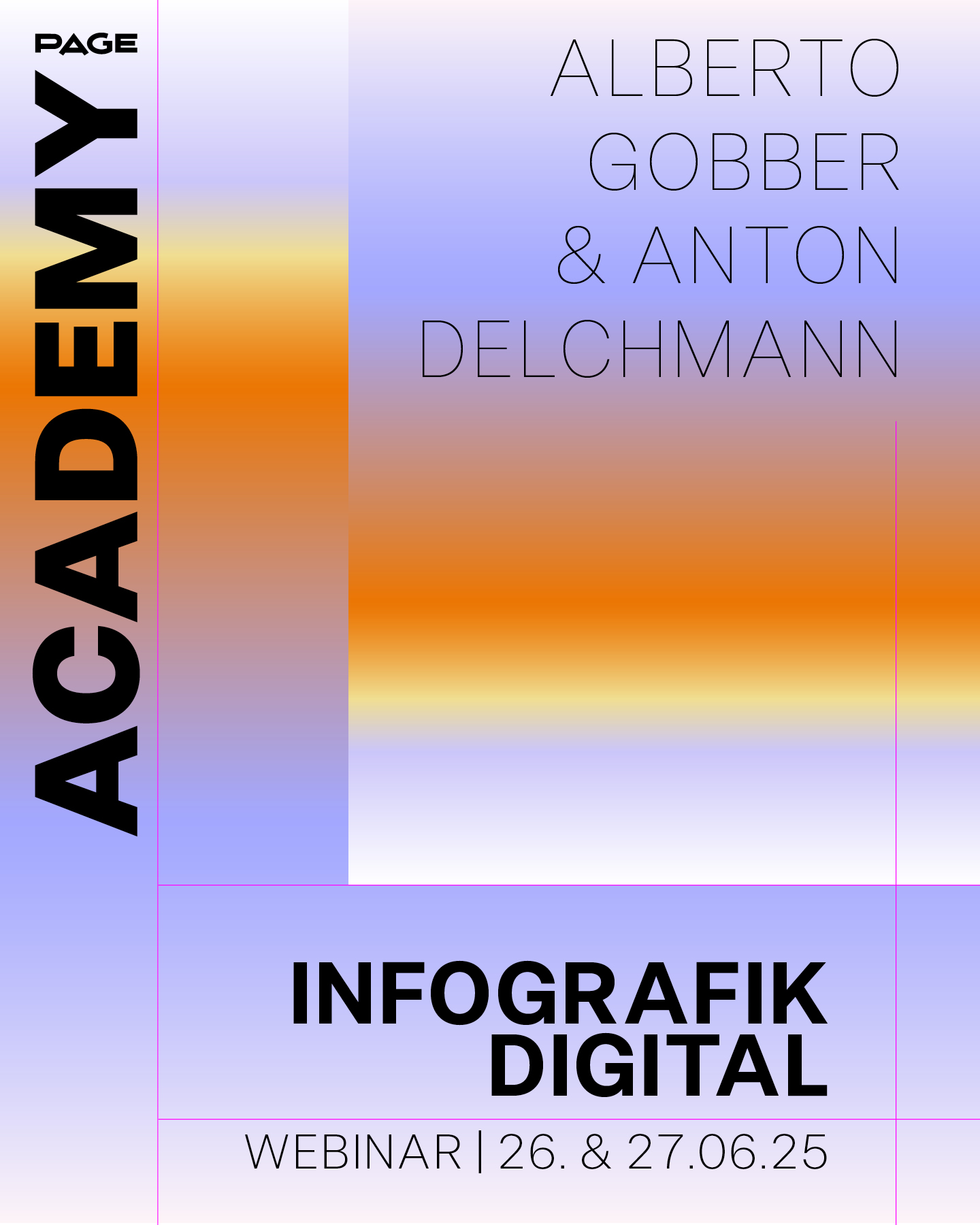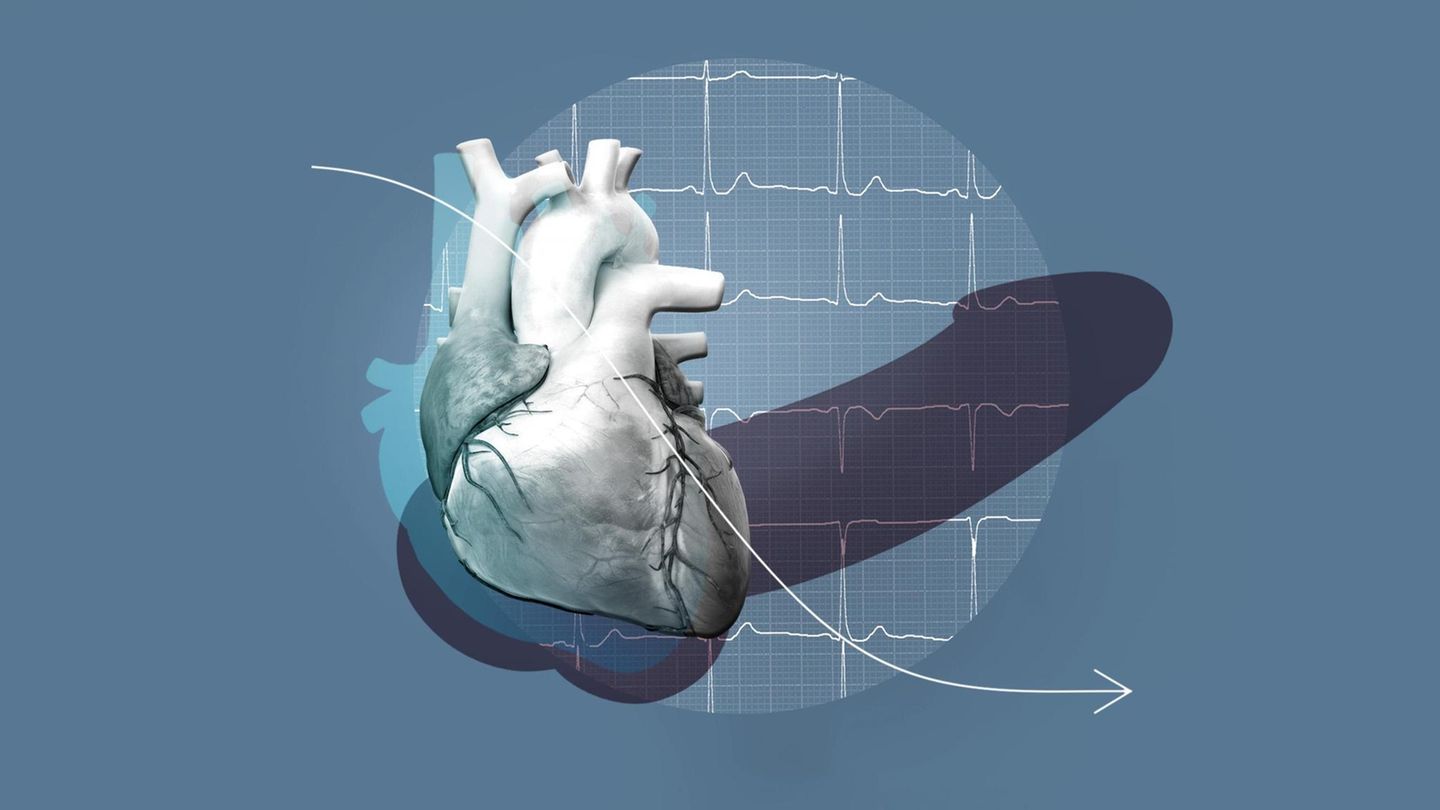Wir haben die Musik
Es war im Sommer 2000, der 12. August: Mein bester Freund hatte herausgefunden, dass in Rees-Haldern, rund 40 Kilometer von Dinslaken entfernt, ein Musikfestival stattfand, auf dem unter anderem Embrace, Soulwax und K’s Choice auftreten würden — und zwar heute, am letzten Samstag der Sommerferien! Da wollten wir hin, also druckte ich bei meiner Mutter […]

Es war im Sommer 2000, der 12. August: Mein bester Freund hatte herausgefunden, dass in Rees-Haldern, rund 40 Kilometer von Dinslaken entfernt, ein Musikfestival stattfand, auf dem unter anderem Embrace, Soulwax und K’s Choice auftreten würden — und zwar heute, am letzten Samstag der Sommerferien! Da wollten wir hin, also druckte ich bei meiner Mutter in der Stadtbibliothek eine Wegbeschreibung aus und das, was wir damals noch nicht „Timetable“ nannten. Ich besorgte Getränke und ein paar Snacks und mein bester Freund überzeugte seine große Schwester, uns dorthin zu fahren und abends wieder abzuholen („Um halb Elf, an der gleichen Stelle!“ — klingt wie Mittelalter, es gibt aber vereinzelte Hunde, die damals schon lebten und es heute auch noch tun). Es sollte mein erstes von zwölf Haldern Pop Festivals werden und mich, dem butterfly effect folgend, von Dinslaken nach Bochum bringen.
Einer der zahlreichen Acts, deren Namen uns nichts sagten, war ein Typ mit verknautschtem Gesicht und Akustikgitarre. Das Programmheft klärte uns auf, dass es sich um Tom Liwa aus Duisburg handle, bisher bekannt als Sänger einer Band namens Flowerpornoes, jetzt auf Tour mit seinem Solo-Debüt mit dem etwas schnulzig klingenden Titel „St. Amour“. Wir waren anfangs nicht überzeugt, aber irgendwie gelang es diesem Mann, uns während seines knapp 40-minütigen Sets auf seine Seite zu ziehen. Die Songs waren eigentümlich interessant, sowas kannten wir nicht aus dem Radio und noch nicht mal von Viva II. Wir waren als Skeptiker gekommen und gingen als Fans.

Das war insofern bemerkenswert, als ich damals nicht nur nichts von deutschsprachiger Musik wissen wollte, sondern mir sogar englischsprachige Acts aus Deutschland suspekt waren. Ja, okay: Die Fantastischen Vier existierten, aber ich hatte gerade erst angefangen, mich vorsichtig mit Tocotronic und den Sternen zu beschäftigen; eine Rückkehr zu Herbert Grönemeyer oder der Münchener Freiheit, mit denen ich aufgewachsen war, erschien noch undenkbar.
Es ist für Menschen, die heute jung sind, unvorstellbar und selbst für uns, die wir dabei waren, manchmal überraschend, aber: Man konnte damals nicht einfach sofort jede Musik hören, die man hören wollte. Schon gar nicht in niederrheinischen Kleinstädten. Theoretisch hätte ich das Album noch am selben Abend bei Amazon bestellen können, praktisch hatte ich noch nicht mal ein Girokonto, von dem aus ich es hätte bezahlen können. Es dauerte also bis zu den Herbstferien, bis ich im Mediamarkt in der Kölner Hohen Straße nach dieser „Platte“, wie man damals rätselhafterweise auch zu CDs sagte, suchen konnte.
Die ersten Zeilen des Albums, „Dies ist kein Brief / Nur eine Straßenkarte /Auf der ich mit dem Finger entlangfahr / Während ich auf Antwort warte“ im Song „Eskimo“, waren aufregender als neun Jahre Deutschunterricht am Gymnasium. Und dann so lapidar dahingeworfene Zeilen wie „All meine Geschwister sind Einzelkinder“, „Diese Welt ist ein seltsamer Platz, an dem man immer wieder vergisst, wie traurig man ist“, „Und jetzt sitzt Du da mit Deinem Streichquartett und ich hab Kopfschmerzen vom Telefonieren“ — wow!
Die Texte haben genau jenes Mischungsverhältnis aus konkret und kryptisch, dass man sich in nahezu Lebensphase darin wiederzufinden glaubt: „Und was denkt ein Pinguin / In seinem Käfig im Zoo / Im Herbst, wenn die Vögel zieh’n / In die Sonne?“ Ja, klar: Fühl ich. Und das vorgetragen mit dieser leicht knarzigen, aber trotzdem sehr warmen Stimme, die einfach klingt wie die eines Freundes, den „alt“ zu nennen man sich verbieten würde, weil man doch ein Jahrgang ist, der aber am Ende eben dann doch genau das ist. Bei „The Voice“ kommt man damit nicht weit, aber das ist ja – neben der textlichen Qualität – eben genau das, was Tom Liwa von heutigen wiederverwertbaren Deutschpopmusikern unterscheidet.
„Gib ihnen was sie wollen“ klingt wie eine brutale, aber nicht unempathische Abrechnung mit Babyboomern — aber das kann eigentlich nicht sein, die waren doch erst Mitte 40, als das Album erschien, und Liwa gehört selbst dazu. Also doch? Wahnsinnig viel passiert auch auf der Rückbank irgendwelcher Autos — oder: Es passiert eben nicht, es wird immer nur angedeutet, dass dort in der Vergangenheit irgendetwas passiert ist. Das ist für einen 17-Jährigen, der seinen Führerschein nicht so bald machen sollte, natürlich wahnsinnig aufregend!
Wie das oft so ist bei Songs, die man schon sehr lange kennt: Wenn man sie nach vielen Jahren wieder hört, kann man immer noch jedes Wort mitsingen — was einen aber nicht unbedingt näher an den Inhalt der Texte heranbringt, weil man über diese eben gar nicht mehr nachdenkt, egal ob auf Englisch oder Deutsch. Wovon handeln also die ganzen Lieder? Von Menschen und ihren Problemen; von Beziehungen, die daraus entstehen und darunter leiden; von schlaflosen Nächten, eigenen Unzulänglichkeiten, Leidenschaften und Einsamkeiten.
Das könnte man ehrlicherweise über wahrscheinlich 90% aller Popsongs sagen, aber irgendwie war Tom Liwa hier etwas gelungen, was bis heute nur wahnsinnig wenige deutschsprachige Texter geschafft haben: so zu formulieren, dass es für mich – und ich bin ja hier die einzige Instanz, wenn es um meinen Geschmack geht! – nicht peinlich, gestelzt oder ausgedacht klang, sondern wie im Gespräch dahergesagt. Marcus Wiebusch und Reimer Bustorf von kettcar und Thees Uhlmann sind für mich die Einzigen, die mich seit Jahrzehnten begleiten, aber ihre Qualitäten liegen ein bisschen woanders; Muff Potter, Wir Sind Helden und Jupiter Jones haben vor rund 20 Jahren jeweils ein paar Alben lang zu mir gesprochen, aber Tom Liwa ist wirklich ein Solitär: Ich würde auch heute noch nicht sagen, dass er meine Lebenswirklichkeit abbildet, und die Situationen, in denen sich seine Ich-Erzähler befinden, sind in den seltensten Fällen erstrebenswert, aber es bleiben Geschichten, die mich anrühren und interessieren — etwas, was anderen deutschsprachigen Acts ungefähr nie gelingt (it’s not you, it’s me).

Für einen 17-Jährigen, der gerade dabei war, sich die ersten paar Male unglücklich zu verlieben, bot dieses Album reichlich Projektionsfläche: Ein Song, der „Seltsames Mädchen“ hieß; Geschichten von offenbar dramatisch geendeten Liebschaften; eine Erzählstimme, die offenbar schon mehr wusste (Tom Liwa war bei Veröffentlichung des Albums 38 Jahre alt), aber uns kleine Holden Caulfields mitnehmen konnte durch diese Erwachsenenwelt, an deren Tür wir gerade anklopften (oder von deren Tür von uns erwartet wurde, dass wir an sie anklopfen wollen würden oder müssten).
Unter den zwölf Tracks des Albums gibt es nicht einen schwachen, einer der besten Songs wurde noch nicht mal von Liwa selbst geschrieben: „Zuhause“ stammt von Florian Glässing, mit dem Tom Liwa 2002 ein gemeinsames Album aufnehmen sollte, und auf dessen Durchbruch ich seit über 20 Jahren warte. Nachdem sich dieser Song in ein Pearl-Jam-ähnliches Finale hochgeschraubt hat, erklingt plötzlich die Stimme von Christian Brückner (oder, wie wir schon damals sagten: „die deutsche Stimme von Robert de Niro“) und rezitiert einen Liwa’schen Text, der „Wir haben die Musik“ heißt und clevererweise eben genau auf selbige verzichtet.
Wenn es auf „St. Amour“ einen Hit gibt, dann „Für die linke Spur zu langsam“: Ein Song, dessen volles Ausmaß ich erst im Lauf der Jahre langsam zu erfassen begann. Die erste Strophe handelt von den Ansprüchen an sich selbst, vom „Geschenk für die Welt“, an dem man arbeitet. Die dritte Strophe schleicht sich nebensächlich an, um im letzten Moment ihre volle, fast metaphysische Wucht zu entfalten: „Und dann fahr ich ans Meer raus / So wie ich’s immer mach / Wenn ich allem entflieh’n will / Das ich nicht mehr etrag / Park den Bus in den Dünen / Und setz mich irgendwohin / Seh raus aufs Wasser und warte / Bis ich jemand anders bin“.
Treffendere Worte sind selten über Männer geschrieben worden. Dieses ganze „Born To Run“-Dingen (also: Motorrad oder Auto nehmen und los) wird hier einmal kurz dekonstruiert: Es ist halt einfach immer eine ganz banale Flucht. Vor dem, was der Mann „nicht mehr erträgt“. Ich kenne kaum einen Mann, egal welcher Generation, auf den diese Strophe nicht passen würde: Wenn meinem Großvater seine Familie zu viel wurde oder ihm Konflikte unlösbar erschienen, fuhr er einfach weg. Ich hab mich als Teenager auf mein Fahrrad geschwungen und bin zum Rheindeich gefahren; später, in Bochum, bin ich ins Auto gestiegen und zum Kemnader See gefahren. Das Meer, das mich noch heute beruhigt wie sonst nichts auf der Welt, war mir dann doch immer ein bisschen zu weit weg, aber Hauptsache Wasser! Ruhe finden im Fluss, panta rhei. Das hier einmal so ausformuliert zu finden, in seiner ganzen heroischen Lächerlichkeit der Konfliktvermeidung und Kapitulation — das hat schon eine sehr entwaffnende, ernüchternde Macht. Bis heute fühle ich mich oft so, wie es Tom Liwa im Refrain beschreibt: „Für die linke Spur zu langsam / Für die rechte Spur zu schnell“. Eigentlich müsste es der Slogan aller Millennials sein.
In den Jahren 2000 und 2001 sahen mein bester Freund und ich Tom Liwa vier Mal live. Meist stand er allein mit seiner Akustikgitarre auf der Bühne und spielte das, was er – in Anlehnung an die damals populären „Dogma 95“-Filme – augenzwinkernd als „Dogma-Konzert“ bezeichnete. Was aus den tollen bis grandiosen Songs ein rundherum großartiges Album macht, ist jedoch auch die Produktion Marcus Holzapfel, die mir auch Jahrzehnte später noch wahnsinnig „undeutsch“ erscheint: sehr klar, alle Instrumente haben viel Raum, neben den dominierenden Akustik- und den begleitenden E‑Gitarren erklingen Querflöten, Vibraphone, Orgeln und Akkordeons, gleichzeitig hat das Schlagzeug einen fast absurden Stadionrock-Appeal. Im Nachhinein denke ich, dass die Vorbilder für diesen Sound vielleicht k.d. lang („Casanovas Rückkehr zum Planet der Affen“ klingt in den ersten Takten buchstäblich wie ein „Constant Craving“-Cover), Jeff Buckley und Wilco geheißen haben könnten. In jedem Fall ist es, neben all seinen inhaltlichen Stärken, immer noch eines der bestklingenden deutschsprachigen Alben aller Zeiten.
Texte, die gleichzeitig auf magische Art zugänglich und sperrig sind, fand ich auch auf den früheren Flowerpornoes-Alben, die ich mir nach und nach erschloss, während viele Liwa-Alben nach „St. Amour“ oftmals in buchstäblich sehr anderen Sphären spielten. Zwischendurch hat er mal sehr gute Alben beim Grand Hotel van Cleef veröffentlicht, aber sein Output und seine Wechsel von Labels und Vertriebswegen haben ähnlich hohe Schlagzahlen. Liwas aktuellste Alben sind hochgelobt, aber weil er es sich erlauben kann (oder zumindest erlauben will), sie ausschließlich außerhalb der Streamingdienst-Ausschlachtungsketten anzubieten, sind sie ehrlich gesagt auch ein bisschen an mir vorbei gegangen. Das wenige, was ich im vergangenen Jahr aus „Primzahlen aus dem Bardo“ gehört habe, erinnerte aber durchaus an alte Glanzzeiten. „Eine andere Zeit“ wurde von der Redaktion des deutschen „Rolling Stone“ 2022 zum „Album des Jahres“ gewählt. Klar: Ich käme heute sehr viel leichter an seine Musik als vor 25 Jahren, aber ich bin eben auch Teil des Problems der Musikindustrie (bzw. hier vor allem: der Künstler*innen), dessen bin ich mir bewusst.
So ist auch „St. Amour“ bis heute nicht zum Streamen verfügbar. Man kann das Album zwar bei iTunes kaufen, aber weder bei Apple Music noch bei Spotify hören. Da sowohl das Label (Detlef Diederichsens Moll Tonträger) als auch der Vertrieb (Energie für Alle) inzwischen nicht mehr existieren, kann man gebrauchte CDs im Internet bestellen, aber die Aura des etwas mystischen, nur mühevoll zu beschaffenen, die das Album damals für mich hatte, umgibt es interessanterweise bis heute.
Am 7. April 2000 ist es erschienen, heute vor 25 Jahren.














,regionOfInterest=(240,151)&hash=5390aa4521f70a5cca126b5909b7cd598957b6af2bf94138f860a160b14c5007#)






:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/e9/18e9a988d3ca7593fb3324e8abc33e56/0124025380v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)