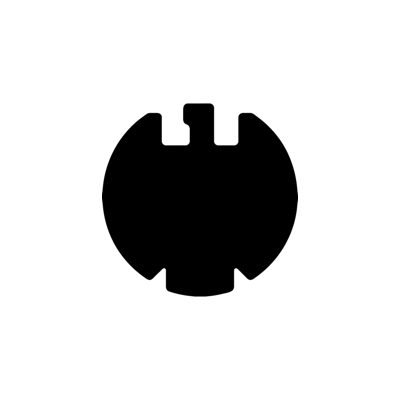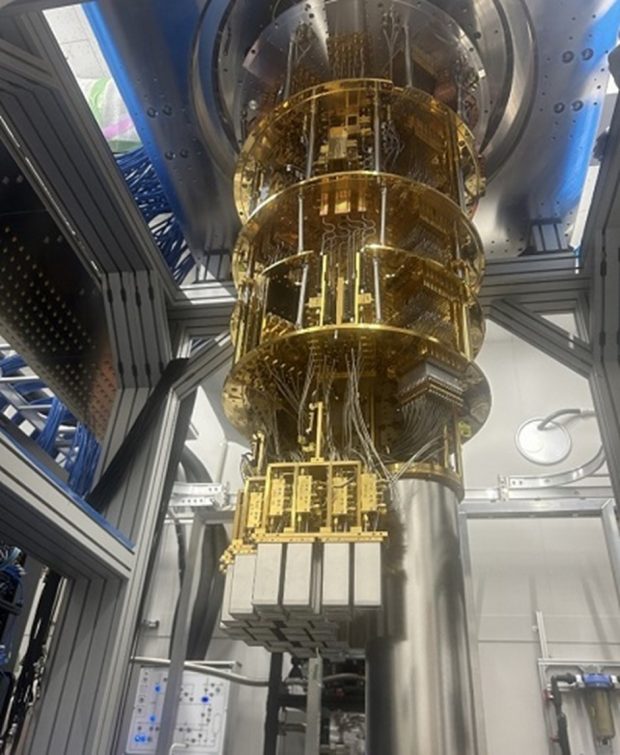Schlacht um Berlin: Deserteure und Franzosen – sie verteidigten Hitlers letzte Zuflucht
Hitler beauftragt SS-Mann Mohnke, das Regierungsviertel zu halten. Ausgerechnet Franzosen kämpfen fanatisch im Reichstag, während andere das Ende herbeisehnten.

Hitler beauftragt SS-Mann Mohnke, das Regierungsviertel zu halten. Ausgerechnet Franzosen kämpfen fanatisch im Reichstag, während andere das Ende herbeisehnten.
Nachdem die sowjetischen Truppen Berlin eingeschlossen hatten, beauftragte Adolf Hitler den SS-Offizier Wilhelm Mohnke mit der Verteidigung des Regierungsviertels. Mohnke, ein überzeugter Nationalsozialist, war entschlossen, jeden Meter bis zum letzten Mann zu halten. Die massiven Gebäude, breiten Alleen und zahlreichen Wasserwege unterstützten die Verteidiger, doch die Lage war aussichtslos – wie auch Mohnke wusste. Im "Endkampf" ging es nur darum, das Unvermeidliche um einige Tage zu verzögern. Militärisch war das Unternehmen sinnlos; tatsächlich verschaffte Brigadeführer Mohnke Hitler lediglich Zeit, dessen eigenen Tod vorzubereiten. Mohnke stammte aus der 1. SS-Panzerdivision "Leibstandarte Adolf Hitler", einer berüchtigten Eliteformation des Dritten Reichs. Die Division war jedoch größtenteils nicht in Berlin vertreten. Mohnke selbst war eher zufällig dort – nach einer schweren Verwundung kam er direkt aus dem Krankenhaus.
Zusammengewürfelte Truppe
Seine Soldaten waren ein zusammengewürfelter Haufen. Die Kampfgruppe Mohnke bestand aus Teilen der Leibstandarte, regulären Truppenteilen und dem Volkssturm. Der Volkssturm, dieses letzte Aufgebot, war in der Regel kaum kampfkräftig und für die besonderen Herausforderungen einer Großkampflage in der dicht bebauten Berliner Innenstadt völlig unvorbereitet. Zu diesen Truppen gesellten sich weitere Formationen. Am unteren Ende standen Männer eines Strafbataillons, wenig erpicht darauf, für den "Führer" den Heldentod zu sterben. Auf der anderen Seite fanden sich ausgesuchte Elitekämpfer für ein letztes Gefecht. Darunter Georg Diers, der mit zwei gewaltigen Panzern vom Typ "Königstiger" – Nummer 314 und 100 – in die Kämpfe eingriff. Diese Panzer, vermutlich Teil der schweren SS-Panzer-Abteilung 503, operierten in der Schönhauser Allee und im Tiergarten Ost. Den festesten Halt boten ausgerechnet ausländische Freiwillige, die sich während des Krieges den fremdländischen SS-Verbänden angeschlossen hatten – die meisten freiwillig. Der Untergang des Dritten Reichs bedeutete für sie zugleich ihr eigenes Ende. Sie mussten befürchten, bereits bei der Gefangennahme erschossen zu werden, und in ihre Heimat konnten sie nicht zurückkehren. Anstatt auf dem Rückzug auf irgendeinem Acker in Mecklenburg zu fallen, wollten sie bis zuletzt bei Hitler bleiben. Unter ihnen war die SS-Division "Nordland", die sich im Tiergarten postierte. Eine besondere Rolle spielten jedoch die Franzosen. Die Angehörigen der SS-Division "Charlemagne" verteidigten das Reichstagsgebäude, in dem heute der Bundestag tagt.
Symbol Reichstag
Dem Reichstag kam in der Schlacht um Berlin eine besondere Bedeutung zu. Für Stalin und die Sowjets war das Parlamentsgebäude das symbolische Zentrum des Dritten Reichs. Baulich lässt sich diese Einschätzung nachvollziehen, doch im Herrschaftssystem Hitlers spielte das Parlament höchstens eine Nebenrolle und wurde mit Kriegsbeginn völlig bedeutungslos. Hitlers Aufenthaltsort im Bunker unter der Reichskanzlei war der Roten Armee unbekannt. Es wurden auch keine besonderen Anstrengungen unternommen, diesen Ort, von dem aus Hitler sein zusammenbrechendes Reich regierte, gezielt zu erobern. Im Gegenteil: Erst nach der Kapitulation entdeckten die sowjetischen Truppen Hitlers letzte Zufluchtsstätte. Der politisch bedeutungslose Reichstag hingegen hatte oberste Priorität. Entscheidend für den sowjetischen Vormarsch war die Eroberung der Moltkebrücke, die den Zugang zum Regierungsviertel öffnete. Am 28. April 1945 lieferten etwa 5000 Verteidiger, darunter Teile der Kampfgruppe Mohnke, erbitterten Widerstand. Die Brücke war teilweise gesprengt, doch sowjetische Pioniere überwanden sie unter hohen Verlusten. Ein sowjetischer Bericht beschreibt: "Die Deutschen verteidigten die Brücke mit allem, was sie hatten – Maschinengewehre, Panzerfäuste, sogar Sprengladungen. Unsere Pioniere mussten unter Feuer die Trümmer räumen." Mit immer neuen Truppen wurden die Deutschen dort zurückgedrängt, bis das Gebäude schließlich gestürmt wurde. Am 30. April 1945 hissten Soldaten der 150. Schützendivision eine rote Fahne auf dem Reichstag, doch Kämpfe in den Kellern und oberen Stockwerken dauerten bis zum 1. Mai an. Für die Sowjets war das Gebäude ein Symbol des Sieges. Der Kriegsberichterstatter Konstantin Simonow schrieb: "Der Reichstag ist schon fast eine Wallfahrtsstätte."
Sterben in der Nähe von Hitler
Die Verteidigung was militärisch sinnlos, besaß aber für die Verteidiger einen hohen symbolischen Wert. Für die Sowjets war es genauso. Nachdem sie an der Oder die Seelower Höhen gestürmt und Berlin eingeschlossen hatten, hätten sie die deutschen Truppen aus den ausgedehnten Vorstädten vertreiben und in der Innenstadt belagern können. Ebenso mit ihrer erdrückenden Überlegenheit an Artillerie und Schlachtfliegern die Deutschen mürbe machen. In kurzer Zeit wäre der Wehrmacht der Nachschub ausgegangen, und der Sieg wäre der Roten Armee zugefallen. Für die Berliner Zivilisten war die Lage bereits katastrophal: Kein Strom, kaum Wasser, zerstörte Straßen. Dieses Vorgehen hätte jedoch einige Wochen länger gedauert, und so lange wollte Stalin nicht warten. Die UdSSR befand sich in einem Wettlauf mit den Westallierten, die nach dem Einschluss der Wehrmacht im Ruhrkessel nur noch vereinzelt auf Widerstand stießen. Stalin gab diesen Druck weiter, seine Armeeführer wetteiferten miteinander, und eine Ebene darunter konkurrierten einzelne Truppenteile. Der Diktator verfolgte die Kämpfe genau – wer sich auszeichnete, konnte mit Aufstieg und Ehren rechnen, wer versagte, mit dem Schlimmsten. Aus dieser Gemengelage resultierten die erbitterten Kämpfe in der Berliner Innenstadt. Böse formuliert: Stalins Druck bescherte den fanatischen Verteidigern den infernalischen Endkampf, den sie sich wünschten.
Strafbataillon 999
Günter Debski sollte 1945 als 16-Jähriger eingezogen werden. Seine Eltern versteckten ihn, doch er wurde entdeckt und zum Tode verurteilt. Statt hingerichtet zu werden, steckte man ihn in das berüchtigte Strafbataillon 999. Nach der blutigen Schlacht um die Seelower Höhen landete er mit anderen Versprengten in Berlin, gekennzeichnet mit dem Winkel des Strafbataillons. Als Arbeiterkind stand er dem Nationalsozialismus feindlich gegenüber. Später ehrte ihn Chruschtschow, weil er in den Wirren der letzten Kriegswochen zwei gefangenen Rotarmisten zur Flucht verhalf. Dennoch sollte dieser Halbwüchsige Hitlers Zufluchtsstätte verteidigen. Im Gespräch mit dem "Zeitzeugen-Portal" sagte er: "Wir haben den Befehl gekriegt, die südliche Seite vom Reichstag zu verteidigen. [...] Eine SS-Einheit war schon im Reichstag drin." Der Irrsinn der letzten Tage war unbeschreiblich. Am 28. April 1945 sollte Debski als Parlamentär zu den Sowjets gehen – nicht, um seine Einheit zur Kapitulation zu bewegen, sondern um die Rotarmisten zur Waffenstreckung aufzufordern. "Das ist doch unmöglich, sag ich, Herr Leutnant. Die legen uns doch um. Hier schießt alles. Wir können doch jetzt nicht mit der weißen Fahne rüber und verhandeln, dass die sich ergeben." Ein schwerer Artilleriebeschuss traf den Offizier, und der Auftrag war damit beendet. Debski überlebte den Krieg und die Gefangenschaft, in der er Grauenhaftes wie Kannibalismus erlebte.
Sturz in das Nichts
Die von ihm erwähnte SS-Einheit im Reichstag bestand aus Franzosen. Von einer Division konnte bei der "Charlemagne" kaum die Rede sein. Nur etwa 300 bis 350 Mann erreichten Berlin. Am 2. Mai 1945, bei der Kapitulation Berlins, waren nur noch etwa 30 Franzosen am Leben. In den letzten Stunden organisierte Mohnke Ausbruchsversuche nach Norden, um der sowjetischen Gefangenschaft zu entgehen. Die meisten scheiterten in den Straßen des zerstörten Berlins. Mohnke selbst erklärte später: "Wir wussten, dass es keinen Sinn hatte, aber wir wollten nicht in sowjetische Gefangenschaft geraten." Die Franzosen waren strikt antikommunistisch, unterschieden sich jedoch deutlich von den deutschen Ursprüngen der Waffen-SS. In der Wilhelmstraße, wo das Reichssicherheitshauptamt und andere Ministerien verteidigt wurden, führten sie erbitterte Häuserkämpfe. Die "Charlemagne"-Freiwilligen nutzten U-Bahn-Schächte und Keller, um sowjetische Panzer aus dem Hinterhalt anzugreifen. Ein sowjetischer Bericht beschreibt: "Die Franzosen kämpften wie Besessene, sprangen aus den Trümmern und warfen Panzerfäuste, bevor sie zurück in die Dunkelheit verschwanden." Unter ihnen war Paul Briffaut, ein katholischer Priester, der die Kämpfer begleitete. Die Franzosen, oft aristokratische oder royalistische Antikommunisten, sahen im Untergang des Dritten Reichs ihr eigenes Ende. Einer von ihnen beschrieb die Stimmung: "Wir wussten, dass es vorbei war, aber wir kämpften für unsere Überzeugungen, nicht für Deutschland."
Christian de La Mazière war ein Aristokrat, eher Royalist als Nationalsozialist. Er meldete sich nach dem Fall von Paris 1944 zur SS, als der Krieg für jeden offensichtlich verloren war. Er war der letzte Überlebende von Charlemagne, er geriet in Pommern in Gefangenschaft und war in Berlin nicht dabei. In einem Interview beschrieb der Intellektuelle die Stimmung der Kämpfer in den letzten Kriegswochen. "In der Stadt brannten die Häuser. Wände, Gebäude, alles fiel herunter. Der Rauch der Brände, der Staub der berstenden Häuser – manchmal konnte man nicht atmen. Wir wussten nicht, wo wir waren. Wir konnten die Nacht nicht vom Tag unterscheiden. In den Ruhepausen hörten wir die Schreie der Frauen. Es war grauenhaft. Auf uns fiel der Himmel herab. Da war nichts. Wir sprangen in ein Nichts. Hoffnungslos, eine totale Leere. Ein großes Zermahlen. Wir waren nichts. Das Leben hatte keine Bedeutung mehr, wir kümmerten uns nicht um unser eigenes Leben."
Kommandiert wurden die Franzosen von Henri Joseph Fenet. Die Männer der "Charlemagne" waren bekannt für ihren erbitterten Widerstand, insbesondere durch den Einsatz von Panzerfäusten, mit denen sie zahlreiche sowjetische Panzer zerstörten. Zusammen mit Eugène Vaulot und François Appolon erhielt Fenet am 29. April 1945 das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Sie waren die letzten Soldaten, die diese Auszeichnung erhielten. Vaulot fiel in Berlin, Appolon vermutlich ebenfalls. Fenet geriet in Kriegsgefangenschaft, wurde in Frankreich als Kollaborateur verurteilt und betrieb nach seiner Haft einen Autohandel. Er blieb bei seinen Überzeugungen, wurde jedoch keine Galionsfigur der Rechten und lebte zurückgezogen. In einem seltenen Interview sprach er über seine Motivation. Inzwischen füllig geworden, sagte er: "Wir dachten nicht an den Tod. Gar nicht. Nur kämpfen, weiterkämpfen. Wir lebten und kämpften nur, um zu kämpfen."
Quellen: Dokumentation "Le Chagrin et la Pitié" (1971), Zeitzeugen Portal

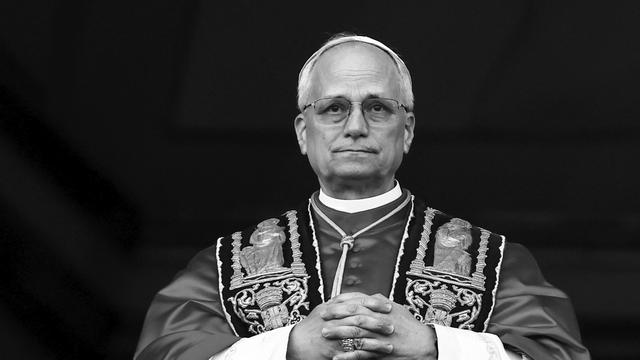















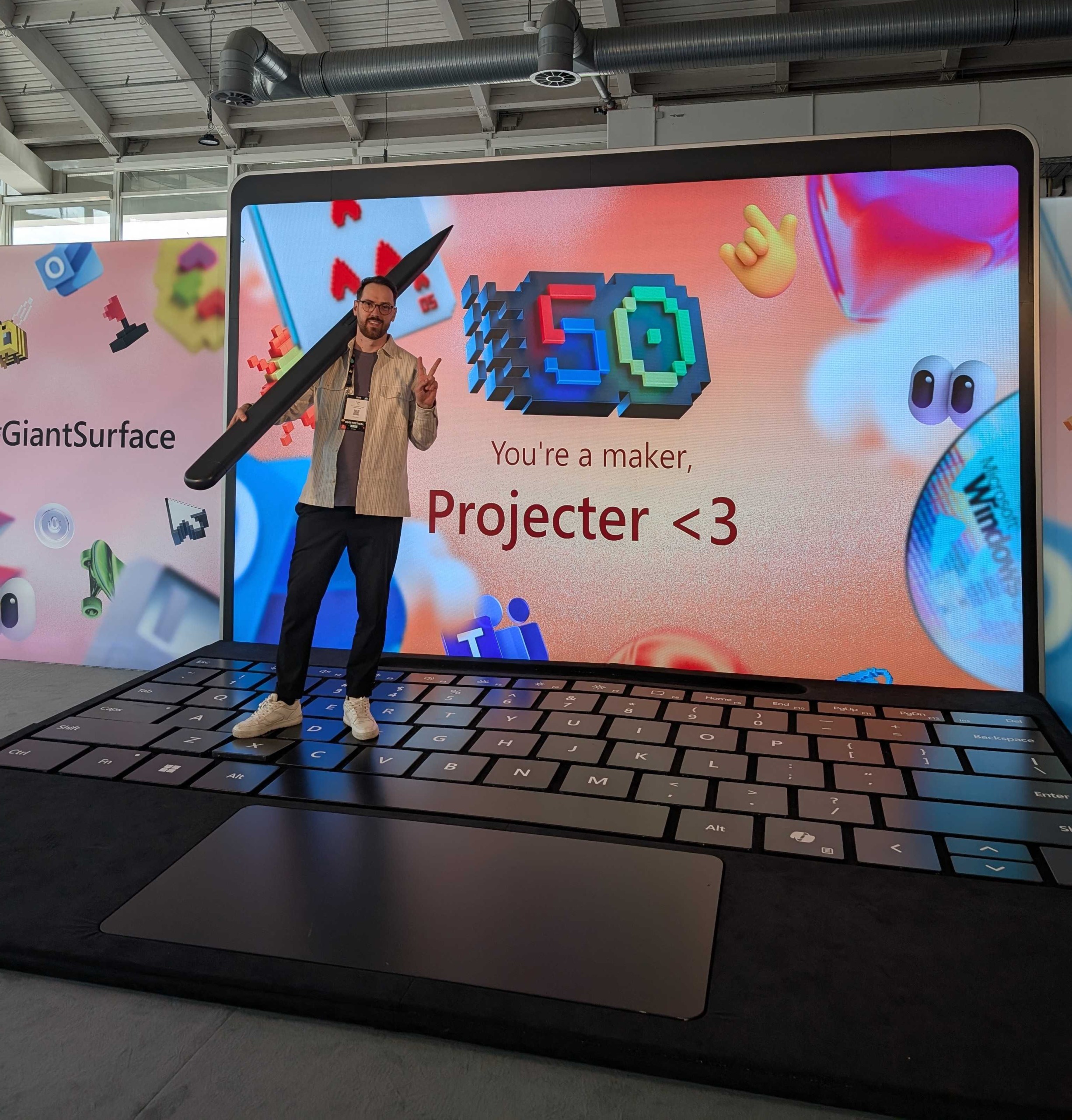



:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/51/c751686510f49bec5115a55ab93b5fee/0124517652v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5d/90/5d905a0b8cc48e8bc465b13c37a07f2e/0124513944v2.jpeg?#)

![Sportförderung, Wirtschaftsförderung oder unnötige öffentliche Ausgaben? [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)






![Deals: Autofahrer aufgepasst - Für ein paar Euro erspart ihr euch, was mich gerade 300€ kostete [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/marderschreck-marderschaden-anti-marder-ultraschall-sensor-autofahren-auto-automobil-versicherung-was-hilft-gegen-marder_6352773.jpg?#)