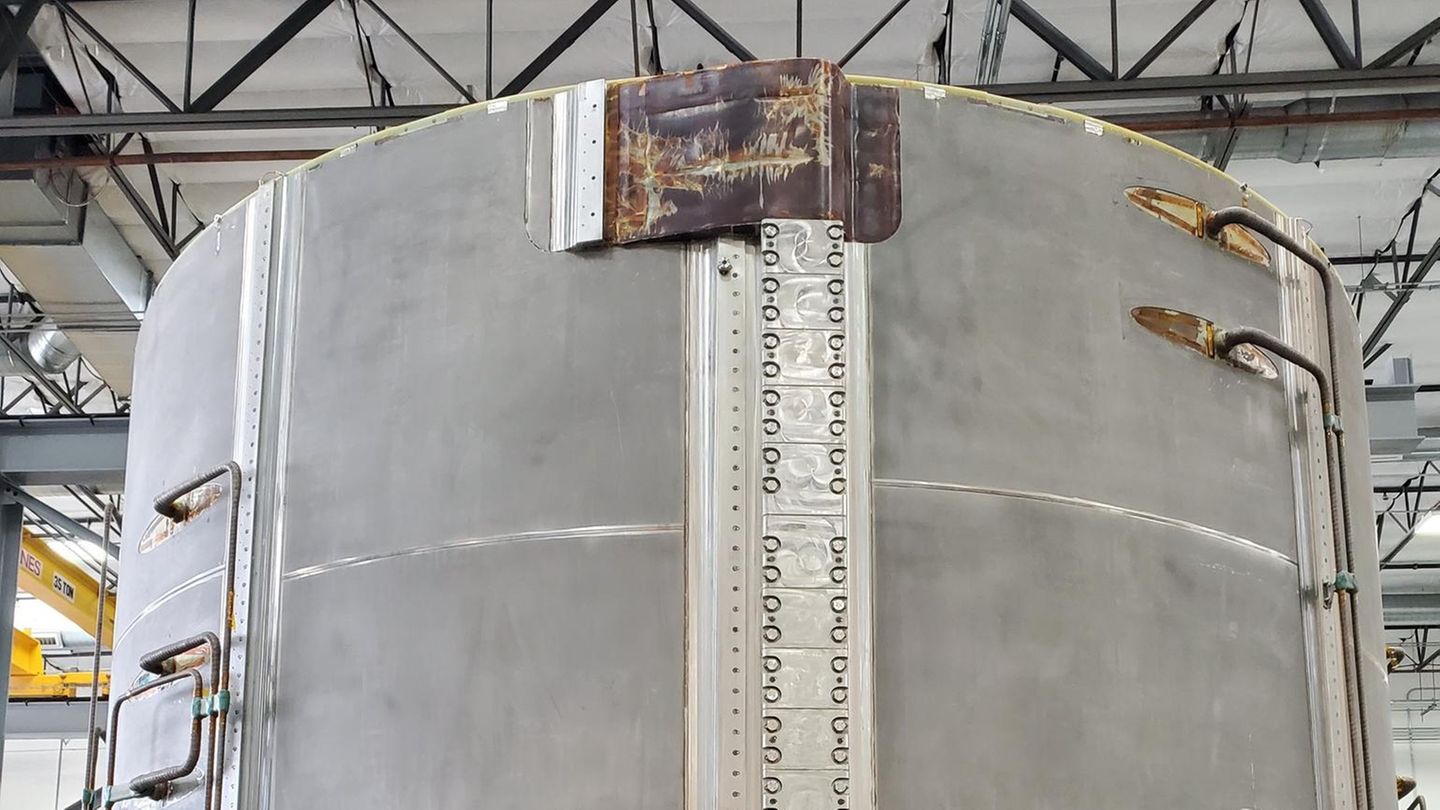Harvard-Studie: Warum Wohlstand nicht automatisch zufriedener macht – und was das Lebensglück prägt
Was macht Menschen wirklich zufrieden? Eine weltweite Studie stellt alte Annahmen infrage – und offenbart beunruhigende Trends unter jungen Erwachsenen

Was macht Menschen wirklich zufrieden? Eine weltweite Studie stellt alte Annahmen infrage – und offenbart beunruhigende Trends unter jungen Erwachsenen
In einem besonders reichen Land zu leben, bedeutet nicht, ein besonders glücklicher Mensch zu sein – das zeigten Studien schon mehrfach. Eine internationale Analyse bestätigt den Einfluss anderer Faktoren – und lässt eine ungute Entwicklung erahnen. Deutschland landet in der Untersuchung lediglich auf Platz 17 der 22 betrachteten Länder. Nachbesserungsbedarf gibt es demnach hierzulande vor allem beim Wohnen, der Gesundheit und dem Gefühl von Zugehörigkeit.
Länder erstellen eine Vielzahl von Statistiken etwa zu Beschäftigung, Lebenserwartung und Bruttoinlandsprodukt, wie die Forschenden in einer Leitstudie im Fachjournal "Nature Mental Health" erläutern. "Diese objektiven Messgrößen erfassen Schlüsselaspekte des "Wohlbefindens" von Nationen, sind aber schlechte Prädiktoren für das Wohlbefinden von Einzelpersonen", schreiben sie.
Fünf Umfragewellen sind geplant
Im Zuge der "Global Flourishing Study" untersucht das Team um Tyler VanderWeele von der Harvard University in Cambridge in insgesamt fünf Umfragewellen bis 2027, unter welchen Bedingungen Menschen verschiedener Kulturen und Gesellschaften zu umfassendem Wohlbefinden aufblühen. Daten der ersten Welle, die überwiegend 2023 erfasst wurden, liegen nun vor. Mehr als 20 aktuell präsentierte Studien befassen sich mit einzelnen Aspekten. Berücksichtigt wurden Länder wie Nigeria, Kenia, Mexiko, die Philippinen, Deutschland und Australien.
Die Umfrage zeigt eine überraschende Abweichung, wie das Team der Leitstudie berichtet: Klassischerweise formt das Wohlbefinden im Lebenslauf ein U: Menschen fühlen sich in jüngeren Jahren und als Senioren wohler als in der Lebensmitte, die oft von vielen beruflichen und privaten Verpflichtungen geprägt ist. Doch nun blieb der Wohlbefinden-Index im Mittel der 22 Länder bis zum 50. Lebensjahr im Wesentlichen gleich und stiegt erst danach mit dem Alter an. In Spanien wies die jüngste Altersgruppe (18- bis 24-Jährige) sogar das niedrigste Wohlbefinden auf.
Geht es der jungen Generation schlechter?
Das Muster gelte nicht nur insgesamt, sondern auch für die meisten spezifischen Indikatoren wie Optimismus, innerer Frieden und Empfinden von Sinnhaftigkeit. "Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit anderen neueren Forschungsergebnissen in Ländern mit hohem Einkommen, die darauf hindeuten, dass jüngere Jahrgänge mehr Probleme haben könnten als frühere Generationen", erläutern die Forschenden.
Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung von mehr als 200.000 Menschen in 22 kulturell und geografisch unterschiedlichen Ländern, die alle sechs bewohnten Kontinente abdecken und fast die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren. Der errechnete Index umfasst je zwei Indikatoren für sechs Bereiche: Glück, Gesundheit, Sinn, Charakter, Beziehungen und finanzielle Sicherheit. In Deutschland wurden rund 9.500 Menschen einbezogen. Geplant sind vier weitere Erhebungswellen bei derselben Gruppe von Befragten.
Indonesien ganz vorn, Japan als Schlusslicht
Menschen aus Indonesien gaben die höchsten Selbsteinschätzungen zu einer breiten Palette von Indikatoren ab, heißt es in der Leitstudie. Die Bewertungen der japanischen Befragten wiederum seien bei den meisten Indikatoren die niedrigsten unter den 22 untersuchten Ländern.
Wenig überraschend gaben Menschen in Ländern mit hohem Einkommen wie Schweden und den USA vergleichsweise hohe Werte für die materiellen Aspekte des Wohlbefindens wie finanzielle Sicherheit an. Sie empfinden jedoch im Mittel weniger prosoziales Verhalten im Umfeld, ein geringeres Gefühl von Sinnhaftigkeit und eine geringere Beziehungszufriedenheit als Menschen in vielen Ländern mit mittlerem Einkommen. "Dies deutet darauf hin, dass materielle und soziale Aspekte des Wohlbefindens nicht unbedingt übereinstimmen", heißt es dazu. Reichtum schütze nicht vor Einsamkeit, gesellschaftlicher Spaltung oder dem Gefühl von Sinnlosigkeit.
Die Kindheit ist ein entscheidender Faktor
Einfluss auf das Wohlbefinden hatte der Umfrage zufolge unter anderem auch, ob der oder die Befragte in der Kindheit ein gutes Verhältnis zu Mutter und Vater hatten und ob die Eltern verheiratet waren. Auch die eigene Gesundheit in der Kindheit und der damalige finanzielle Status der Familie spielten eine Rolle. Das Gefälle im Wohlbefinden abhängig vom subjektiven finanziellen Status in der Kindheit sei bemerkenswert, erläutern die Forschenden. Wurde es rückblickend als schwierig eingestuft, über die Runden zu kommen, lag das aktuelle Wohlbefinden im Mittel merklich unter dem bei einer als komfortabel empfundenen Kindheit.
In den meisten Ländern berichten der Studie zufolge Verheiratete über ein deutlich höheres Wohlbefinden als Alleinstehende - aber nicht in allen: In Indien und Tansania lag es bei Alleinstehenden höher. Der Besuch religiöser Treffen wie Gottesdienste war einer der Faktoren, die länderübergreifend am stärksten mit subjektivem Wohlbefinden assoziiert waren. Die Unterschiede in Bezug auf den Einwanderungsstatus oder zwischen Männern und Frauen waren hingegen relativ gering.
Hat der Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung Nachteile?
Für etwas, das so zentral für unser aller Leben ist, seien die Forschungsbemühungen zum Thema Wohlbefinden bisher erschreckend unzureichend, gibt das Team um VanderWeele zu bedenken. Die negative Beziehung zwischen dem Empfinden von Sinn und dem Bruttoinlandsprodukt sei auffällig und bestätige frühere Arbeiten. Es sei zu hinterfragen, wie wirtschaftliche Entwicklung erreichbar werde, ohne dass Menschen ihr Leben als weniger sinnhaft empfänden.
Es sei denkbar, dass das festgestellte Auseinanderstreben zwischen materiellen und humanistischen Formen des Wohlbefindens zum großen Teil auf die abnehmende Religiosität wirtschaftlich fortgeschrittenerer Nationen zurückgehe, heißt es zu den Daten auch. "Haben wir im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung und der Säkularisierung manchmal die mächtigen spirituellen Wege zum Wohlbefinden vernachlässigt oder sogar unterdrückt?" Möglicherweise müssten solche Wege neu bedacht werden.
Fragen können ganz unterschiedlich verstanden werden
Zu den Einschränkungen der Analyse zählen die Forschenden, dass einzelne Fragen durch die Übersetzung verschieden aufgefasst werden können und dass kulturelle Unterschiede bei der Bewertung eine Rolle spielen. "Selbst die Wahrnehmungen auf nummerierten Antwortskalen können von Land zu Land unterschiedlich sein", wird erläutert. "In einigen ostasiatischen Ländern ziehen es die Menschen beispielsweise vor, sich in der Mitte der Skala zu bewegen, da extreme Werte angeberisch oder unerwünscht erscheinen können."
Die Ergebnisse der "Global Flourishing Study" sollen grundlegendes Wissen zur Förderung gesellschaftlichen Wohlergehens bereitstellen. Ein Ziel sei, Gruppen zu identifizieren, auf die Interventionen oder politische Maßnahmen zur Verbesserung des Wohlbefindens ausgerichtet werden können.
Mehr fragen, um mehr verbessern zu können
Jährliche nationale Datenerhebungen zu für das jeweilige Land wichtigen Aspekten seien wünschenswert. Großbritannien zum Beispiel habe 2011 begonnen, Daten zu Aspekten wie Lebenszufriedenheit und Ängsten zu erheben. "Eine ähnliche, aber umfassendere Datenerhebung würde den Nationen helfen, mehrere Dinge zu verstehen: was gut läuft und was nicht; wer Hilfe braucht und auf welche Weise; wie sich die Dinge im Laufe der Zeit verändern; und was sich verbessert und was nicht."
Eine der "Global Flourishing Study" im Grundsatz ähnliche Analyse ist der jährlich zum Weltglückstag am 20. März veröffentlichte Weltglücksbericht der Vereinten Nationen. Dort fließen neben der Wirtschaftsleistung ebenfalls Faktoren wie die empfundene Großzügigkeit, das Vertrauen in die Freundlichkeit anderer sowie die wahrgenommene Lebensqualität ein.
Im Jahr 2024 waren - zum achten Mal in Folge - demnach die Finnen die glücklichste Bevölkerung der Erde. Indonesien belegt Rang 83, Japan hingegen Rang 55 - und Deutschland liegt hier auf dem 22. Platz. Die Ergebnisse weichen also deutlich von denen der "Global Flourishing Study" ab.
Bhutan hat schon vor Jahren einen Index fürs Glücklichsein eingeführt, den "Gross National Happiness Index" (GHI), der neben sozialen Faktoren auch Umweltaspekte einbezieht. Eine Maßgabe dafür ist die Förderung kultureller Werte: Religion und Kultur besitzen bei Bhutanern hohen Stellenwert. Auch andere Länder wie Island, Neuseeland und Australien haben das Nationalglück inzwischen verstärkt im Blick.





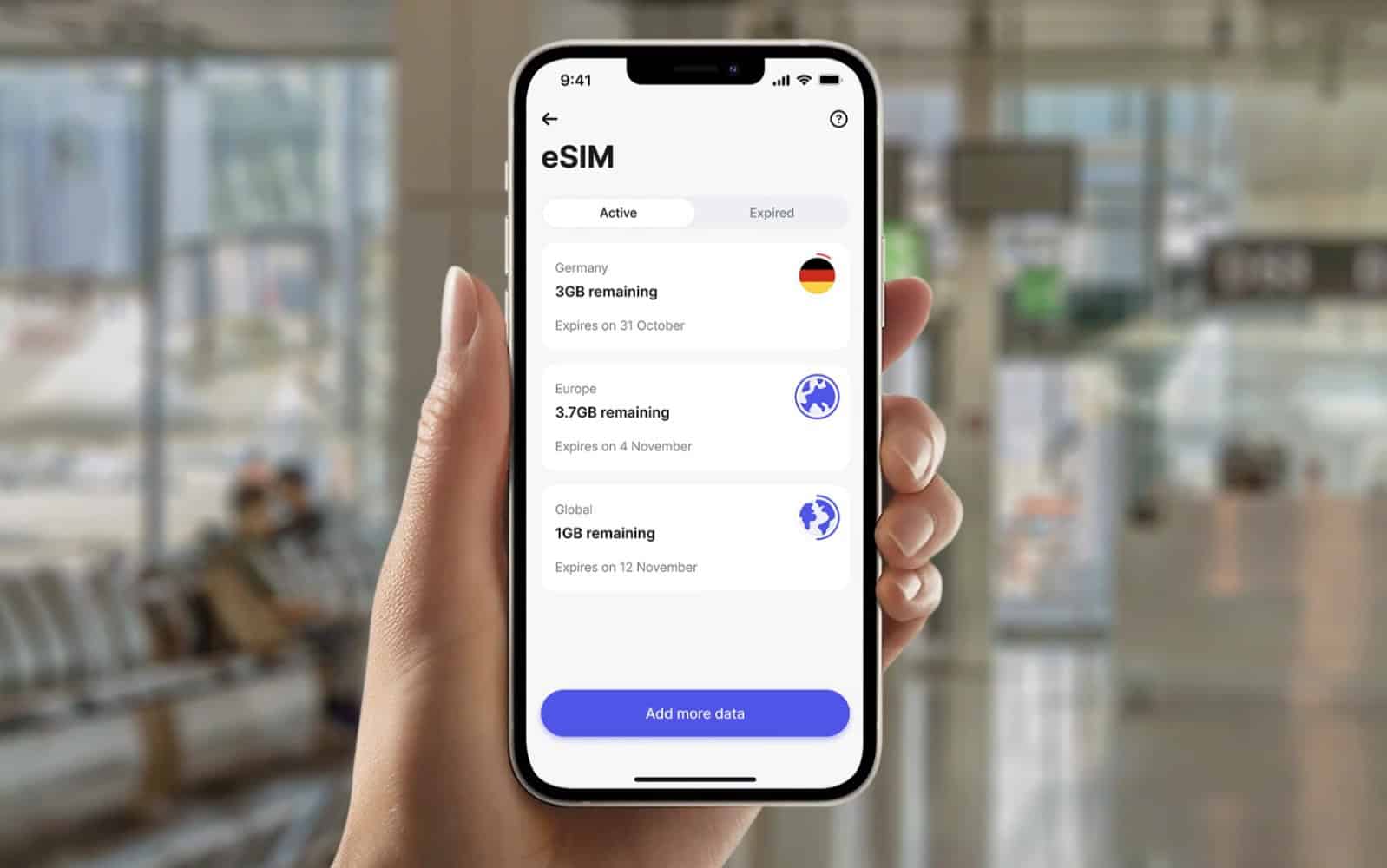











:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a3/b0/a3b0754c88406cb433faaff959451fba/0123842415v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ba/18/ba18bdcea8c7d9b03e41a133eb791206/0124239424v1.jpeg?#)