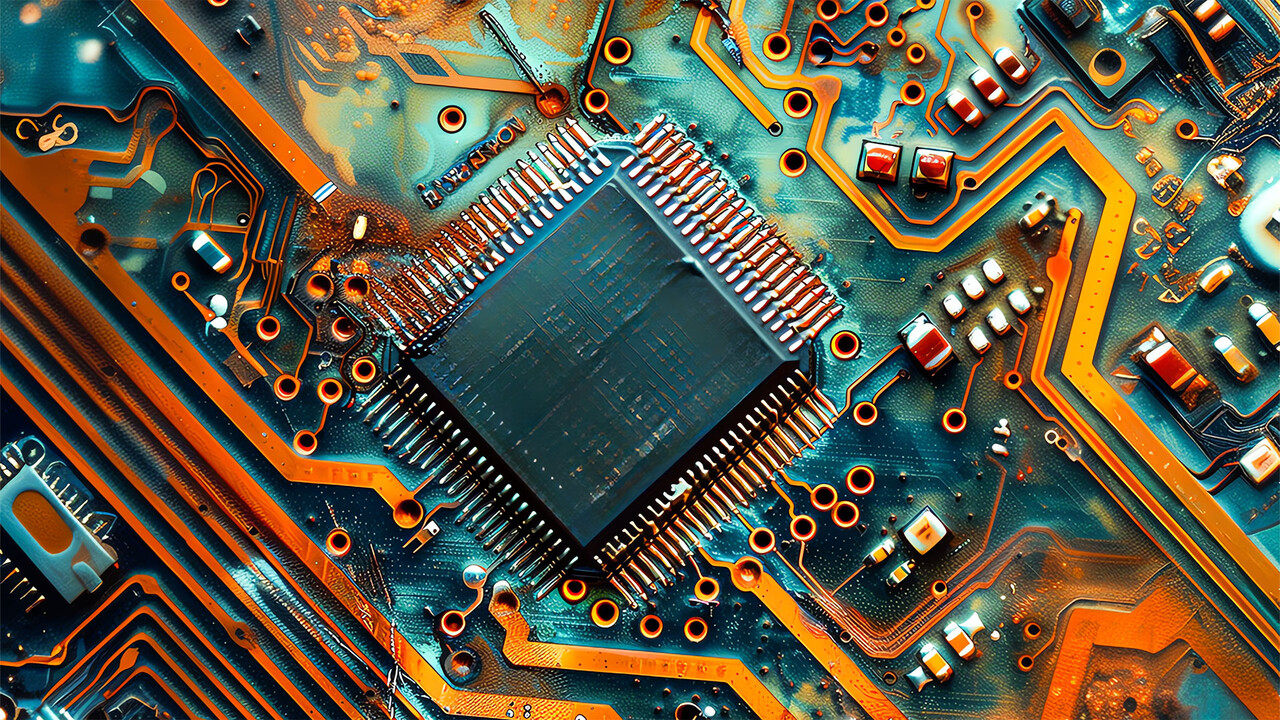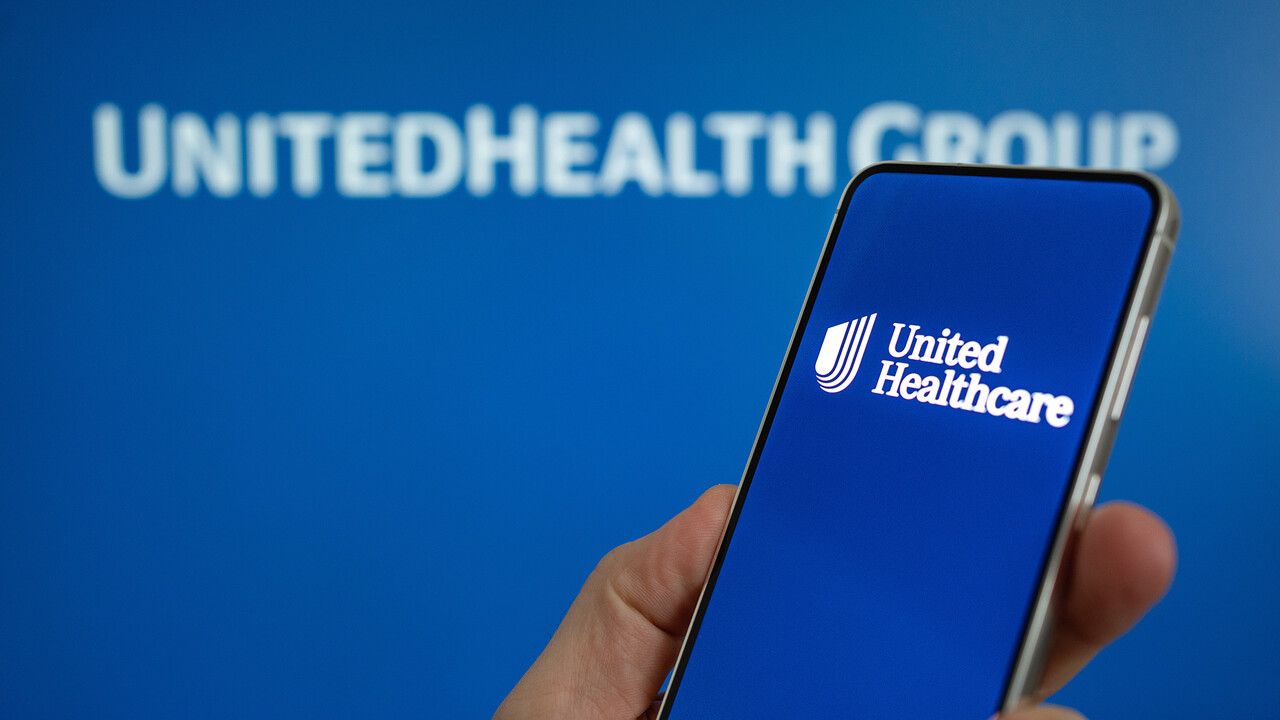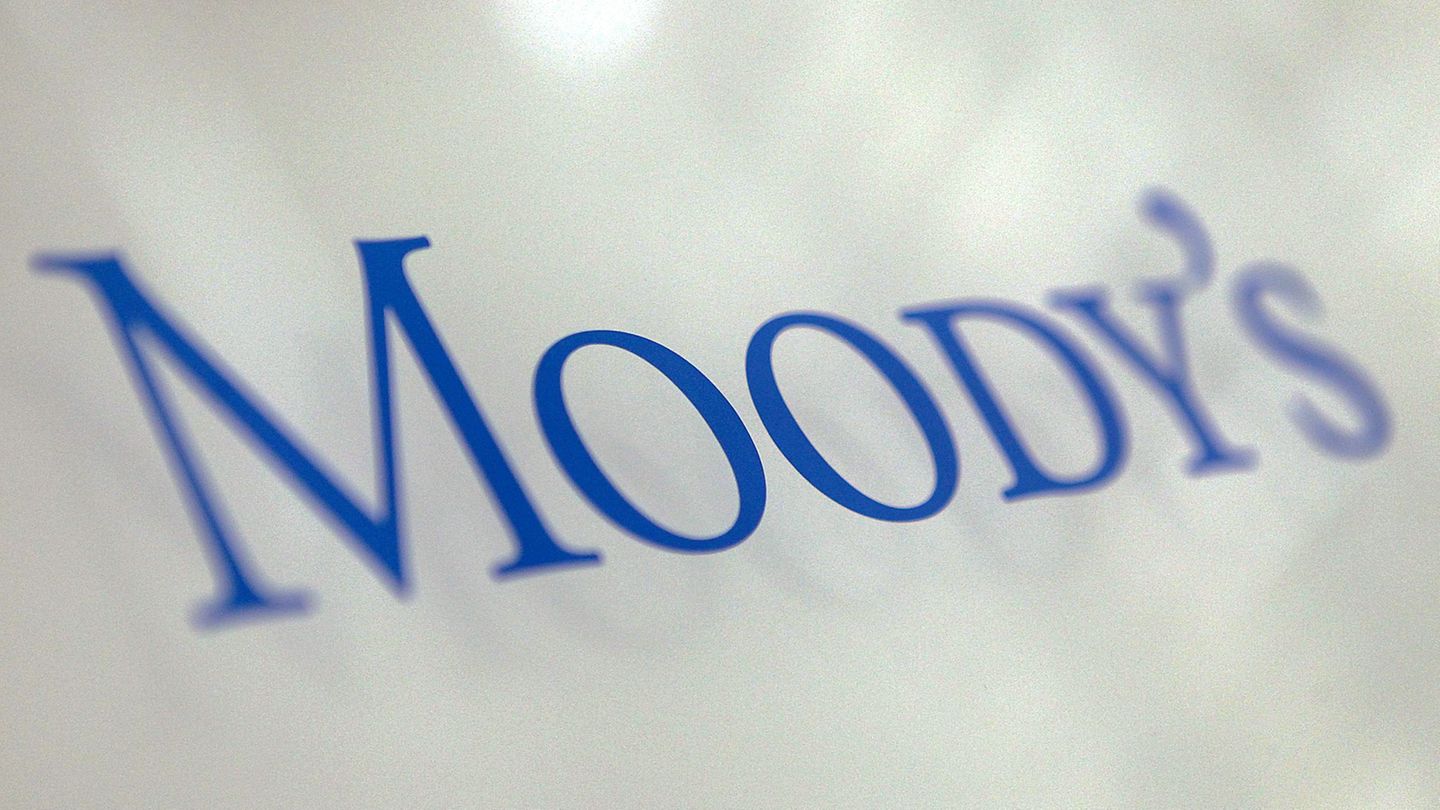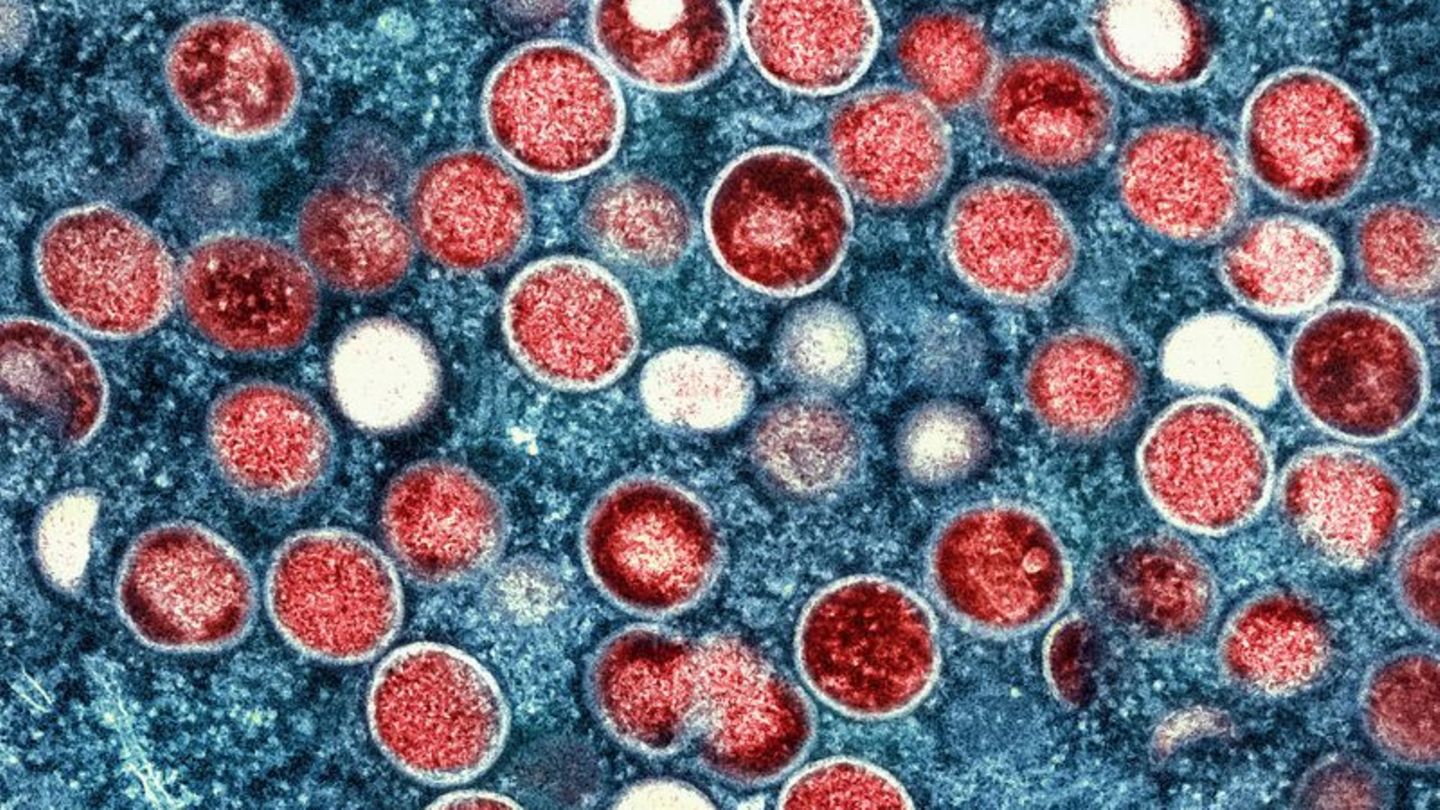Psychologe verrät: Wie unser Gehirn uns hypersensibel für verbale Angriffe macht
Laut dem Psychologen Charles Browning fühlen wir uns viel zu oft angegriffen. Warum das so ist und wie wir weniger empfindlich werden können.
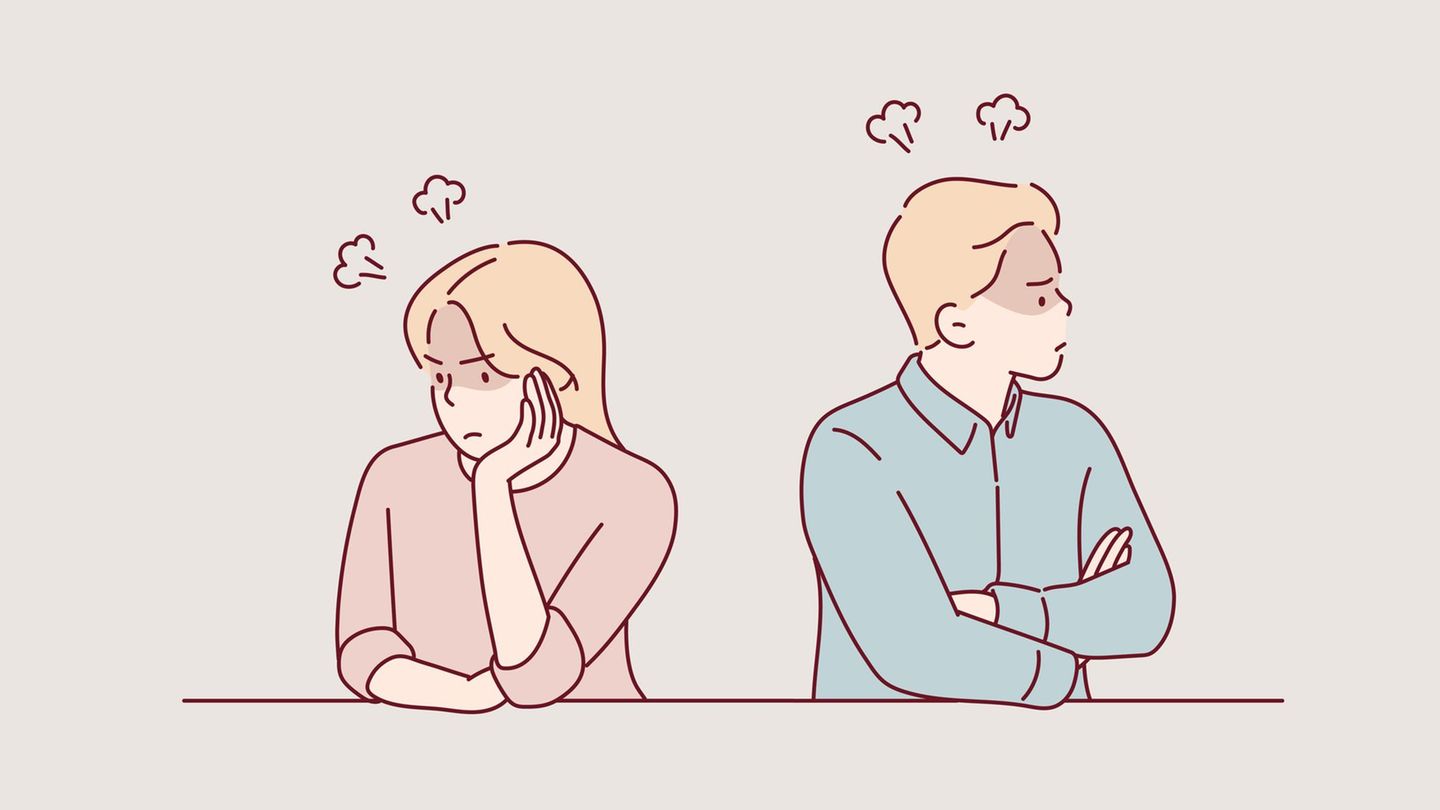
Laut dem Psychologen Charles Browning fühlen wir uns viel zu oft angegriffen. Warum das so ist und wie wir weniger empfindlich werden können.
"Seid ihr nicht ein bisschen warm angezogen?"
24 Grad bei strahlend blauem Himmel – an einem Feiertag. In Hamburg ungefähr so selten wie die Geburt von menschlichen Fünflingen auf natürlichem Wege. Ich treffe mich mit meiner besten Freundin und einem Freund zu einer Fahrradtour – was sonst. Ich in T-Shirt, kurzer Hose und Turnschuhen, er in Jeans und seinem ordentlich gebügelten Standard-Karohemd, meine Freundin wie immer unangestrengt schick.
"Heute Nacht wird es sicher kalt."
Mein Freund hat im Gegensatz zu mir am nächsten Tag frei und möchte offenbar lange machen.
Als meine Freundin und ich unterwegs auf die Idee kommen, auf der Dachterrasse eines Hotels auf einen Drink einzukehren, äußert mein Freund den Satz, der vermutlich bis an mein Lebensende ein zentrales Element meiner Erinnerung an diesen einzigartigen und insgesamt wunderschönen Feiertag und unsere Fahrradtour bleiben wird:
"Dafür sind wir gerade wohl nicht richtig angezogen."
Sofort setzt bei mir eine Schockstarre ein – meine typische Reaktion, wenn ich mich angegriffen fühle. Offensichtlich meinte mein Freund mich, auf Nachfrage gab er das später auch zu. Aber hat er mich tatsächlich angegriffen?
Der "Negative Bias" hypersensibilisiert uns für Angriffe
Laut dem Psychologen Charles Browning sind wir neurologisch dazu prädestiniert, uns leichter und öfter angegriffen zu fühlen, als es objektiv betrachtet angebracht wäre.
In hohem Maße liege das am sogenannten "Negative Bias". Dieses Phänomen unserer Psyche lässt uns negative Dinge – zum Beispiel Fehler, Gefahren, Angriffe, Planabweichungen – eindringlicher erleben und stärker wahrnehmen als positive – Erfolge, Komplimente, Sicherheit, wenn alles reibungslos läuft. In der Psychologie zählt der "Negative Bias" zu den kognitiven Verzerrungen: Eigenheiten unserer Seele, die unseren Eindruck von der Welt in einer spezifischen Weise prägen oder "verzerren".
Wie den meisten kognitiven Verzerrungen wohnt diesem "Negative Bias" eine Intelligenz inne, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt: Offensichtlich kommt es unserer Stimmung oder Zufriedenheit nicht zugute, negativen Dingen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als positiven. Doch evolutionsbiologisch betrachtet erhöhte es unsere Chance zu überleben.
Der Psychiater Kevin Dutton veranschaulicht das in seinem Buch "Black and White Thinking" an folgendem Beispiel: Wenn wir durch eine Steppe spazieren und aus dem Augenwinkel einen Stock am Rand des Weges liegen sehen, werden wir ihn im ersten Moment tendenziell für eine Schlange halten und erschrocken stehenbleiben oder zur Seite ausweichen. Eine unnötige Überreaktion, die wir aber ohne Weiteres überleben. Wäre dieser Stock hingegen wirklich eine Schlange und wir würden einfach weiter gehen mit der Geisteshaltung "wird schon keine Schlange sein", würde das Reptil uns beißen und wir nicht so ohne Weiteres überleben.
Unsere Hypersensibilität gegenüber Negativem ist also eigentlich eine Übervorsicht, deren Sinn nicht darin liegt, unser Leben zu vermiesen, sondern es zu sichern.
Im sozialen Bereich erhöht sie unsere Empfänglichkeit für Kritik, Beleidigung und Angriffe und fördert entsprechende Überreaktionen: Schließlich könnte es ja sein, dass unsere Gemeinschaft uns ausschließt oder uns eine Position zuweist, die wir nicht haben wollen, wenn wir anecken oder negativ auffallen. Deshalb fassen wir eher die eine oder andere harmlose Äußerung als Angriff auf, als stets davon auszugehen, es sei schon alles nett gemeint, was andere zu uns sagen.
Der "Confirmation Bias" lässt Angriffe wie Bestätigungen erscheinen – insbesondere bei unverarbeiteter Scham
Neben dem "Negative Bias" kann laut Charles Browning auch der "Confirmation Bias", der "Bestätigungsfehler", dazu führen, dass wir Aussagen unserer Mitmenschen als Beleidigungen auffassen: Durch diese kognitive Verzerrung sind wir geneigt, Elemente unserer Wahrnehmung als Bestätigung unserer verinnerlichten Thesen, Erwartungen oder Befürchtungen aufzufassen. Wenn ich zum Beispiel selbst schon immer befürchtet habe, dass andere Menschen meinen Kleidungsstil anstößig oder unangemessen finden könnten, genügt mir ein Satz eines einzigen Freundes, um mich darin bestätigt zu fühlen – selbst wenn mir eine beste Freundin und drei andere Personen sagen, er sei völlig okay.
Besonders gilt das, wenn wir unverarbeitete Scham mit uns herumschleppen, ein Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswürdig, nicht wertvoll. Scham, Schuld und Angst wirken wie Magneten auf alles potenziell Herabwertende und Beleidigende, das andere Menschen uns gegenüber äußern, schreibt Charles Browning in "Psychology Today".
Was hilft
Der Psychologe regt grundsätzlich dazu an, uns individuell darum zu bemühen, uns weniger angreifbar zu machen beziehungsweise uns weniger leicht angegriffen zu fühlen. Denn, so schreibt er:
Umso schwerer es für Menschen ist, dich anzugreifen, desto weniger Kämpfe hast du auszutragen.
Erreichen können wir dieses Ziel nach Erfahrung von Charles Browning über folgende drei Schritte:
Unseren Gedankengang erfassen
Was genau sagen wir uns eigentlich? Wie interpretieren wir die Aussage, die wir als Angriff verstehen? Als mein Freund äußerte, dass wir gerade nicht richtig angezogen seien, habe ich so etwas gehört wie: "Du siehst unmöglich aus" oder "so wie du herumläufst, bist du mir peinlich".
Das Narrativ ändern
Welche Möglichkeiten gibt es noch, die fragliche Aussage zu verstehen? Bei meinem Beispiel: Mein Freund könnte einfach der Meinung sein oder gar wissen, dass es einen gehobenen Dresscode für jene Dachterrasse gibt, der T-Shirt und kurze Hose ausschließt.
Den Fokus verschieben
Hat die Situation irgendetwas Positives? Bei näherer Betrachtung hat mein Freund sich sehr vorsichtig ausgedrückt, indem er gesagt hat, WIR seien nicht richtig angezogen. Offenbar wollte er mir nicht zunahe treten, was ja eigentlich nett von ihm ist.
Was ich in diesem Zusammenhang ebenfalls hilfreich finde, ist eine Anregung, die die Psychologin Alexandra Zäuner mir einmal in einem Gespräch gegeben hat:
Die Anteile der anderen sehen und bei ihnen lassen
Mein Freund ist offensichtlich konservativer, befangener und schambehafteter als ich, wenn es um Kleidungsstil geht und um die Frage, was sich gehört. Ehe ich mich selbst wegen meiner Klamotten einer Dachterrasse verweise, würde ich zumindest einmal fragen, ob es einen Platz für mich gibt. Und: Falls meinem Freund mein Kleidungsstil unangenehm ist oder in jener Situation war, ist das sein Problem und nicht meins.
Für mich ist es mittlerweile okay, dass mein Freund mit mir in T-Shirt und kurzer Hose eine bestimmte Dachterrasse nicht besuchen möchte. Vermutlich wird der nächste warme, sonnige Feiertag in Hamburg ohnehin auf sich warten lassen.