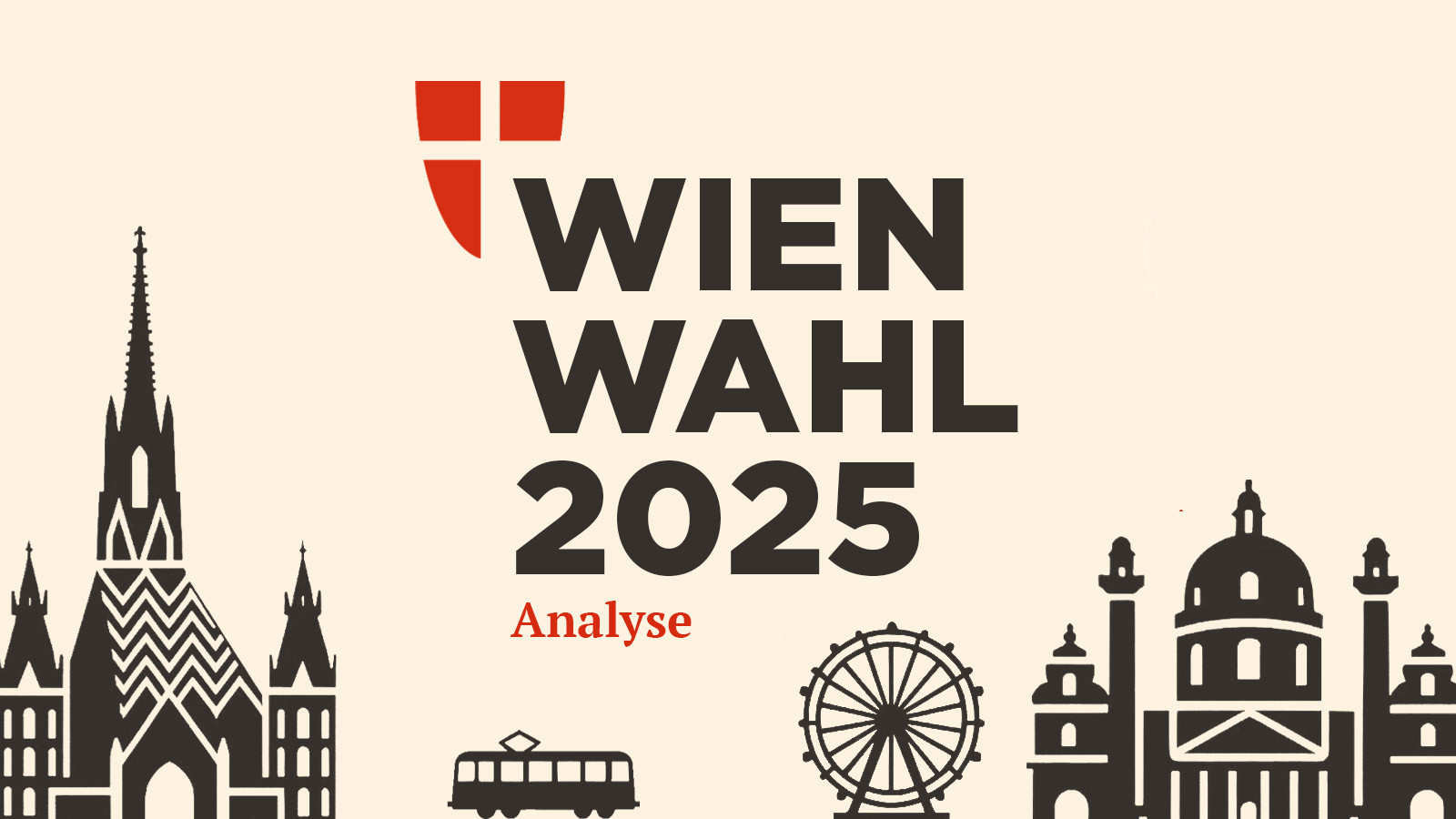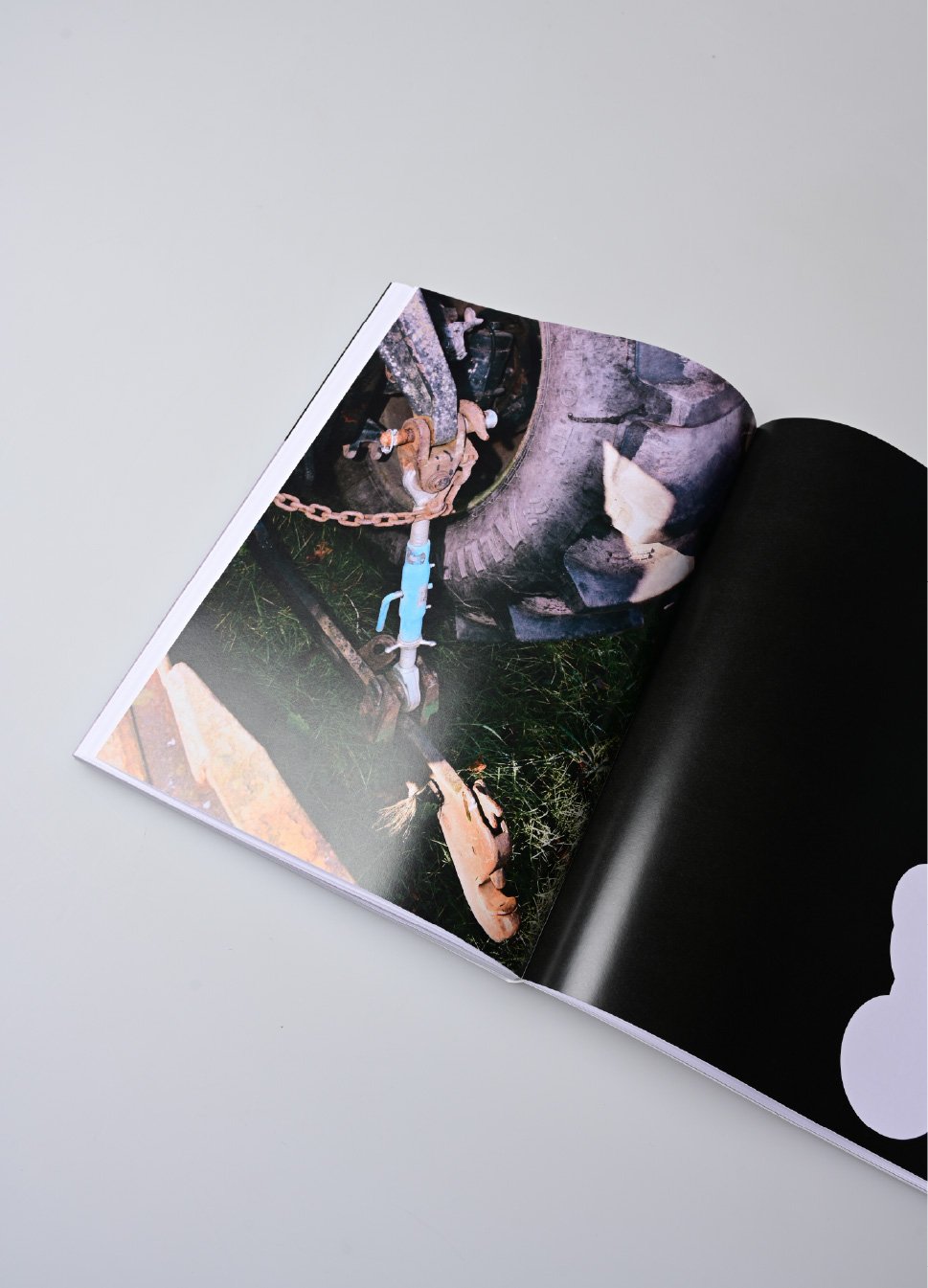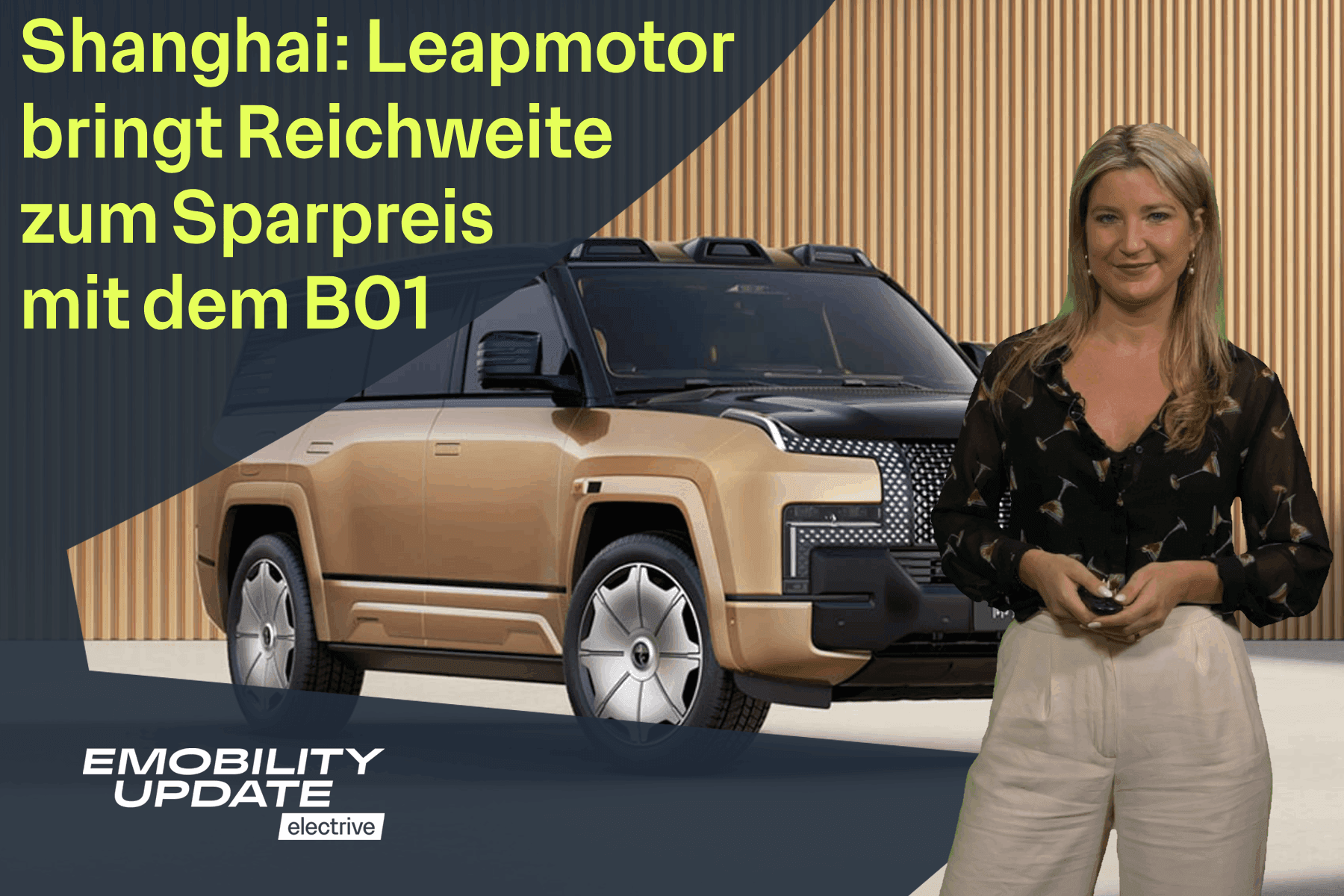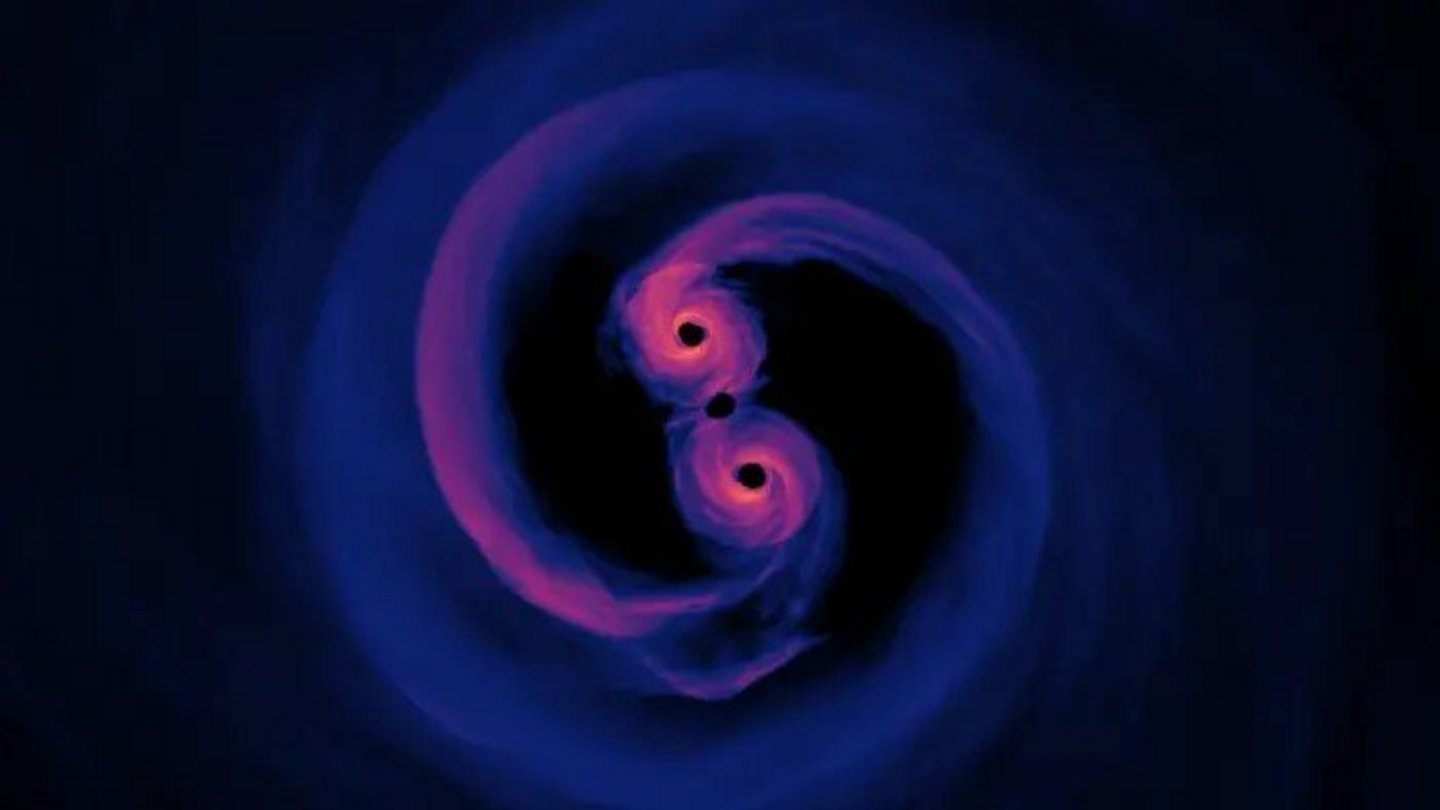Papsttum: Zwei Lehren aus der Geschichte: Wie die Kirche aus Krisen zu Stärke fand
Immer wieder hat die römisch-katholische Kirche schwere Krisen überstanden. Der Historiker Volker Reinhardt erklärt, wie – und was alte Strategien heute bewirken könnten

Immer wieder hat die römisch-katholische Kirche schwere Krisen überstanden. Der Historiker Volker Reinhardt erklärt, wie – und was alte Strategien heute bewirken könnten
GEO: Herr Professor Reinhardt, die römisch-katholische Kirche steckt – so heißt es immer wieder – in einer schweren Krise. Nun hat die Kirche im Laufe ihrer langen Geschichte bereits zahlreiche Krisen überstanden. Welche Strategien haben sich in der Vergangenheit bewährt?
Prof. Volker Reinhardt: Ich sehe zwei gängige Krisenbewältigungsmuster: Entweder hat sich die Kirche als verfolgte, duldende Institution dargestellt und sich auf diese Art bewährt, oder sie hat eine auf Imagebereinigung und Abgrenzung zu feindlichen Kräften gerichtete Reform durchgeführt.
Was meinen Sie damit genau?
Ein Beispiel: Ende des 18. Jahrhunderts rutschte die römisch-katholische Kirche in eine schwere Krise. Die Erzählung von der Jungfrauengeburt, von der Wiederauferstehung Jesu, vom Jüngsten Gericht: Das alles passte überhaupt nicht zum Zeitalter der Aufklärung, die auf Vernunft und Empirie ausgerichtet war. Der Papst galt in weiten Teilen Europas als korrupter, schlechter Herrscher eines maroden Staatswesens und Verfechter einer irrationalen Ideologie. Europäische Intellektuellenkreise sahen das Papsttum am Ende.
Und was ist dann passiert?

© privat
Während der Französischen Revolution und unter Napoleon wurden Päpste von französischen Kräften gestürzt, aus Rom entführt, gar gefangen gesetzt. Trotzdem hat diese leidende, verfolgte Kirche gegenüber den Revolutionären in Frankreich nicht nachgegeben, sondern sich entgegengestellt. Im folgenden Zeitalter der Romantik, ab etwa 1815, suchten die Menschen in Europa – nach Revolution und Bürgerkrieg– nach einer beschützenden Macht, die sie mit der Natur und Gott versöhnt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte der Katholizismus eine rasante Auferstehung.
Das klingt so, als hätte die Kirche einfach abgewartet, bis der Sturm vorüberzieht.
Nein. In Frankreich strebten die Jakobiner zwischenzeitlich nach einer regelrechten Entchristianisierung. Tausende Priester wurden in der Loire ertränkt. Die Kirche hat Stellung bezogen und Opfer gebracht. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Christentum eine auf dem Blut von Märtyrern aufgebaute Religion ist. Daran knüpfte man zur Zeit der Französischen Revolution an. Indem die Kirche den politischen Umwälzungen, die als gottlos angesehen wurden, Widerstand leistete, fand sie auch zu einer alten Funktion zurück – nämlich einer Aufsichtsfunktion gegenüber dem Staat. Die Kirche muss, so ihr bis heute geltendes Selbstverständnis, den Staat denunzieren, wenn dieser unmenschlich wird. Damals hat die Kirche aus einer existenziellen Krisensituation zu neuer Stärke gefunden.
Als zweite Strategie der Krisenbewältigung haben Sie Abgrenzung und Imagebereinigung genannt. Was können wir uns darunter vorstellen?
Diese Strategie lässt sich sehr gut im 16. Jahrhundert nachverfolgen, während der Reformationen. Auf die protestantischen Bewegungen antwortete die Kirche, indem sie ihr äußeres Erscheinungsbild erneuerte und dazu überging, das Image einer auf Seelsorge und Nächstenliebe ausgerichteten Institution zu erzeugen. Dazu hat man einige Missstände abgestellt, etwa den Nepotismus etwas reduziert und den ausschweifenden Lebensstil von Klerikern bereinigt. Gleichzeitig grenzte sich die Kirche in Rom von den Protestanten ab und hob die Unterschiede hervor – zum Beispiel die menschliche Willensfreiheit und die Überzeugung, dass der Mensch vor Gott Verdienste erwerben, also durch gute Taten Heil gewinnen kann. Im Prinzip stellte die Kirche klar, was katholisch ist und was nicht, und machte den Menschen so ein Angebot. Auf dem Reformkonzil von Trient zwischen 1545 und 1563 wurden diese Klarstellungen in schriftliche Form gebracht.
Als ein Krisensymptom der römisch-katholischen Kirche gilt heute ihre innere Zerrissenheit. War das damals auch schon ein Problem?
Absolut. Im 16. Jahrhundert gab es – heute würden wir sagen – liberale Flügel, die zu Kompromissen mit den Protestanten bereit waren. Letztlich setzten sich aber die Hardliner durch, die gegen jede Abweichung in der theologischen Lehre vorgingen. Im Laufe der damaligen katholischen Erneuerung wurde der progressive Flügel radikal abgetrennt: Viele Kleriker verließen Italien oder endeten vor der Inquisition. Die Definition dessen, was katholisch sein sollte, war damals mit starken Ausgrenzungsprozessen verbunden. Letztendlich hat die Verengung der Lehre die Substanz der römisch-katholischen Kirche bewahrt, muss man rückblickend feststellen.
Heißt das für die aktuelle Debatte über die Zukunft der römisch-katholischen Kirche, dass der Vatikan gar keine Änderungen anstreben sollte?
Das würde ich so nicht sagen. Wahrscheinlich hat Papst Benedikt XVI. eine theologische Verengung angestrebt: Meiner Meinung nach wollte er zurück zur reinen katholischen Lehre und diesem Supermarkt-Katholizismus Grenzen setzen, in dem Gläubige sich an einem Grundbestand Katholizismus bedienen und einfach – wie es ihnen passt – Elemente aus Buddhismus und Esoterik hinzupacken. Allerdings glaube ich, dass solch eine Verengung heutzutage keine Chance hat. Wir leben in einem Zeitgeist, in dem sich die Menschen keine Dogmen mehr vorschreiben lassen.
Aber als Institution der Märtyrer – die zweite von Ihnen genannte Krisenstrategie – kann sich die Kirche doch heute auch nicht darstellen?
Tatsächlich lebt diese alte Strategie fort: Papst Franziskus I. hat sein Amt trotz schwerer Krankheit vor aller Augen bis zum letzten Atemzug erfüllt. Das macht ihn zum Märtyrer. Das Leiden zum Zweck der Wahrheitsverkündung und als Beweis der Gottgewandtheit gehört seit jeher zum Repertoire der Kirche. Ein solcher Akt vermittelt Glaubwürdigkeit: Die Kirche benötigt – wie jede Bewegung – Personen, die man verehren und auf die man sich berufen kann, die Energie einflößen.
Doch das allein wird die Kirche wohl kaum aus der Krise führen.
Das denke ich auch nicht. Die Frage ist letztlich: Wie weit kann sich die Kirche öffnen, ohne aber – in der Selbstwahrnehmung – die eigene Substanz zu verlieren? Die nächsten Jahre werden zeigen, ob zum Beispiel ein neues Konzil der Kirche zu einem neuen Erscheinungsbild und damit auch Image verhelfen könnte. Wirklich große Veränderungen – etwa die Zulassung von Frauen zum Priesteramt – sehe ich auf absehbare Zeit aber nicht.






















:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/81/bb818e1bdddd5bedf0c7b942fe8d5988/0123358373v1.jpeg?#)


,regionOfInterest=(1423,858)&hash=26a998ba5ca83843bc4c7cfb1bf6fe2ad02f982b0b03e35647d121873baea778#)
,regionOfInterest=(731,305)&hash=ce5dbbfc3598bb1de8b0c69c2e1f301ad60636a1e818c7a5b18e941776d9f1f3#)