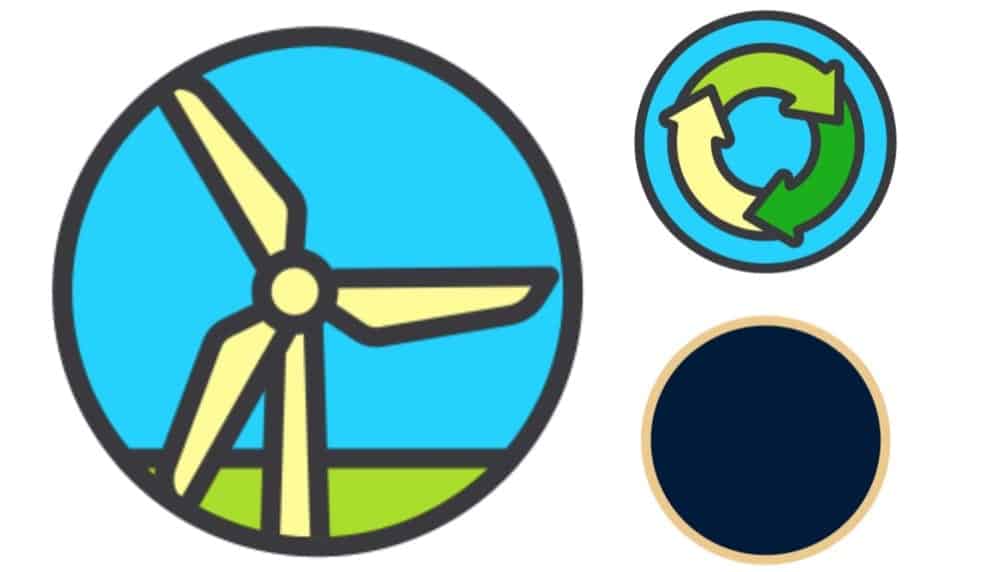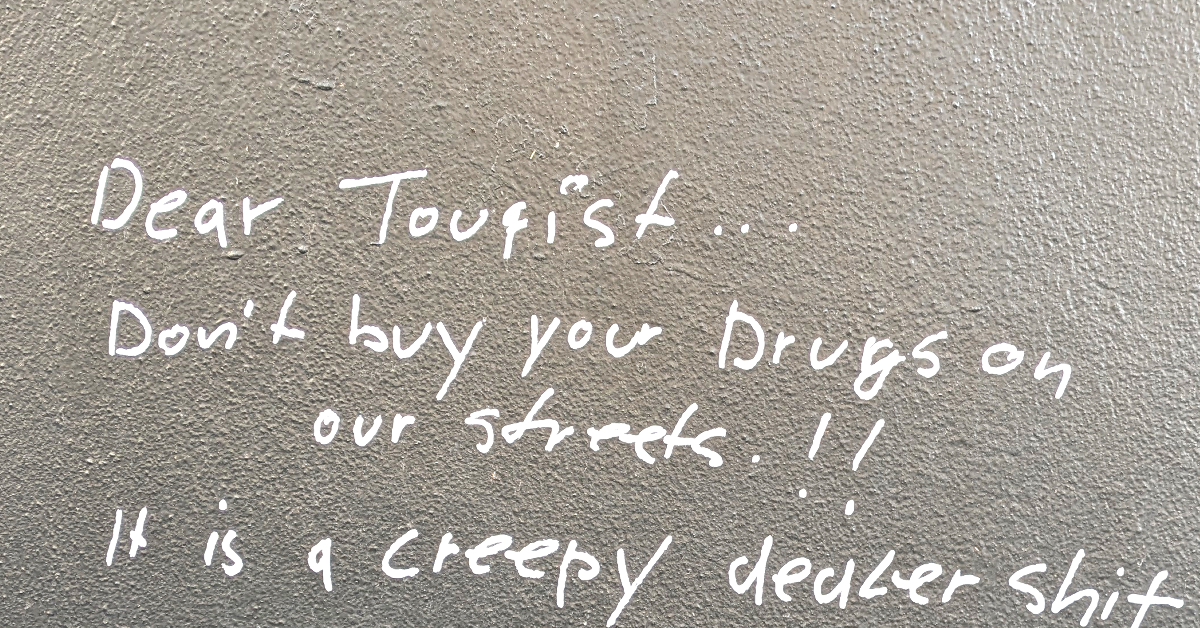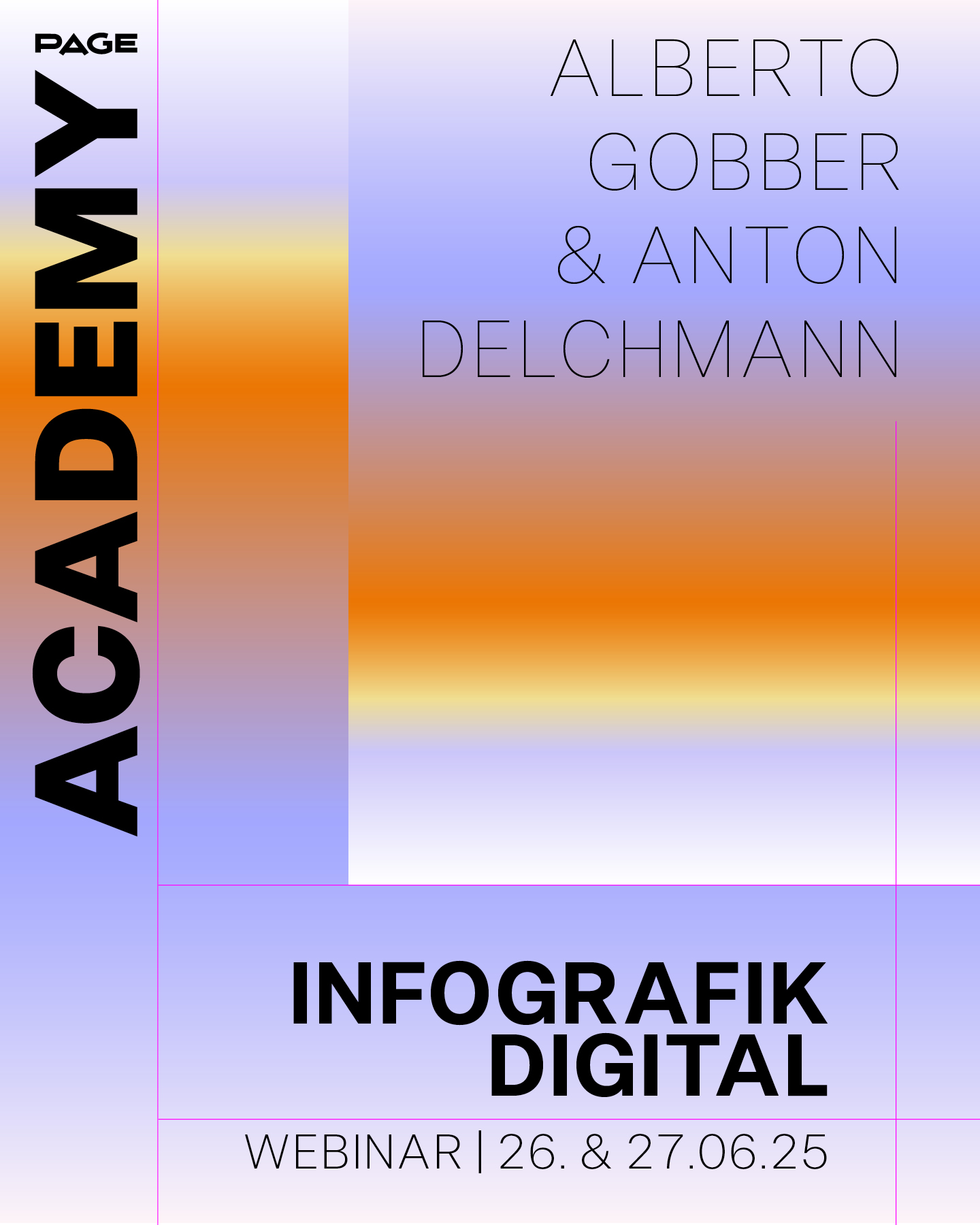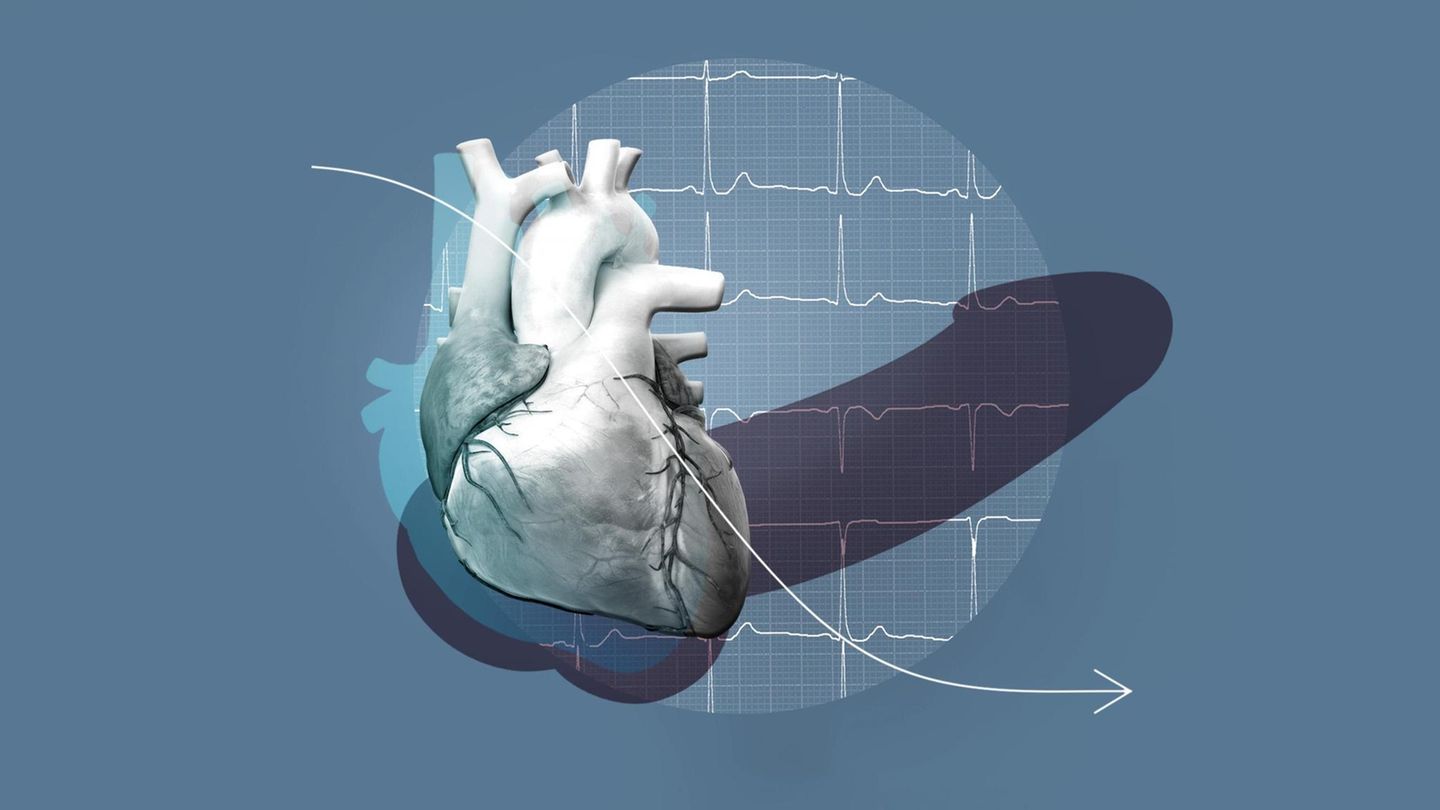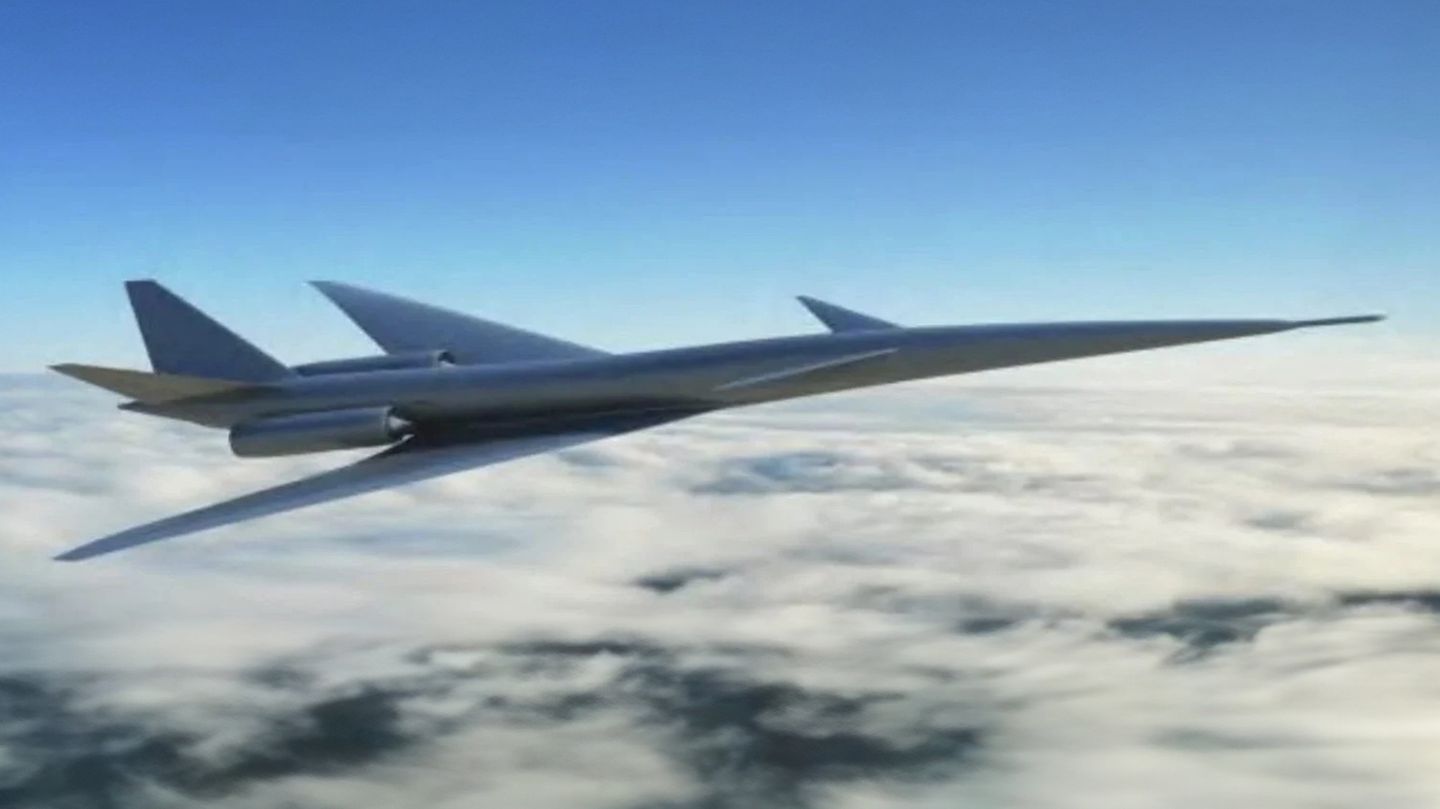Meinung: Die Finanzindustrie zieht Trump den Stecker
Die Wall Street stoppt das Treiben von Donald Trump. Gut, dass die letzte Kontrollinstanz der US-Wirtschaftspolitik auch diesmal funktioniert hat, meint unser Autor.

Die Wall Street stoppt das Treiben von Donald Trump. Gut, dass die letzte Kontrollinstanz der US-Wirtschaftspolitik auch diesmal funktioniert hat, meint unser Autor.
Wer sich in den vergangenen Wochen gefragt hat, wer oder was Donald Trump stoppen kann, erhielt gestern Abend eine Antwort: die Wall Street. Ein paar Tage lang hatte der US-Präsident scheinbar ernsthaft versucht, Wirtschaftspolitik gegen die New Yorker Finanzgiganten zu machen. Am Montag zückten die Bosse von Banken und Vermögensverwaltern dann zunächst die Gelbe Karte, warnten das Weiße Haus unmissverständlich. Da waren schon fünf Billionen Dollar an den Aktienmärkten verraucht. Millionen US-Bürger blickten entsetzt auf ihre schwindenden Rentenzusagen, Versicherer und Pensionsfonds gerieten unter ernsthaftem Erklärungsdruck.
Trotzkopf Trump machte weiter mit seiner Zollpolitik. Einen Tag später zog die Finanzindustrie dann den Stecker. Am Anleihemarkt. Abverkauf. Die Zinsen für die US-Staatsfinanzierung stiegen binnen Stunden um mehr als zehn Prozent. Bei einem Schuldenstand von rund 35 Billionen US-Dollar, rund 120 Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Die Kreditwürdigkeit der USA stand damit infrage. Schluss, Aus, Ende. Oder frei nach Wolfgang Schäuble: Isch over, Mister President. Trump musste seine absurde Zollpolitik aussetzen. Nur mit China darf er sich noch ein bisschen weiter balgen.
Die Finanzindustrie als Korrektiv der US-Politik
Einmal mehr in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte hat sich gezeigt: Das endfällige Korrektiv für fehlgeleitete US-Wirtschaftspolitik ist nicht die politische Opposition, sind nicht Demonstrierende, nur sehr selten Gerichte. Es ist die Wall Street. Kalkuliert, eiskalt, ohne Ideologie. Außer der von Markt und Rendite. Das muss man keineswegs mögen. Aber es hilft.
Das war 1929/30 so, als die New Yorker Großfinanz der zehn Jahre währenden republikanischen Wirtschaftspolitik ein Ende setzte. Der letzte in der Reihe war Präsident Herbert Hoover. Dieser hatte versucht, den US-Haushalt mit Zöllen zu sanieren, und damit den wirtschaftlichen Abschwung verschärft. Denselben Mechanismus bekam 1987 die Reagan-Administration zu spüren. Die hatte auf einen günstigen Dollar gesetzt, um mit Wachstum durch US-Billigexporte die enormen Schulden für Rüstungsausgaben zu finanzieren. Ausverkauf an der Wall Street, Kurskorrektur. 15 Jahre später ließ die Regierung von George W. Bush zu, dass jede Form von Kredit zum Spekulationsobjekt wurde. Nur, um Menschen, die es sich nicht leisten können, einen Hauskauf zu ermöglichen. Das gefährdete am Ende sogar die Wall Street selbst. Reißleine diesmal aus Stahlseil: Dutzende Finanzinstitute gingen ab 2007 pleite, Millionen Amerikaner verloren ihr Hab und Gut.
Donald Trumps Versuche, seinen Knicks vor der letzten Instanz der US-Wirtschaftspolitik als einen Coup zu verkaufen, wirken fast lachhaft. "Geplant" sei alles gewesen, gar über Insider-Handel wird im Netz geschwurbelt. Wer das ernsthaft glaubt, hat die Wall Street nicht verstanden. Dass einige Akteure profitiert haben dürften, gehört zu ihrer inneren Logik. Wie genau der Einfluss, die enorme Macht der Finanzindustrie funktioniert, wer mit wem, wann ein ernstes Wörtchen redet, lässt sich selten hart belegen. Auch diesmal nicht. Hauptsache, es hat funktioniert. Auch diesmal wieder. Sogar deutlich schneller als in früheren Fällen. In Trump-Geschwindigkeit.











:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/57/ee/57eedd11c2043e71aadc1828a06e3063/0124267466v2.jpeg?#)






:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/aa/be/aabe28802bb6011fa4674c0846129ada/0124123611v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/b5/c4b5f9ba2c6a913088a84b641e36de3f/0124266663v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/de/f0/def067848e797d06aca429fd2ba256d6/0124161043v2.jpeg?#)