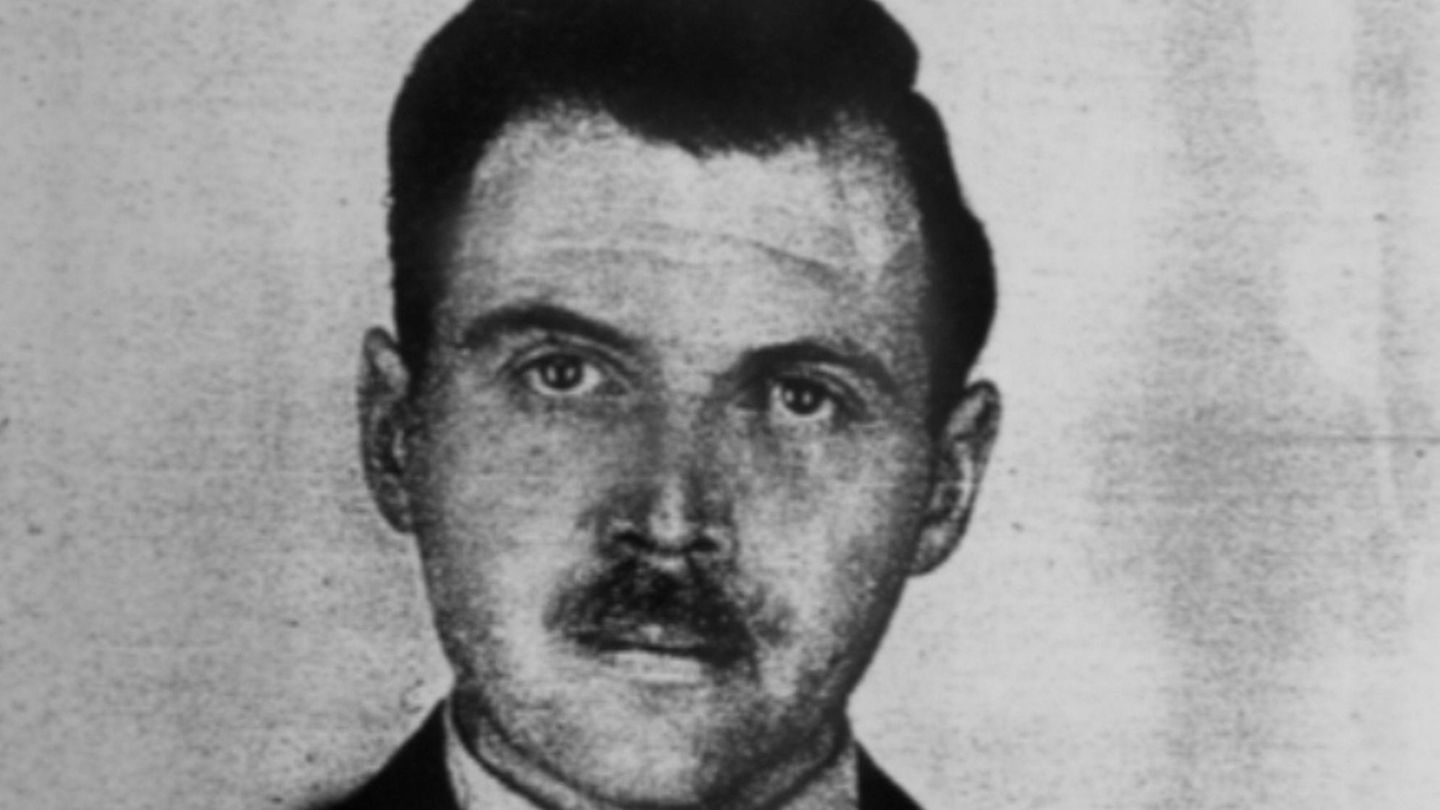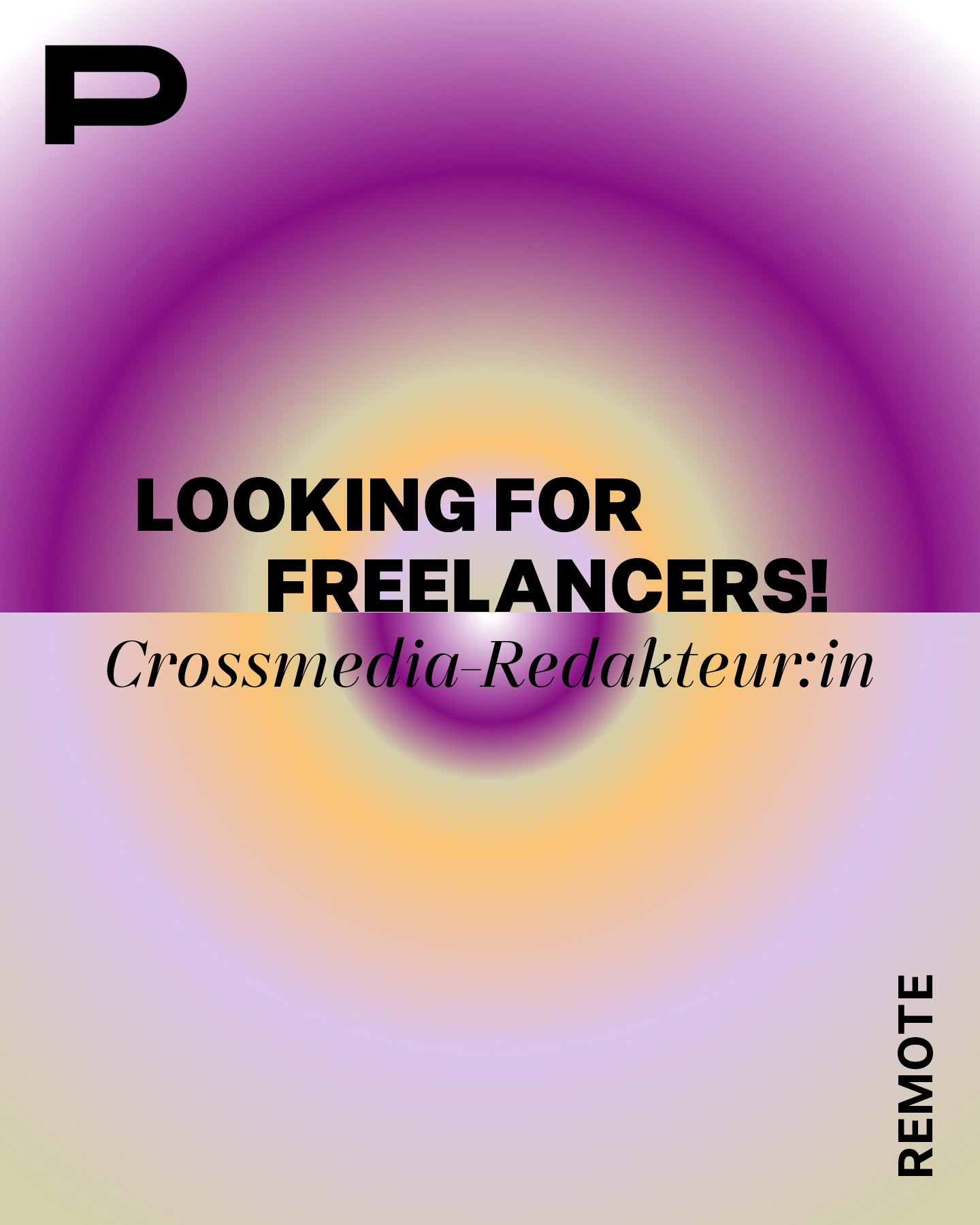Klare Forschungslage: AfD Ausgrenzen funktioniert
Aktuell fordern vermehrt Stimmen eine Normalisierung der AfD und rechts-außen Positionen. Dazu zählt CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn, der fordert, mit der AfD wie mit anderen Oppositionsparteien umzugehen. Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner plädiert für eine Annäherung an die AfD. Ebenso senden Medien Signale, etwa das rechtsgerichtete NDR-Format „Klar“. WDR-Intendantin Karin Vernau äußerte, AfD-Positionen müssten auch in Sendungen […] The post Klare Forschungslage: AfD Ausgrenzen funktioniert appeared first on Volksverpetzer.

Aktuell fordern vermehrt Stimmen eine Normalisierung der AfD und rechts-außen Positionen. Dazu zählt CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn, der fordert, mit der AfD wie mit anderen Oppositionsparteien umzugehen. Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner plädiert für eine Annäherung an die AfD. Ebenso senden Medien Signale, etwa das rechtsgerichtete NDR-Format „Klar“. WDR-Intendantin Karin Vernau äußerte, AfD-Positionen müssten auch in Sendungen des WDR dargestellt werden. Insgesamt deutet vieles auf eine Verharmlosung und Normalisierung extremer rechter Positionen hin.
Der politische Rechtsruck, vor allem beim Thema Migration, fand in den letzten Monaten bei fast allen Parteien des demokratischen Spektrums statt. In Kombination mit den politischen Erfolgen, die die AfD in letzter Zeit verzeichnen konnte, wird durch Äußerungen wie denen von Spahn, Linnemann oder Klöckner der Umgang mit der AfD – sowohl thematisch als auch im parlamentarischen Betrieb, aber auch medial – gerade wieder Thema. Wie sieht eigentlich der Forschungsstand dazu aus?
Forschung ist klar: Ausgrenzung rechtsextremer Parteien stärkt sie nicht
In einem Artikel auf tagesschau.de wurde diese Frage – AfD ausgrenzen, ja oder nein? – kürzlich beleuchtet, scheinbar aus zwei gleichwertigen Forschungsperspektiven. Die Tagesschau zitiert Wolfgang Merkel, emeritierter Professor für Politikwissenschaft, der schon lange nicht mehr zu der Frage forscht, die er hier beantwortet hat. Er behauptet ohne Belege, dass das Ausgrenzen der AfD kontraproduktiv sei, weil das nur die eigene Opfer-Erzählung der Partei bestätige. Natürlich gebe es zu dieser Frage, wie in jedem Forschungsfeld, unterschiedliche Positionen von Wissenschaftler*innen, sagt mir dazu der Politikwissenschaftler Tarik Abou-Chadi, Professor für Comparative European Politics am Nuffield College der Oxford University, der selbst zum Wandel der Parteipolitik und dem Aufstieg der radikalen Rechten in Europa forscht – doch in einigen zentralen Punkten sei sich die Forschung einig:
„Bei den Leuten, die tatsächlich zur radikalen Rechten und der Frage von ihrer Legitimierung und Normalisierung forschen, gibt es eine relativ konsensuale Meinung dazu. Ich kenne keine Studie, die sagen würde, dass die Ausgrenzung dazu führt, dass radikale Rechte dann mehr Unterstützung bekommen.“ Unterschiede gäbe es in der Beurteilung von Fragen, wie ob etwa ein Hotel für eine AfD Tagung zur Verfügung gestellt werden sollte – aber nicht in der Frage von inhaltlicher oder formaler Ausgrenzung: „Nichts zeigt, dass wenn die AfD ausgegrenzt wird, wenn es ein negatives Campaigning gegenüber der AfD gibt, dies dazu führt, dass die AfD beliebter wird – sondern eher im Gegenteil.“
Tarik Abou-Chadi: „Programmatische Anpassung funktioniert nicht“
Was die Folgen einer inhaltlichen Anpassung etablierter Parteien an Rechtsaußen Positionen angehe, beispielsweise beim Thema Migration, sei der Forschungsstand ebenfalls klar, sagt Abou-Chadi. „Programmatische Anpassung – da zeigt unsere eigene Forschung sehr klar, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, dadurch WählerInnen zurückzugewinnen, dass man selbst migrationskritische Positionen einnimmt. Dazu gibt es mittlerweile viele Studien, die das zeigen.“
Abou-Chadi verweist zudem auf kurzfristige und langfristige Effekte einer inhaltlichen Anpassung an rechte und rechtsextreme Parteien: „Kurzfristig sehen wir, dass eine solche Anpassung wenig bringt. Wenn man etwa Umfragen dazu durchführt oder sich anschaut, was im Zeitraum einer Wahlperiode passiert, sieht man, dass viele Leute einfach nicht auf die veränderte Migrationsposition von etablierten Parteien reagieren und sich deshalb nicht zu ihnen zurückbewegen.“ Das liege auch daran, dass ein solcher thematischer Schwenk von Menschen, die „migrationskritisch sind und schon ihren Weg in das Territorium der Far-Right gefunden haben“, diesen Positionswechsel etablierter Parteien nicht als glaubwürdig finden. Die kurzfristige, durch einen Rechtsschwenk erhoffte Wirkung, dass rechte Wähler für etablierte Parteien gewonnen werden könnten, bleibe also aus. Gleichzeitig sei die mittelfristige Wirkung fatal: „Mittelfristig führt das dazu, dass sowohl diese rechteren Positionen als auch Parteien wie die AFD, die originär für diese Positionen stehen, legitimiert werden.“
Medien und etablierte Parteien prägen das Meinungsbild
In einem zweiten Schritt zeige die Forschung laut Abou-Chadi, dass die Rechtsverschiebung etablierter Parteien auch Bevölkerungsmeinungen verändert: „Wenn man immer wieder hört – und zwar nicht nur von der AfD – ‘Migration ist das größte Problem’ -, sondern irgendwann auch vom Bundespräsidenten, dann fängt man an, auch zu denken, das sei wirklich ein Problem, das ist gut dokumentiert.“
Das häufige Gegenargument lautet, man müsse „die Sorgen der Bürger“ ernst nehmen. Dies bezieht sich interessanterweise nur auf Sorgen konservativer oder rechter Menschen. Es ignoriert dabei Forschungsergebnisse darüber, wie politische Meinungsbildung tatsächlich erfolgt. Laut Abou-Chadi beeinflusst die Positionierung etablierter Parteien maßgeblich die Meinungsbildung der Wähler*innen: „Mein Lieblingsbeispiel ist die Schweiz, wo ja sehr, sehr häufig abgestimmt wird zu politischen Themen. Und der stärkste, zuverlässigste Prädiktor dafür, wie Leute abstimmen, ist, welche Empfehlung die Partei gegeben hat, die sie unterstützen – das beeinflusst sehr stark, wie Leute sich zu diesen Fragen positionieren. Das ist eigentlich nicht überraschend, und auch nicht verwerflich: Was Parteien sagen, beeinflusst, wie Leute über ein Thema denken.“ Kurz: „Es gibt diese zwei Mechanismen, die die radikale Rechte oder extreme Rechte stärken, einmal indem sie in der Wahrnehmung der Bevölkerung normalisiert werden und indem sich dadurch zweitens auch die Einstellungen der Bevölkerung dahingehend ändern.“
Medien beeinflussen die öffentliche Meinung zu Migration
Letztlich handelt es sich also um die Frage von der Henne und dem Ei – was war zuerst da? Die „Sorgen“ zum Thema Migration oder die mediale und politische Themensetzung? Das lasse sich nicht immer ganz klar unterscheiden. Aber eines zeige die Forschung deutlich: „Wenn man Leute fragt, ob Migration ein Problem für sie persönlich ist und sie gleichzeitig fragt, ob Migration ein Problem für das Land darstellt, sagen ganz wenige Leute, es sei ein Problem, das sie persönlich betreffe – und ganz viele Leute sagen, es ist ein Problem für das Land. Ich habe kein anderes Thema gesehen, wo diese Schere so weit auseinandergeht. Und das spricht doch sehr dafür, dass es eben nicht die empfundene, erfahrene Auseinandersetzung mit der Migration ist, die hier eine Rolle spielt.“
Das passt zu Forschungsergebnissen, die zeigen, dass die radikale Rechte an Orten, wo es weniger Migration gibt, deutlich stärker ist. „Es scheint weniger die direkte Auseinandersetzung mit Migration zu sein und mehr die mediale“, schlussfolgert Abou-Chadi. Das bestätigt auch eine Langzeit-Untersuchung am Beispiel der Benelux-Länder der Politikwissenschaftlerin Léonie de Jonge, die seit Anfang 2025 an der Universität Tübingen eine politikwissenschaftliche Professur für Rechtsextremismusforschung mit dem Schwerpunkt „Politische Akteure und Ideologien“ angetreten hat. Ein besonderes Beispiel, dem sie sich in einer weiteren Studie widmet, ist die Wallonie in Belgien: Dort habe ein „cordon sanitaire“ von Medien und Politik den Aufstieg von Rechtsaußen-Parteien bisher erfolgreich verhindert.
Ausgrenzung von Rechtsextremen – medial wie politisch – funktioniert
De Jonge zeigt, wie effektiv ein „Cordon sanitaire“ in Bezug auf Rechtsextremismus sein kann: „Technisch gesehen ist ein Cordon sanitaire eine gesicherte Linie, die eingerichtet wurde, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. In diesem Fall handelt es sich um eine Maßnahme, die die Ausbreitung von (Rechts-)Extremismus verhindern soll.“
De Jonge bezieht sich auch auf Untersuchungen des schwedischen Soziologen Jens Rydgren (Universität Stockholm), der schrieb: „Rechtspopulismus [ist] nicht ansteckend (im Sinne von Epidemien); er verbreitet sich nur, wenn die Akteure dies wollen“. De Jonge schlussfolgert: „Wenn es keine Akteure (d. h. Parteien) oder Kanäle (d. h. Medien) gibt, die rechtspopulistische Themen verbreiten, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie sich ausbreiten und normalisiert werden.“ In der Wallonie hat das funktioniert, betont auch Abou-Chadi: „Die Wallonie ist der einzige Ort, den wir mittlerweile haben, das einzige Parteiensystem in Westeuropa, in dem es keine radikal-rechte Partei gibt, die stark geworden ist.“
Strukturelle Probleme im Journalismus führen zur Verzerrung der medialen Darstellung des Forschungsstands
Neben etablierten Parteien kommt also auch den Medien eine zentrale Rolle bei der Normalisierung rechtsextremer Positionen zu. Bei aller Medienkritik ist auch hier noch einmal wichtig zu betonen: Es gibt viele Journalist*innen, die hervorragende Arbeit machen – auch und gerade zum Thema der radikalen Rechten. So verweist auch Abou-Chadi darauf, dass es ihm bei seiner fachlichen Medienkritik nicht um Verallgemeinerungen, sondern um das Aufzeigen systemischer Probleme der Medienlandschaft – und wer in ihr immer wieder prominent zu Wort komme – gehe:
„Ich spreche regelmäßig mit Journalist*innen, die sehr informiert sind, die einen wirklich guten Job machen. Aber es gibt eine Klasse von Journalist*innen, die, wenn man ehrlich ist, zu allem etwas sagen“ – unabhängig davon, ob sie dazu das fachliche Grundwissen hätten. „Ich erwarte nicht, dass jemand akademische Fachjournale liest. Aber es wäre bei anderen Fragen unvorstellbar, dass man als Journalist*in in einem Podcast, in einer Talkshow sitzt und sagt, ‘ich denke, das ist so und so’ und dabei völlig ignoriert, dass es dazu Forschung gibt.“
Abou-Chadi sieht bei den Medien auch ein Formatproblem. In vielen (Talkshow) Formaten würden Journalist*innen mit Journalist*innen reden, das sei billig in der Produktion, dabei würden oft lediglich Meinungen ausgetauscht, und oft geschehe das ohne inhaltliche oder fachliche Qualifizierung: „Da geht es nicht darum, dass Journalist*innen beispielsweise über ihre Reportagen sprechen, sondern sie werden dahin gesetzt, um zu allem etwas zu sagen.“ Das sei nicht einmal den einzelnen Journalist*innen anzulasten, sondern den Anforderungen, die die Sendeformate erfüllt sehen wollen.
Formatprobleme, Expert*innen, die keine sind und Both-Sides-Ism
Das Formatproblem bedingt dann teilweise auch die Auswahl der Expert*innen – die oft nicht unbedingt danach ausgewählt werden, wer tatsächlich in der Materie drin ist oder sich hauptberuflich damit beschäftigt, sondern danach, dass die für den Meinungs-Clash notwendigen Positionen besetzt sind – ungeachtet der eigentlichen Forschungslage. Das führt uns zurück zum eingangs erwähnten Tagesschau-Artikel, in dem es zur Frage der Ausgrenzung heißt „Wie so häufig lassen sich Unterstützer für beide Seiten finden.“ Das mag sein – doch nur einer der beiden zitierten Experten – der Sozialwissenschaftler Matthias Quent – forscht zu dem Thema und gibt den neuesten Stand der Forschung wieder.
Allein die Tatsache, dass sich irgendwo immer jemand für die Gegenposition findet, ist noch keine journalistische Leistung – sonst entsteht, wie in diesem Tagesschau-Artikel, der Eindruck, beide Positionen – die von Merkel und die von Quent – fußten gleichermaßen auf dem aktuellen Forschungsstand. Der Artikel endet mit den Sätzen: „Viele Ansätze also, doch auch viel Unsicherheit. Die eine klare Antwort im Umgang mit rechtspopulistischen Bewegungen gibt es wohl nicht.“ Das Gegenteil ist der Fall – die Forschungslage hat in der Tat eine klare Antwort auf die gestellte Frage. Abou-Chadi sieht in solchen Fällen ein mediales Problem: Es werde versucht, eine Horse-race-Situation darzustellen – also Both-Sides-ism, ohne die tatsächliche Faktenlage ausreichend zu beachten – „das verzerrt die wissenschaftliche Lage.“
Sendungen laden keine Expert*innen ein
Dieses strukturelle Sendungs- und Formatproblem – egal ob in Talkshows, oder wenn es um eingeholte O-Töne geht, bedingt, dass „immer die gleichen Leute eingeladen werden“ – auch, wenn diese Stimmen fachlich eine Minderheitenposition vertreten, oder eine, die gar nicht von tatsächlichen Fachleuten geteilt wird. Dabei spielen auch inner-mediale Mechanismen eine Rolle: „Der größte Prädiktor, ob man irgendwo in einer Fernsehsendung sitzt, ist immer noch, ob man es schafft, in den nächsten drei Stunden ins Studio kommen zu können“, sagt Abou-Chadi.
Das schließe in vielen Fällen Menschen, die aktiv forschen oder lehren, aus – und so finden sich immer wieder dieselben Leute auf den entsprechenden Sendeplätzen: „Das führt natürlich dazu, dass die Leute, die da befragt werden, häufig nicht tatsächliche Expert*innen sind. Das mag dann zwar ein Politikwissenschaftler sein, aber es ist nicht jemand, der zu dem Thema forscht oder lehrt.“ Abou-Chadi gibt auch zu bedenken, dass sich in der deutschen Politikwissenschaft einiges getan habe, sodass man auch junge Forscher*innen mit Expertise einladen könne – die Ausrede, dass man niemand anderen finde, könne nicht mehr gelten.
Selbstkritik und Eigenverantwortung der medialen Rolle bei der Normalisierung der AfD
Auf Kritik an der medialen Dauerpräsenz der AfD oder der unkritischen Wiedergabe von Statements wird von einigen Journalist*innen eingewandt, die Partei sei nun mal gewählt, sitze im Bundestag und müsse deswegen auch medial stattfinden.
Grundsätzlich sei dieser Einwand fürs Erste nachvollziehbar, doch mediale Präsenz müsse an Bedingungen geknüpft sein, sagt Abou-Chadi: „Als zweiter Schritt muss gesagt werden, wenn diese Präsenz genutzt wird für Lügen und Hass, dann verwirkt man diesen Anspruch eben. Das scheint mir eigentlich eine relativ simple Logik, ohne dass man da in große demokratietheoretische Fragen einsteigen muss.“
Abou-Chadi fordert Journalist*innen an dieser Stelle auf, Eigenverantwortung zu übernehmen – auch, was die eigene Rolle angeht: „Ich weiß nicht, wie viel innerhalb von Redaktionen passiert, aber ich sehe wenig öffentliche aktive Auseinandersetzung mit der Rolle, die man gespielt hat bei der Normalisierung der radikalen Rechten.“ Kritik an der Berichterstattung über die radikale Rechte vonseiten derer, die sich in der Forschung genau mit diesen Mechanismen beschäftigen, werde ungern gesehen, sagt er. Gleichzeitig sei eine solche Debatte auch schwer über Twitter oder Bluesky zu führen:
„Vielleicht muss man auch zusammen schauen, wie man Räume schafft, in denen man aktiv darüber nachdenkt und auch irgendwie Lösungen findet.“ Doch dafür muss es auf journalistischer Seite auch eine Bereitschaft geben, die im Moment häufig zu fehlen scheint.
Auch jenseits der Führungsebene appelliert Abou-Chadi an Journalist*innen: „Ich würde mir manchmal wünschen, dass Journalist*innen da selbst lauter sind. Ich weiß, das ist ein Big Ask, denn man ist Teil des Systems – und so etwas kann auch persönliche negative Konsequenzen haben.“ Den gleichen Maßstab legt er auch für sich und seine Kolleg*innen an, man müsse in der inhaltlichen Auseinandersetzung bereit sein, „sich auch mit bestimmten Big Shots in der eigenen Disziplin anzulegen, auch wenn das nicht unbedingt gut für die Karriere sein mag.“
Fehlende Kommunikation der medialen Führungsriege
Was ist die Ursache für das mediale Fischen in rechten Gewässern – jenseits von Clickbait? „Es scheint eine Tendenz zu geben, dass man das Gefühl hat, man müsse Stimmen von weiter rechts näher abbilden“, sagt Abou-Chadi. Er sieht eine Korrelation von steigenden Umfragewerten der AfD und der Zunahme solcher Positionen in Redaktionen: „Je stärker die radikale Rechte ist, umso mehr redet man über sie – dann stellt sich die Frage, was soll man noch sagen? Und dann hat man das Gefühl – ‘was wir noch nicht genug gesagt haben, ist, dass die eventuell recht haben’”, versucht Abou-Chadi den Denkprozess innerhalb einiger Redaktionen nachzuvollziehen.
Man könne tatsächlich nur über deren Motivation spekulieren, sagt er – vielleicht gingen sie davon aus, als “linksgrün” wahrgenommen zu werden, und machten das, um zu zeigen, dass sie es eigentlich nicht sind. Abou-Chadi ist dialogbereit – er wendet ein: „Vielleicht gibt es auch eine komplizierte, gute Erklärung dafür. Dann habe ich die aber einfach noch nicht gehört, weil es eigentlich nicht den Versuch gibt, wie gesagt, auch damit aktiv umzugehen und die eigene Rolle in diesem Prozess zu reflektieren und zu diskutieren.“
Der Mythos der Neutralität
Oft fällt an dieser Stelle dann der Verweis auf “journalistische Unabhängigkeit” als Rechtfertigung des unkritischen Platformens rechter Parteien, Ideen und Narrative. Doch journalistische Berichterstattung ist insofern nie „neutral“, als dass sie einen Effekt auf ihre Konsument*innen hat: „Es ist zentral, dass Medien ihre Verantwortung verstehen – und dass der derzeitige Umgang mit rechtsextremen Akteuren und rechtsextremen Ideologien zur Erodierung der Demokratie führt. Medien müssen ihre aktive Rolle in diesem Prozess verstehen, sie geben nicht einfach passiv wieder. Politik und Medien bilden nicht einfach die öffentliche Meinung ab, sondern sie beeinflussen sie – das ist auch gar nicht anders möglich.“
Vor allem die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich ihres Bildungsauftrags bewusst sein und ihn erfüllen, und dazu gehört ihre demokratische Grundverpflichtung – und ein Bewusstwerden der eigenen Verantwortung und Außenwirkung: „Die ARD ist eben nicht YouTube. Wenn etwas in der ARD kommt, dann kriegt es einen Stempel von Legitimität.“ Etablierte Medien müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden, was ihre eigene Rolle bei der Normalisierung der AfD und damit rechtsextremer Positionen angeht, wenn die weitere Unterwanderung unserer Demokratie von rechts gestoppt werden soll.
Nadia Zaboura: Grundlegendes Umdenken in der deutschen Medienlandschaft nötig
Jetzt, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AfD bundesweit als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft hat, wäre es allerhöchste Zeit, dass Politik und Medien sich kritisch mit ihrer Rolle bei der Normalisierung der AfD beschäftigen – und Konsequenzen ziehen. Die Kommunikationswissenschaftlerin und Medienkritikerin Nadia Zaboura fordert ein grundlegendes Umdenken in der deutschen Medienlandschaft: „Es braucht nun eine faktisch fundierte und wissenschaftlich informierte Gesamt-Strategie, die einen konsistenten Umgang mit der Partei, ihren Strategien und ihren Ermöglichern bis in die politische Mitte garantiert.
Dazu müssen Medien sich wieder auf ihre journalistische Professionalität und Ethik zurückbesinnen und Tag für Tag prüfen, ob sie einer Politik-Behauptung bereits einen Nachrichtenwert zuweisen, ob sie sich dem Agenda-Setting populistischer Medien beugen, und ob sie über jedes Stöckchen, jede agitierende Aussage springen statt demokratischer Souveränität und Priorisierung den Vorrang zu geben.“ Zaboura fordert, dass Medien „Illusionen wie eine vermeintliche Entzauberung oder vermeintliche journalistische Objektivität ablegen, aber auch veraltete Prozesse auf den Prüfstand stellen müssen, wie u.a. die stenografische Adelung von Politikerzitaten als Headline und die Inszenierung von Systemgegnerschaft in Polit-Talks bei zeitgleicher Ablehnung von Live-Faktenchecks.“
Holt euch Rat von Wissenschaftler*innen!
Wie auch Abou-Chadi verweist Zaboura darauf, dass es sich weniger um ein individuelles, als ein strukturelles Medienproblem handle: „Viele Journalist*innen besitzen im Jahr 2025 zwar das Wissen und Handwerkszeug für eine mediale Berichterstattung, die der steigenden rechtsextremen Gefahr angemessenen begegnet. Im Berufsalltag sind diese Journalist*innen aber oftmals ermüdenden Diskussionen in wenig pluralen Redaktionen ausgesetzt. Wenn zusätzlich öffentlich-rechtliche Verantwortungsträger auf öffentlichen Bühnen erklären, dass sie Rassismus mit veralteten Konzepten wie Springerstiefel, Glatze und Baseball-Schläger in Verbindung bringen, dann besteht ebenfalls auf Leitungsebene ein elementares Wissensdefizit. Dort fehlen immer wieder basale Kenntnisse über Rassismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft, die zugleich Ursache und Struktur rechtsextremer Gewalt sind, die die deutsche Gesellschaft durchziehen und die plurale Demokratie gefährden.“
Was müssten Medien stattdessen tun? Zaboura hat eine klare Handlungsempfehlung für deutsche Medien – „Mit externer Fachbegleitung [müsste] jedes einzelne Format, jedes Medienprodukt auf Demokratiefestigkeit abgeklopft werden. Genau das also, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahren fortlaufend von Medienverantwortlichen fordern, sei es in internen Beratungen oder auf öffentlichen Bühnen.“ Auch der Deutsche Journalisten-Verbund (DJV) hat die Medien zum Umdenken aufgefordert – eine Normalisierung der AfD dürfe nicht weiter stattfinden.
Doch zunächst scheint es weiterzugehen wie bisher: Im Anschluss an die Meldung der Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ gab es in der ARD einen „Brennpunkt“. Wer war neben Nancy Faeser als Gast eingeladen? Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla, der in der Sendung von einem “schwarzen Freitag für die Demokratie“ sprach. Man kann nur hoffen, dass man wenigstens in anderen Redaktionen endlich umschwenkt – und versteht, dass es medial so nicht weitergehen kann.
Titelbild: Martin Schutt/dpa Canva
The post Klare Forschungslage: AfD Ausgrenzen funktioniert appeared first on Volksverpetzer.











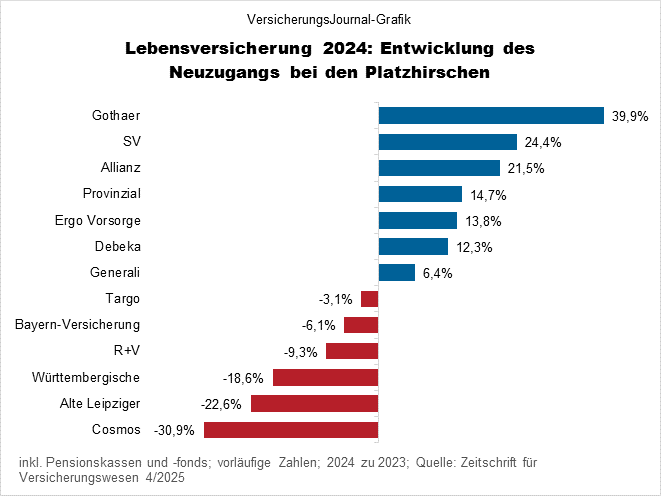


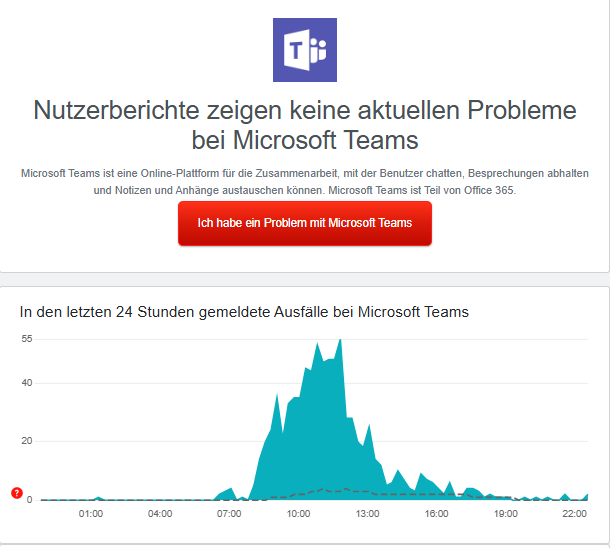
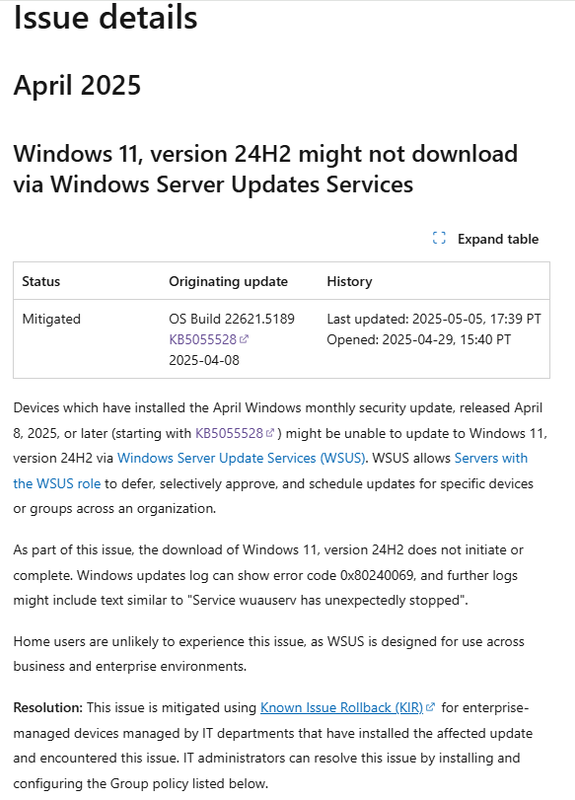

![Acapulco: 4. Staffel startet am 23. Juli 2025 [Apple TV+]](https://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2025/05/apple_tv_plus_acapulco_staffel4_szene.jpeg)




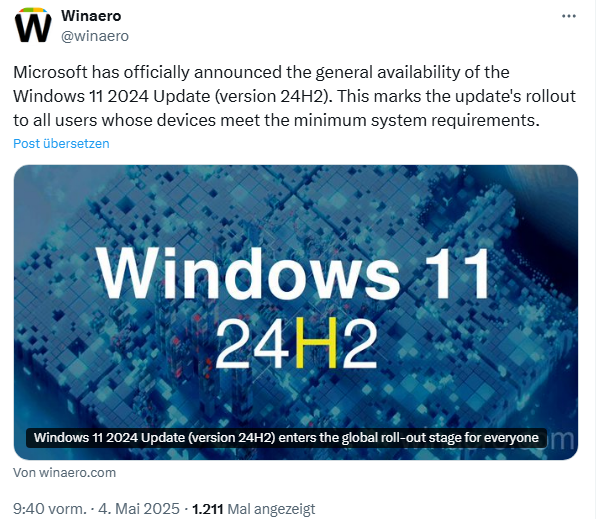
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/76/3a/763a715e66cae0a4c172ab9002440ee8/0124301761v1.jpeg?#)