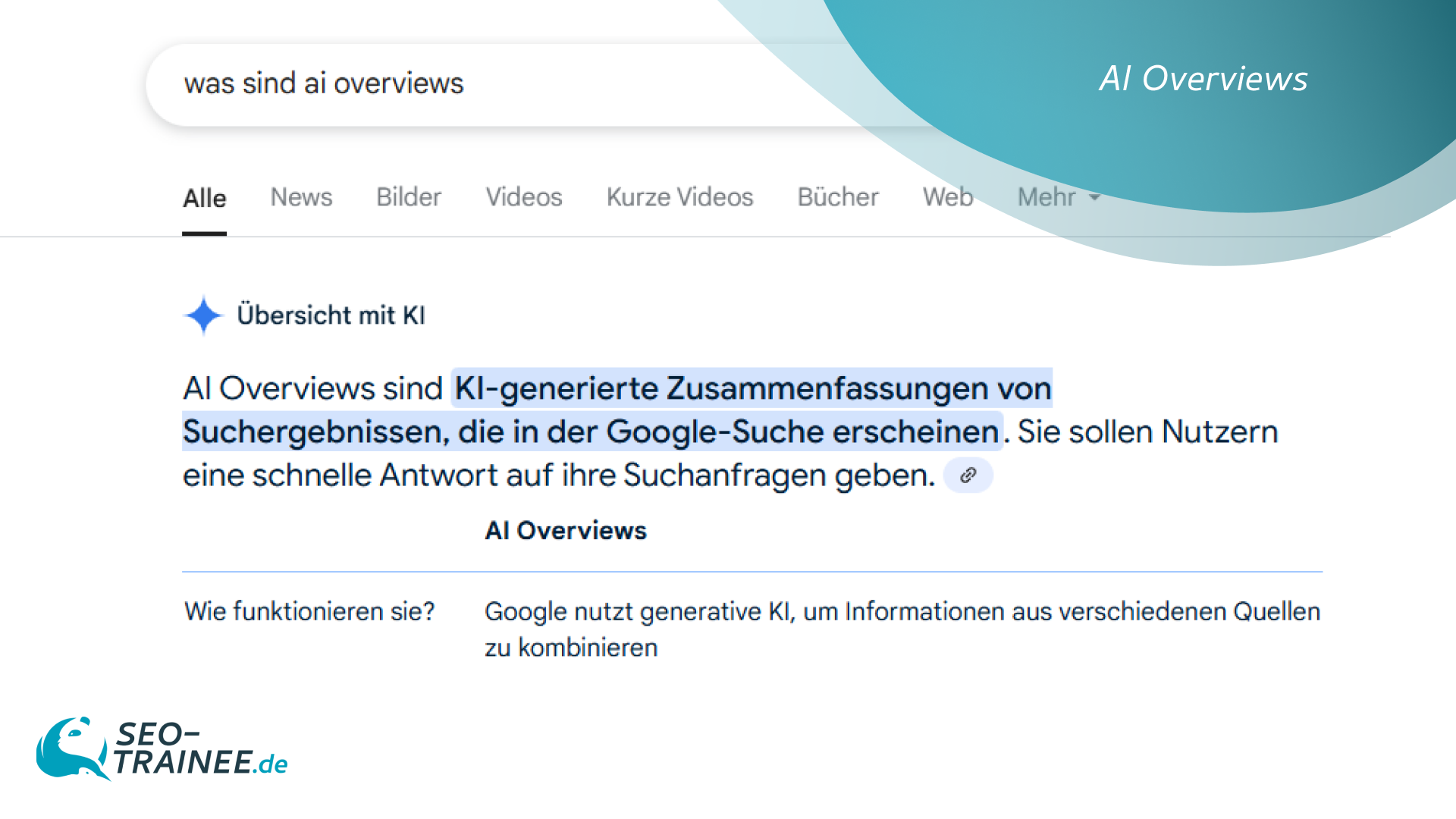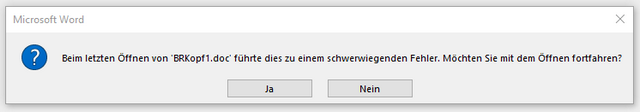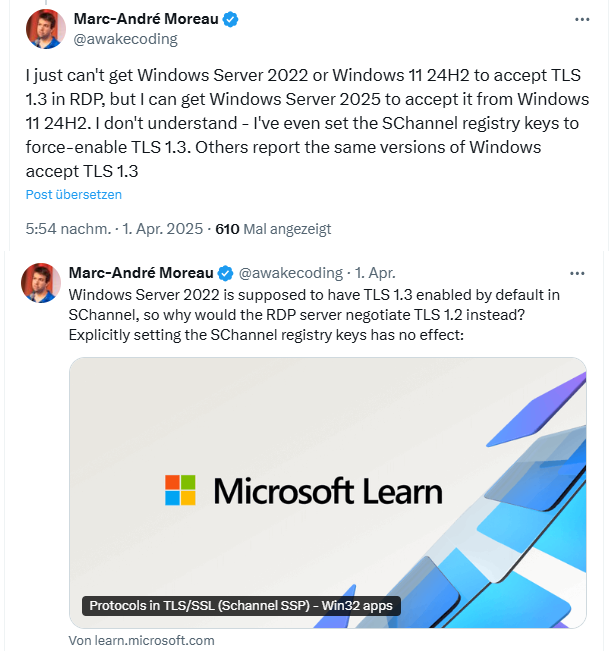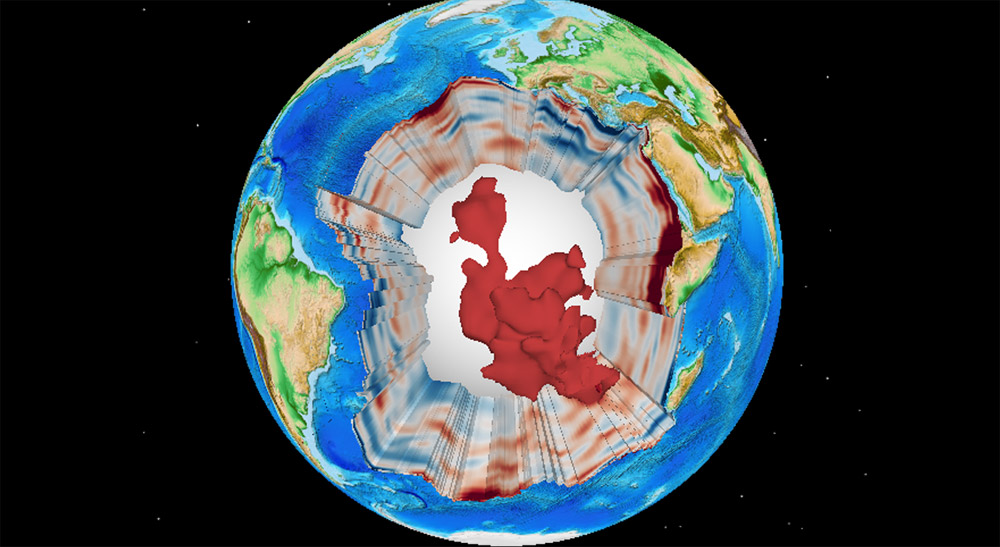Fonds: Investieren wie ein Kerl? Besser nicht, sagt diese Studie
Managerinnen von Investmentfonds bevorzugen andere Branchen als Männer. Im Schnitt erzielen sie so mehr Rendite. Gäbe es mehr von ihnen, könnten sie die Weltwirtschaft verändern

Managerinnen von Investmentfonds bevorzugen andere Branchen als Männer. Im Schnitt erzielen sie so mehr Rendite. Gäbe es mehr von ihnen, könnten sie die Weltwirtschaft verändern
Im Jahr 2023 betrug das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands – der erwirtschaftete Wert aller Güter und Dienstleistungen – rund 4,5 Billionen US-Dollar. Im selben Jahr verwalteten Investmentfonds weltweit ein Vermögen von 69 Billionen Dollar. Die exorbitante Summe verleiht den Menschen an der Spitze dieser Fonds beträchtliche Macht. Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen, welche Firmen und Branchen Gelder erhalten – und steuern damit wirtschaftliches Wachstum und technologischen Wandel.
Doch in kaum einer Branche sind Frauen so drastisch unterrepräsentiert wie in der Welt des Investmentbankings. In den USA liegt die Quote der Fondsmanagerinnen bei rund zehn Prozent – und das seit zwei Jahrzehnten. Deutschland kommt als europäisches Schlusslicht nur auf klägliche sechs Prozent. Der Anteil der Gelder, die Frauen verwalten, ist noch geringer. Sollten sich ihre Anlagestrategien von denen männlicher Kollegen unterscheiden, sähe die Weltwirtschaft in einer gleichberechtigten Welt womöglich ganz anders aus.
Auch Finanzprofis entscheiden nach privaten Vorlieben
Zahlreiche Studien zeigen, dass Fondmanagerinnen und Fondmanager keine rein rationalen Entscheidungen bei der Auswahl ihres Portfolios treffen. Unter anderem bevorzugen sie Firmen, die sie privat kennen und schätzen. In einer aktuellen Studie gingen Forschende der Universität Mannheim und der University of Essex deshalb der Frage nach, inwiefern das Geschlecht die Auswahl der Wertpapiere im Portfolio beeinflusst.
Ihre Datenbasis bildeten mehr als 1500 US-Fonds, deren Entwicklung sie von 2004 bis 2019 verfolgten. Neun Prozent der Fonds – aber nur drei Prozent des Gesamtvermögens – wurden von Frauen geführt. Die Auswertung zeigte, dass die Managerinnen andere Branchen bevorzugten als ihre männlichen Kollegen. Sie investierten das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger beispielsweise häufiger in den Gesundheitssektor, während Männer mehr Aktien von Versicherungen und Energiekonzernen kauften. Manche Entscheidungen zeigten Parallelen zu den privaten Konsumvorlieben gut verdienender Amerikanerinnen und Amerikaner: etwa der größere Fokus der Frauen auf Pflegeprodukte und die höheren Ausgaben von Männern für Sprit und Versicherungen. Unterm Strich ließen sich männliche Fondsmanager stärker vom Kaufverhalten ihres eigenen Geschlechts leiten – zum Nachteil der Rendite.
Ob ein Fonds von einem Mann oder einer Frau gemanagt wurde, sagte im Einzelfall nichts über das erwirtschaftete Plus aus. Doch im Durchschnitt der Geschlechter zeigten sich Unterschiede. Das Autorenteam berechnete für jedes Quartal je ein Durchschnitts-Portfolio für alle weiblich sowie für alle männlich verwalteten Fonds. Dann ermittelten sie, wie stark die Auswahl der Wertpapiere in den realen Portfolios von beiden abwich. Sie schreiben: "Unsere Analyse zeigt eine signifikante negative Beziehung zwischen der Maskulinität des Portfolios und der Fonds-Performance, was darauf hindeutet, dass maskulinere Anlagestrategien tendenziell schlechter abschneiden." Gerade Fondsmanager, deren Investitionen stärker mit typisch männlichen Konsumpräferenzen übereinstimmen, gingen tendenziell geringere Risiken ein – und erzielten dadurch auch niedrigere Renditen.
Normalerweise gelten Frauen als vorsichtige Investorinnen, die Risiken meiden – und damit kurzfristig weniger Gewinne erzielen, aber auch weniger Verluste einstecken müssen. In der Welt der Finanzprofis spielen diese Unterschiede jedoch eine untergeordnete Rolle. Warum Frauen hier am kürzeren Hebel sitzen, dafür gibt es mehrere Erklärungsansätze. Manche entscheiden sich aus eigenem Antrieb gegen eine Karriere in einer männlich geprägten Branche mit hohem Leistungs- und Konkurrenzdruck. Andere werden Opfer von Vorurteilen in der Chefetage. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Niessen-Ruenzi und ihr Kollege Stefan Ruenzi haben noch einen weiteren Faktor identifiziert: Mangelndes Vertrauen von Anlegerinnen und Anlegern in die Fähigkeiten weiblicher Fondsmanagerinnen. Die Vorurteile sind vermutlich unbewusst – und unbegründet.
Niessen-Ruenzi ist auch an der aktuellen Studie beteiligt. Mit ihren Co-Autoren Peter Grüner und Christoph Siemroth prognostiziert sie, dass die Wirtschaftswelt eine andere wäre, wenn Fonds zu gleichen Teilen von Frauen und Männern gemanagt würden. Aktien aus der Energie- und Finanzbranche würden an Bedeutung verlieren, während die Investitionen in die Sektoren Gesundheit, Werkstoffe und IT steigen würden. "Diese Umschichtung von Kapital könnte Innovation und Wachstum in der Gesundheits- und Technologiebranche fördern, während die finanziellen Zwänge in der Energie- und Finanzbranche möglicherweise zunähmen", schreibt das Trio. Eine solche Umschichtung hätte nicht nur Auswirkungen auf die Konten der Anlegenden, sondern auf den Alltag von uns allen.