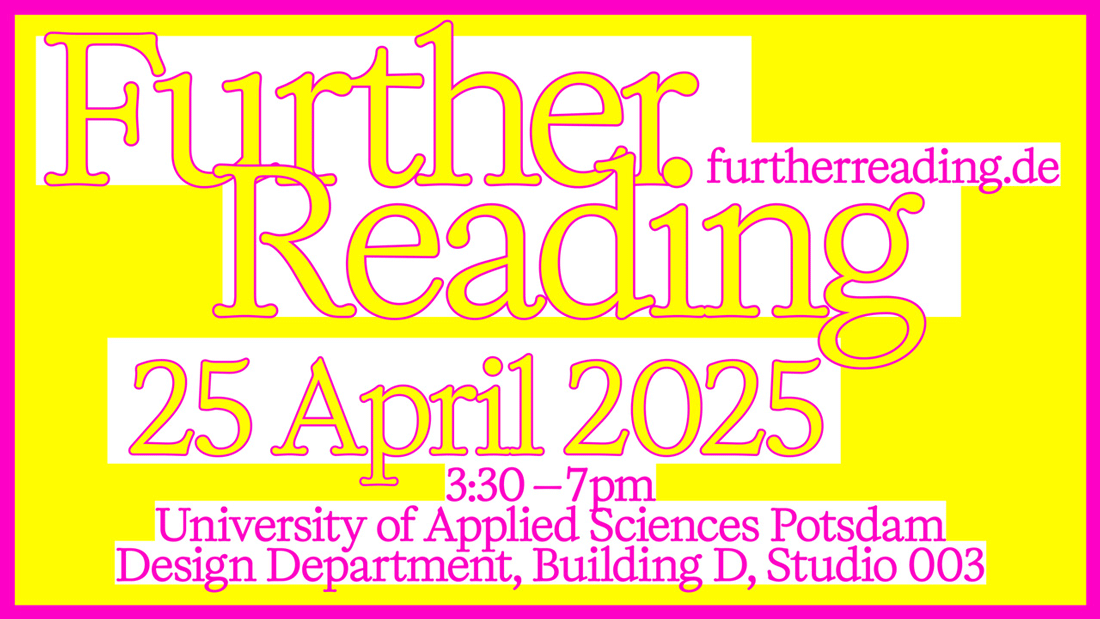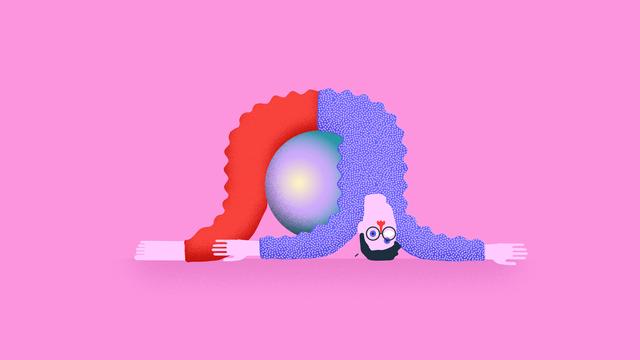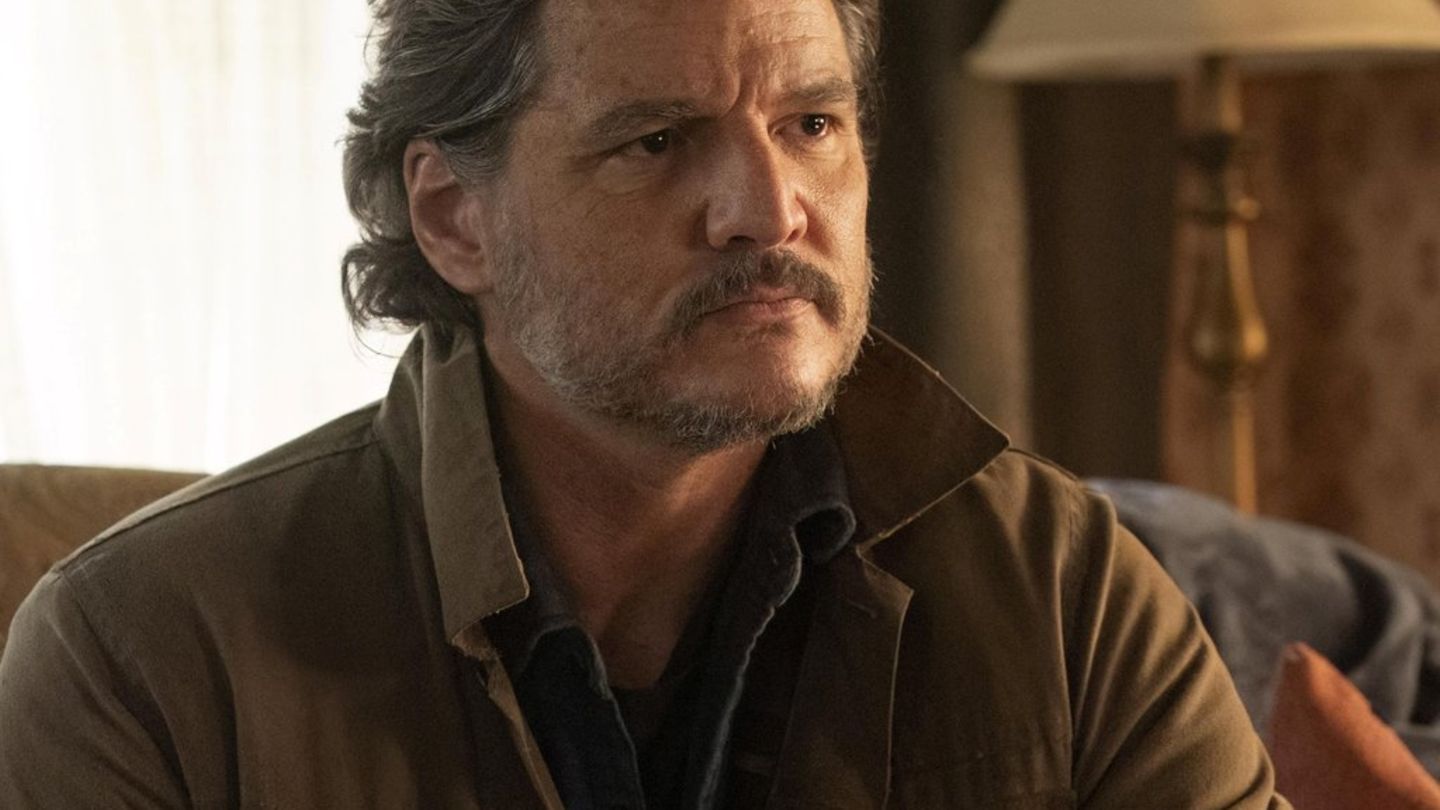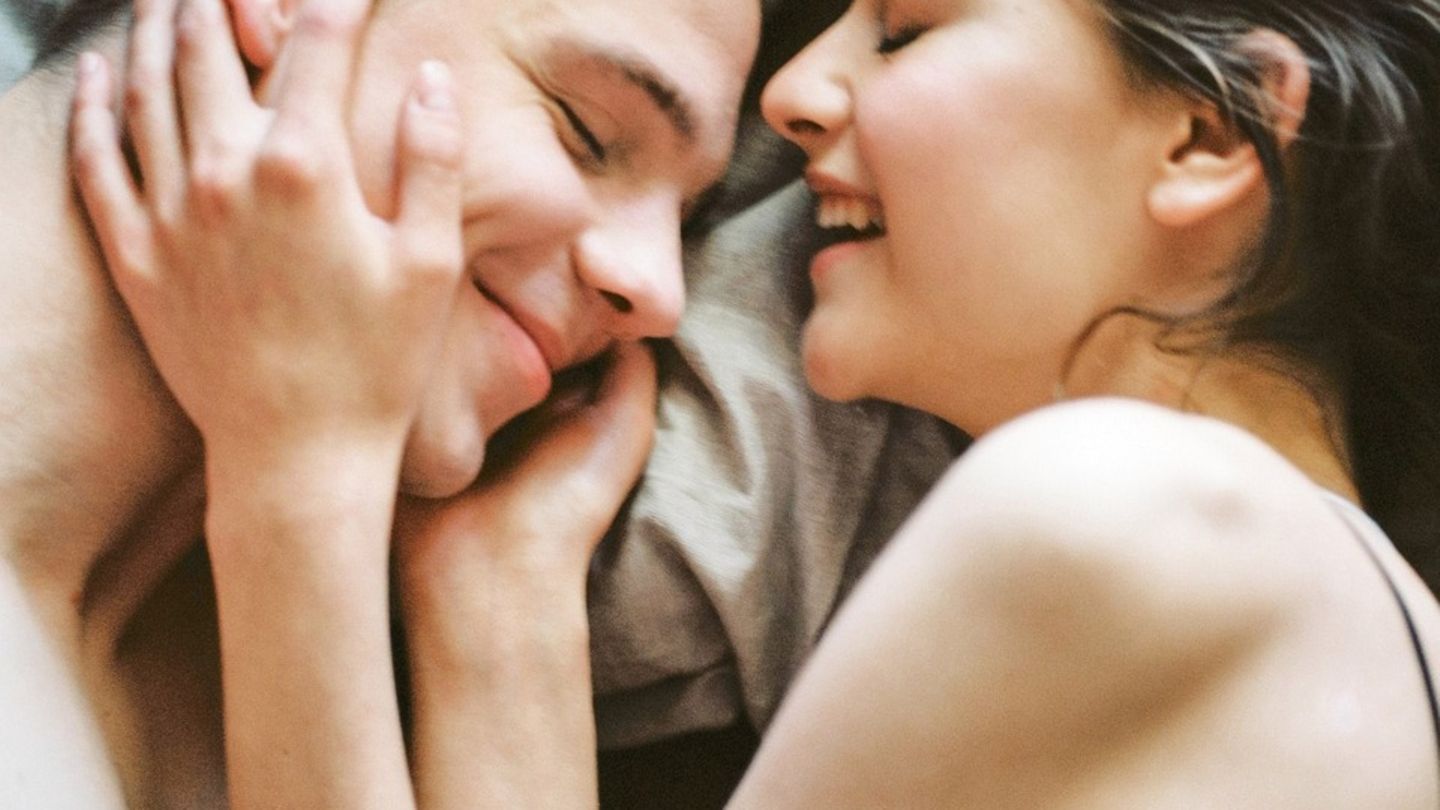Nach fast 20 Jahren im Speditionsgeschäft fasste Florian Görgner den Entschluss, auf eigenes Risiko zu arbeiten – und selbst ein Unternehmen zu erwerben. Vor der Entscheidung hatte der 41-Jährige als angestellter Manager die Speditionen anderer Eigentümer saniert. „Ich habe die Firmen wieder flottgemacht, aber ich hatte dabei immer das Gefühl: Ich rackere mich ab, und andere ernten die Früchte meiner Arbeit“, erzählt der Unternehmer.
2022 kaufte Florian Görgner deshalb die Tide Spedition in Stockstadt am Main bei Aschaffenburg. Das war aber nur der Anfang. In den Folgejahren erwarb er weitere Logistikfirmen. So übernahm der Unternehmer 2024 die Spedition Jürgen Arnold bei Nürnberg. Im März 2025 kam der IL-Kurier- und Transportdienst aus Rostock zur Firmenfamilie hinzu.
Die Zukäufe sind für Görgner Teil seiner Wachstumsstrategie – so kommt er an neue Mitarbeiter, Fahrzeuge und Kunden. Er sagt: „Ich glaube, in Zeiten wie diesen kann man nur durch Zukäufe wachsen.“ Allein durch den Vertrieb neue Kunden zu gewinnen, sei in seiner Branche gewissermaßen aussichtslos.
Der Weg zum Firmenkauf ist oft lang
Doch das ist leichter gesagt als getan: Wer einen passenden Übernahmekandidaten sucht, muss genau hinschauen und möglicherweise viel Geduld mitbringen.
Warum die Suche schwierig ist, weiß Bernd Friedrich. Er ist Geschäftsführer der Correct Unternehmensvermittlung und sucht im Auftrag von verkaufswilligen Unternehmerinnen und Unternehmern nach potenziellen Käufern. „Es gibt einen großen Bedarf an Nachfolge, aber viele gehen das Thema nicht strategisch an“, sagt er. Die Folge: Die Firma soll ad hoc verkauft werden, zum Beispiel, wenn der Inhaber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Dabei stellt sich dann die Frage: Sind die Betriebe überhaupt abgabefähig?
„Meine Schätzung ist, dass 30 bis 40 Prozent der Unternehmen, die auf dem Markt zum Verkauf stehen, im Grunde gar nicht verkäuflich sind“, sagt der Nachfolgeberater Friedrich. Entweder wurde es versäumt, in neue Maschinen oder in die Digitalisierung zu investieren, oder das Unternehmen ist komplett von der Person des Inhabers abhängig. „Auf diese Unternehmen treffen dann die Kaufinteressenten und klagen, dass sie keine passenden Objekte finden.“
Doch wie geht es besser? Wie lassen sich unter den Firmen, die zum Verkauf stehen, die Perlen finden? Wie kann man beurteilen, ob sich ein Investment lohnt? Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema Unternehmenskauf.
Wie viel Zeit solltest du für die Suche einplanen?
„Sowohl Verkäufer als auch Käufer unterschätzen oft, wie lange der Prozess der Nachfolgersuche dauert“, sagt Steffen Schulz, Geschäftsführer der Beratungsfirma NIC Interconsult, der Unternehmen beim Verkauf begleitet. Die Annahme, dass ein Firmenverkauf nach einem halben Jahr in trockenen Tüchern ist, sei in vielen Fällen falsch.
Von den ersten Gesprächen mit potenziellen Interessenten bis zur Vertragsunterzeichnung beim Notar vergehen oft bis zu zwei Jahre. Diese Zeit sollten auch Unternehmer und Unternehmerinnen mitbringen, die auf der Suche nach einem Kaufobjekt sind.
Auch für Florian Görgner war es ein weiter Weg bis zum Firmenkauf. Auf jede erfolgreiche Übernahme kamen mehrere Gespräche, die im Sande verliefen. Bevor der Logistikexperte seine erste Spedition erwarb, hatte er sich zahlreiche Betriebe angesehen – darunter auch ein Maschinenbauunternehmen. Doch ein Konkurrent bot einen höheren Kaufpreis.
Für Görgner gehören solche Erfahrungen dazu: „Aus dem Scheitern habe ich etwas über den Prozess des Firmenkaufs gelernt und wie man mit der Bank verhandelt“, sagt er im Rückblick.
Wie findest du das richtige Unternehmen?
Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten, Firmen zu finden, die zum Verkauf stehen. Zum Beispiel über das eigene Netzwerk, also über Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber, die entweder selbst ihren Betrieb abgeben wollen oder jemanden kennen, der das vorhat.
Die zweite Option ist, sich an Berater aus dem Bereich „Merger and Acquisitions“ (M&A) zu wenden. Sie sind darauf spezialisiert, vor allem mittelgroße Betriebe zu vermitteln. Laut Steffen Schulz von NIC Interconsult lohne sich die zeitintensive Suche für Dienstleister erst ab einem Firmenwert von 2 bis 3 Millionen Euro. Wer beispielsweise ein technisches Unternehmen mit zwei Dutzend Mitarbeitenden sucht, könnte hier fündig werden.
Um kleinere Firmen mit 1 Million Euro Jahresumsatz oder weniger zu finden, wie Handwerksunternehmen, Restaurants oder Versicherungsmakler, eignen sich Online-Unternehmensbörsen. „Hier lohnt sich ein Berater, der aktiv nach einem Nachfolger sucht, oft nicht“, sagt Steffen Schulz.
Es gibt etliche Unternehmensbörsen, die sich auf bestimmte Regionen oder Branchen spezialisiert haben. Die größte ist die vom Bundeswirtschaftsministerium betriebene Plattform Nexxt Change. Dort sind rund 7000 Firmen aufgeführt, die zum Verkauf stehen – Kaufinteressenten können die Angebote nach Branche und Standort filtern.
Worauf sollten Käufer vor der Übernahme achten?
Ein wichtiges Kriterium ist die sogenannte Exit-Readiness. Damit ist gemeint, ob im Betrieb bereits die Weichen für einen Verkauf gestellt wurden. Wann ist eine Firma verkäuflich beziehungsweise unverkäuflich? „Je klarer, einfacher und fokussierter das Geschäftsmodell, desto schneller kommt es zu einem Abschluss“, sagt Axel Blecher, der sich bei NIC Interconsult um die finanziellen Aspekte einer Übernahme kümmert. Der historisch gewachsene Gemischtwarenladen sei laut dem Experten sehr viel schwerer zu verkaufen.
Zudem dürfe die Firma nicht zu sehr vom Inhaber oder von der Inhaberin abhängen, das Geschäft sollte auch ohne sie erfolgreich funktionieren, erklärt Axel Blecher. Kleine Unternehmen hätten meist keine zweite Führungsebene. Das sei ein großer Nachteil beim Verkauf: „Wenn wir mit Interessenten reden, wird üblicherweise gleich in den ersten Minuten nach der zweiten Führungsebene gefragt.“
Ob es Mitarbeitende gibt, die Verantwortung übernehmen, darauf achtet auch Florian Görgner: „Der Laden muss laufen, denn ich habe nicht die Zeit, den ganzen Tag Feuerwehr zu spielen“, sagt der Unternehmer, der neben seinen Speditionen noch ein Beratungsunternehmen und ein BBQ-Restaurant betreibt. „Man kann nicht immer überall sein. Ich fahre jetzt schon mehr als 70.000 Kilometer im Jahr, aber das geht nur begrenzt.“
Florian Görgner kauft deshalb nur Firmen, in denen er operativ nicht mitarbeiten muss: „Ich kümmere mich gerne darum, das Unternehmen zu modernisieren und zum Beispiel die Buchhaltung zu digitalisieren. Aber meine Leute müssen den Laden schmeißen.“
Was macht den Wert eines Unternehmens aus?
© Bernd Roselieb für impulse Florian Görgner hat Erfahrung darin, Unternehmen zu kaufen. Sein Restaurant „Make BBQ great again“, das er gemeinsam mit Co-Geschäftsführerin Lucy Sittinger betreibt, ist dagegen eine Eigengründung.
Viele Vorbesitzer würden den Wert ihrer Firma überschätzen, so der Unternehmensberater Steffen Schulz. „Die Verkäufer haben oft mithilfe einer groben Faustformel – zum Beispiel durch einen Online-Rechner – einen Firmenwert ermittelt, ohne sich genauer anzusehen, in welchem Zustand die Firma ist.“
Gängige Methoden, um den Firmenwert zu berechnen, berücksichtigen den Ertrag eines Unternehmens, der multipliziert wird mit einem Faktor, der je nach Branche und Verfahren variiert. Zusätzlich fließen in die Berechnung auch Sachwerte ein wie die Firmenimmobilie oder der Fuhrpark.
Doch der wahre Unternehmenswert richtet sich nicht bloß nach betriebswirtschaftlichen Zahlen. „Wichtiger als alles andere sind die Zukunftsaussichten des Unternehmens“, sagt Steffen Schulz. Käufer sollten sich daher immer fragen: Ist das Unternehmen für künftige Entwicklungen gut aufgestellt? Gibt es auch in einigen Jahren noch einen Markt für das Produkt oder die Dienstleistung? „Wenn man das mit ‚Ja‘ beantworten kann, kann man über einen Einstieg nachdenken.“
Schulz nennt das Beispiel eines Herstellers von Bauteilen für Dieselmotoren mit einem Jahresumsatz von über 10 Millionen Euro und einem Vorsteuergewinn von rund 20 Prozent, der es versäumt hat, sein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. „Da kann das Geschäft so gut laufen, wie es will, wenn ein Risiko wie das Aus des Dieselmotors droht, ist das Unternehmen quasi unverkäuflich.“
Was beeinflusst noch die Preisverhandlungen?
Der berechnete Unternehmenswert und der Kaufpreis, der am Ende tatsächlich gezahlt wird, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Verkäufer hätten oft illusorische Preisvorstellungen, sagt Florian Görgner. „Viele denken, ihre Firma ist ein Rohdiamant. Aber ich bezahle doch nicht für das Potenzial, wenn ich die Arbeit erst noch machen muss.“
Insbesondere wer einen Betrieb zukaufen will, um zu wachsen, sollte genau prüfen, wie sich die neue Firma in das bestehende Unternehmen einfügt. Passt der Betrieb ins Portfolio? Welche Vermögenswerte bringt das Unternehmen mit? Hat die Firma die Anknüpfungspunkte, die ich für die Weiterentwicklung brauche? „Da geht es nicht in erster Linie darum: Wie viel Gewinn macht ein Betrieb?“, sagt der Nachfolgeberater Bernd Friedrich von der Correct Unternehmensvermittlung. Sondern auch darum: Passt das zu mir und meinen unternehmerischen Vorstellungen?“
Wenn die Käuferin und der Verkäufer zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, helfen auch Preisverhandlungen wenig, hat Friedrich beobachtet. Umgekehrt gelte: Wenn beide Seiten eine ähnliche Vorstellung davon haben, wie das Unternehmen fortgeführt werden soll, dann werden sie sich auch beim Preis einig. „Wenn der Käufer in dem Unternehmen einen strategischen Wert sieht, kommt es am Ende nicht darauf an, ob er nun 1 Million oder 1,2 Millionen Euro zahlt.“
Oder die Käufer gehen im Preis runter, wenn sie die Firma in guten Händen wissen. „Ich habe eine Spedition gekauft, da wollte der Inhaber schnell raus“, erzählt Florian Görgner. „Der Deal war: Ich nehme ihm seine Sorgen ab, aber dafür muss er mir halt auch mit dem Preis entgegenkommen.“
Wie lässt sich ein Firmenkauf finanzieren?
Wer nicht genügend Eigenmittel hat, um den Preis zu bezahlen, kann einen Kredit aufnehmen. Das ist naheliegend, aber: „Besonders wenn externe Finanzierungspartner mit an Bord kommen, braucht es eine sorgfältige Vorbereitung“, sagt der Finanzierungsexperte Axel Blecher.
Wer ein Darlehen von der Bank aufnimmt, muss einkalkulieren, dass die Zinsen an die Bank die Eigenkapitalrendite des Unternehmens schmälern. Je höher der Zins, desto rentabler muss das Unternehmen sein, damit es für einen Kauf überhaupt noch infrage kommt. „Die gestiegenen Zinsen sind einer der Gründe, warum es aktuell schwieriger ist, Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen.“
Gefragt sind daher oft alternative Finanzierungsoptionen: „Ein Verkäuferdarlehen kommt meist ins Spiel, wenn eine Einzelperson als Käufer nicht über das nötige Eigenkapital verfügt“, erläutert Blecher. Der Verkäufer wandelt dabei einen Teil des Kaufpreises in ein Darlehen um. „Ich kaufe eine Firma nicht ohne ein Verkäuferdarlehen“, verrät Florian Görgner. „Ich möchte vom Verkäufer das Signal, dass dieser an sein Unternehmen glaubt.“
Mehr zum Thema
Unternehmenswert berechnen
So viel ist Ihre Firma wert
Förderprogramme für Nachfolge
Wie Sie einen Firmenkauf mit Fördermitteln finanzieren
Allerdings können Käufer nicht damit rechnen, über diesen Weg den Kauf zu stemmen. Es braucht oft einen Finanzierungsmix. Bei Görgner sieht es so aus: Er finanzierte seine Firmenkäufe mit einer Eigenkapitalquote zwischen 5 und 10 Prozent. Der Rest kam von der Bank, durch ein Verkäuferdarlehen oder aus Fördermitteln.
Letztere kommen üblicherweise von den Landesförderbanken – bei Görgner etwa von der LfA Förderbank Bayern – oder von der Förderbank KfW, die Käufe zum Beispiel mit zinsgünstigen Gründerkrediten unterstützt. Doch Görgner sagt auch: „Das muss man alles selbst recherchieren, bei der Bank weist einen niemand auf diese Möglichkeiten hin.“
Welche Experten sollten den Kauf begleiten?
Der Verkaufsprozess erfordert prinzipiell eine professionelle Begleitung durch Unternehmensberater, Steuerberater und auf Übernahmen spezialisierte Juristen. „Eine Firmenübernahme machen schließlich die meisten nur einmal im Leben“, sagt der Unternehmer Florian Görgner. So braucht es Fachleute, um zum Beispiel Verträge aufzusetzen oder um eine sorgfältige Prüfung, auch Due Diligence genannt, durchzuführen. Hier geht es zur Due-Dilligence-Checkliste von impulse.
„Hier sollte man sich bitte nicht einen Familien- oder Arbeitsrechtler als Anwalt nehmen, sondern einen Fachanwalt für Gesellschaftsrecht, am besten mit der Zusatzqualifikation ‚Fachberater für Unternehmensnachfolge‘, der Erfahrung in diesem Bereich hat“, sagt Bernd Friedrich von der Correct Unternehmensvermittlung. Das Gleiche gelte für den Steuerberater. „Viele Inhaber haben seit Jahrzehnten denselben Steuerberater, aber das sind oft eher ‚Buchhalter‘, die wenig bis keine Ahnung von Firmenübergaben und deren steuerlichen Auswirkungen haben.“
Eine gute Anlaufstelle sowohl für Käufer als auch für Verkäufer sind auch M&A-Berater, die den gesamten Prozess eines Firmenverkaufs von Anfang bis Ende begleiten. „Das kann helfen, die Emotionen aus den Verhandlungen rauszunehmen“, sagt Görgner.
Welche Risiken bestehen noch bei der Übernahme?
Bei Vertragsverhandlungen gehe es oft vorrangig um die Sachebene. „Aber daneben gibt es eine wichtige, emotionale Ebene, die meist nicht zur Sprache kommt“, sagt Laura Foddis, Chefin der Unternehmensberatung Nächstes Kapitel. Sie begleitet Familienunternehmen bei der Übergabe an die nächste Generation oder an einen externen Nachfolger. „Letztlich geht es dabei immer um die Übergabe eines Lebenswerks“, sagt die Nachfolgeexpertin, die selbst aus einer Unternehmerfamilie stammt.
Käufer sollten sich daher auch mit dem Vorgänger oder der Vorgängerin auseinandersetzen, rät Foddis. Mit welcher Persönlichkeit hat man es zu tun? Mit welchen Werten hat er das Unternehmen geführt? Welches Standing hatte sie im Team? Wer eine Firma kaufen will, sollte sich auch fragen: „Bin ich bereit, mich mit den gewachsenen Strukturen in der Belegschaft auseinanderzusetzen?“, so Foddis.
Auch Florian Görgner warnt mit Blick auf das Verhältnis zum Vorgänger: „Wenn man merkt, es passt nicht vom Menschlichen her, dann sollte man es lassen.“ Er selbst habe auch schon Kaufangebote abgelehnt, weil er das Gefühl hatte, es könnte zum Streit kommen.
Wie gelingt ein reibungsloser Übergang?
Ein gutes Verhältnis zum Vorbesitzer ist vor allem dann wichtig, wenn beide Seiten für eine Übergangszeit noch zusammenarbeiten sollen. Denn mit der Unterschrift beim Notar ist der Nachfolgeprozess noch nicht zu Ende. Nun müssen Nachfolger und Übergebende für einen reibungslosen Übergang sorgen.
Dafür kann es sinnvoll sein, wenn die Vorgängerin für eine Weile dem Unternehmen verbunden bleibt – etwa über einen Beratungsvertrag. „So eine Übergangsfrist sollte allerdings nicht länger als sechs bis maximal zwölf Monate dauern“, sagt der Nachfolgeberater Bernd Friedrich. „Dann ist ein klarer Schlussstrich nötig.“ Dass der Verkäufer dem Betrieb darüber hinaus noch als Gesellschafter, Vermieter oder gar Angestellter erhalten bleibt, davon hält Friedrich wenig: „Wenn da zwei Alphatiere im Unternehmen aufeinandertreffen, ist Streit vorprogrammiert.“
Wenn ein Verkäufer dennoch Anteile am verkauften Unternehmen hält, sollte dessen Rolle vorher klar geregelt werden. Im Fall der Tide Spedition erwarb Görgner 80 Prozent der Anteile – 20 Prozent verblieben beim Vorbesitzer, der sich allerdings aus dem operativen Geschäft komplett zurückgezogen hat.
Wie integrierst du die neue Firma in den Betrieb?
„Viele Deals sind betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber die kulturelle Komponente wird dabei oft vernachlässigt“, sagt Bernd Friedrich. Wer über Zukäufe wächst, der müsse anschließend die erworbene Firma in die gewachsene Firmenkultur eines bestehenden Unternehmens integrieren. Das gelingt nicht immer. „Man muss sich auch um die neuen Mitarbeiter kümmern“, sagt der Experte und warnt: „Sonst sind besonders die guten ganz schnell weg.“ Das gelte insbesondere, wenn die Firmenübernahme als Strategie gegen den Fachkräftemangel gedacht war.
Der Nachfolgeberater habe immer wieder erlebt, dass auch große Unternehmen in großem Stil günstig Betriebe kaufen, aber es dann versäumen, diese auch kulturell zu integrieren. „Es ist keine Seltenheit, dass nach einer Übernahme ein Großteil der Belegschaft das Unternehmen verlässt“, sagt Friedrich.
Es gebe immer eine Prägung durch den Vorbesitzer, die aufgebrochen werden müsse, bestätigt Laura Foddis. Der Nachfolger muss sich ein eigenes Profil erarbeiten und der Belegschaft seine Ziele kommunizieren. „Das erfordert intensive Führungsarbeit.“
Wer das zum ersten Mal macht, sollte sich daher auf jeden Fall Unterstützung holen – sei es durch einen externen Berater oder eine Beraterin, die den Prozess begleiten, oder durch einen erfahrenen Geschäftsführer.
Auch Görgner muss nun dafür sorgen, dass die Teams seiner verschiedenen Unternehmen zusammenwachsen. So nutzt der umtriebige Inhaber sein BBQ-Restaurant auf dem Speditionsgelände in Stockstadt auch, um firmenübergreifend mit allen mittlerweile 22 Teammitgliedern zu feiern. „Dann kocht der Chef für die ganze Mannschaft.“
Angst, sich zu verzetteln, hat Görgner keine: Er arbeitet bereits an der Übernahme einer weiteren Spedition aus Koblenz, die noch im Frühjahr über die Bühne gehen soll.
The post Ein Unternehmen kaufen? So geht’s appeared first on impulse.














:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/4d/1d4d18230dd6ea00a5b56151d22e7c09/0124273433v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/53/1c/531ca4e7248c6b0ca27bc0841e01b04e/0123928600v1.jpeg?#)


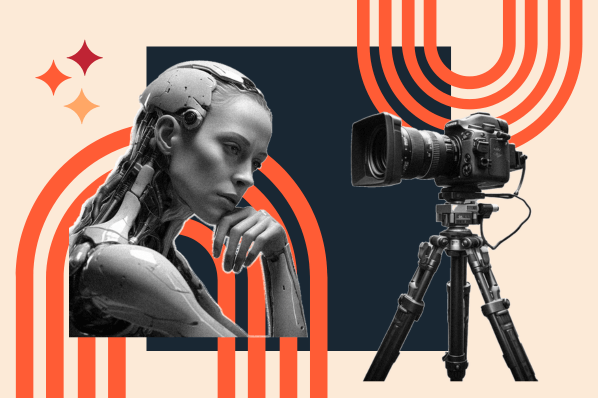
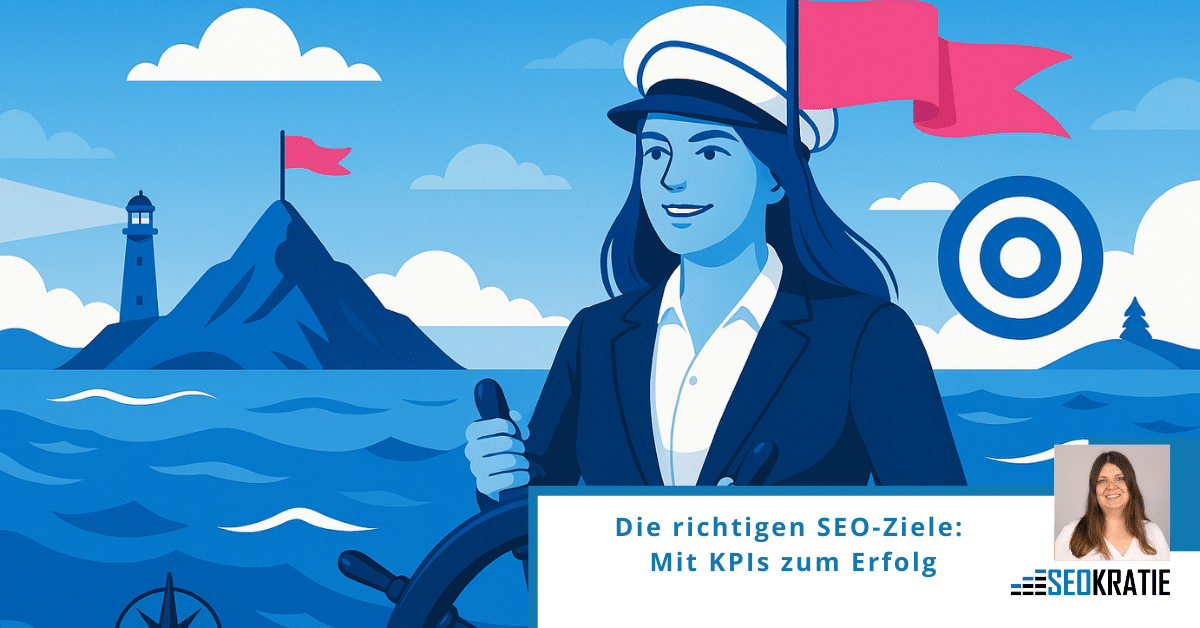

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/4d/7b4db513dbf3dffae788c10172bf461a/0123980029v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/48/8a/488a09be8cd964e15d30843bc249f395/0124273194v2.jpeg?#)