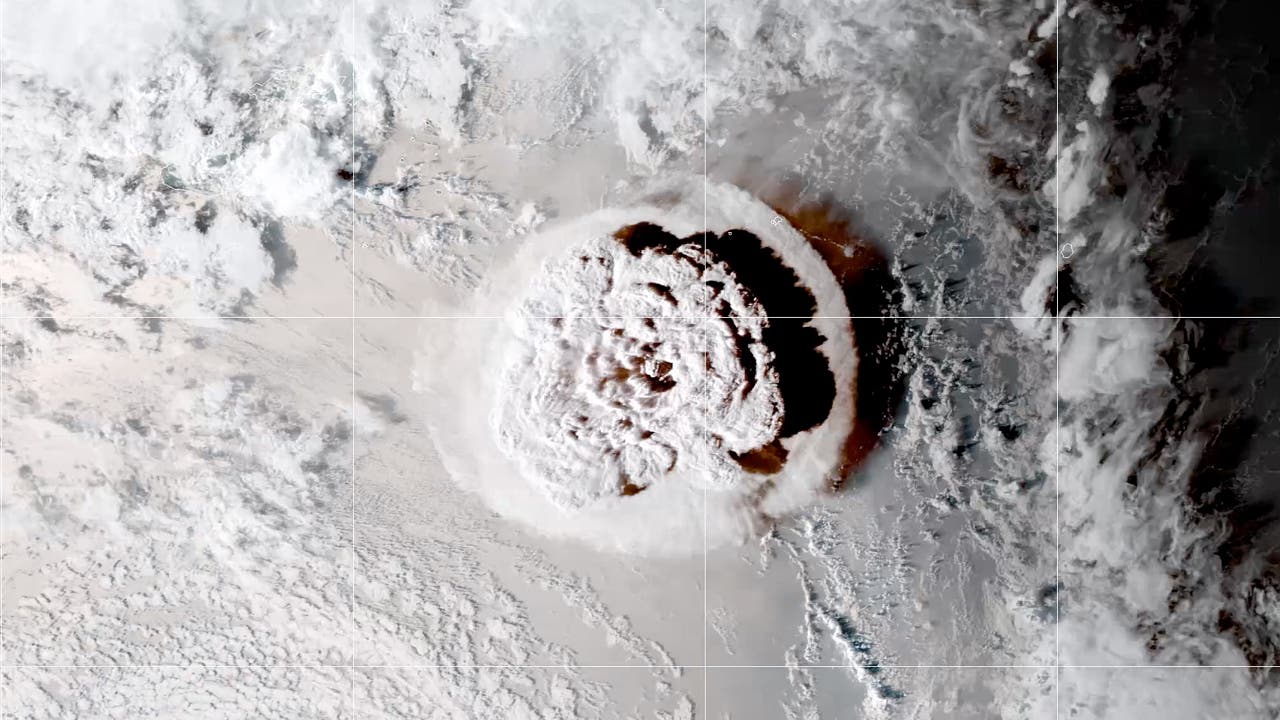Umfrage: Vier von zehn Deutschen glauben, dass "bei Bio viel betrogen wird"
Obwohl der Umsatz mit Öko-Lebensmitteln stetig steigt, ist das Vertrauen in Bio erstaunlich gering. Einer aktuellen Studie zufolge liegt das auch an fehlendem Lebensmittel-Wissen

Obwohl der Umsatz mit Öko-Lebensmitteln stetig steigt, ist das Vertrauen in Bio erstaunlich gering. Einer aktuellen Studie zufolge liegt das auch an fehlendem Lebensmittel-Wissen
Deutschland ist weltweit der zweitgrößte Markt für Bio-Lebensmittel. Und die Branche boomt. Gleichzeitig wissen viele Menschen hierzulande wenig darüber, was Bio eigentlich ist – oder misstrauen dem Label gar. Das zeigt eine Umfrage unter 2000 Menschen in Deutschland.
Für die Studie "Authentizität und Vertrauen bei Bio-Lebensmitteln" fragten Forschende nach Wissen und Einstellungen zum Thema Bio. Das Ergebnis: Jede oder jeder Fünfte weiß nicht, was Bio eigentlich bedeutet – und diejenigen, die Grundwissen über Bio-Qualität haben, sind oft misstrauisch. So ist nur jede oder jeder Dritte überzeugt, dass gekennzeichnete Produkte auch wirklich Bio sind; 40 Prozent sind sogar der Meinung, dass "bei Bio viel betrogen" wird. Immerhin 18 Prozent der Befragten glauben, dass Bio-Produkte und konventionell erzeugte Lebensmittel sich überhaupt nicht unterscheiden.
Oft sei das Misstrauen auf unzureichendes Wissen, aber auch auf überhöhte Erwartungen und Wunschvorstellungen zurückzuführen, schreiben die Forschenden. Bio sei zu einem "überhöhten Symbol rundum guter Lebensmittel" geworden, erklärt die Studienautorin, Professorin Antje Risius von der Georg-August-Universität Göttingen. Viele Konsumentinnen und Konsumenten hätten die Vorstellung, Bio-Lebensmittel seien "gut für die Tiere und die Umwelt". Wenn sich dann herausstellt, dass das nicht stimmt – etwa weil Bio-Gemüse aufwendig in Plastik verpackt ist oder Bio-Obst aus Übersee CO2-intensiv eingeflogen wurde – wird die Erwartungshaltung enttäuscht. Und Misstrauen geschürt.
Zudem gelte es, zwischen Produkt- und Prozessqualität zu unterscheiden, erläutert die Agrar- und Ernährungswissenschaftlerin Risius. "Während sich das Erstere unmittelbar am Produkt ausmachen lässt, etwa am Preis, am Aussehen oder dem Geschmack, lässt sich die Prozessqualität kaum direkt am Produkt selbst ablesen." Also genau das, was Bio eigentlich ausmacht, nämlich die Vorgaben, nach denen Tiere gehalten, Pflanzen angebaut und Produkte hergestellt werden müssen. "Ich muss als Konsument oder Konsumentin einen zusätzlichen Informationsaufwand betreiben, der im Alltag nicht leicht zu leisten ist", sagt Risius.
In der EU-Bioverordnung – zu erkennen an einem aus Sternchen gebildeten Blatt auf grünem Grund – ist zum Beispiel geregelt, dass Schweine in Einstreu wühlen können, Rinder Zugang zu Weideflächen und Legehennen zum Freiland haben. Schnäbel von Hühnern und Schwänze bei Schweinen dürfen in der biologischen Haltung nicht kupiert werden. Zudem erhalten Bio-Tiere nur Bio-Futter, das überwiegend im eigenen Betrieb angebaut worden sein muss. Die Siegel der deutschen Bio-Anbauverbände, darunter Bioland, Naturland und Demeter, beinhalten meist weiter reichende und strengere Vorgaben.
Ausbauziele für Bio-Landwirtschaft verfehlt
Auch wenn der Umsatz mit Bio-Produkten weiter steigt: Von dem Ziel, 30 Prozent der deutschen Agrarflächen biologisch zu bewirtschaften, ist der Agrarsektor weit entfernt. Ein halbes Jahrhundert nach Einführung der ersten Bio-Produkte hatte die Regierung in der letzten Legislaturperiode beschlossen, den Anteil der Bio-Landwirtschaft bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Im vergangenen Jahr ist der Anteil nur um 0,4 Prozent gewachsen – auf nunmehr elf Prozent der Gesamtfläche. Weltweit sind es rund zwei Prozent der Flächen, die nach ökologischen Vorgaben bewirtschaftet werden.
Die Bio-Landwirtschaft gilt als boden- und klimaschonend. Zudem schädigt sie durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger und Pestizide die Artenvielfalt, vor allem Insekten, weniger als die konventionelle Bewirtschaftung.























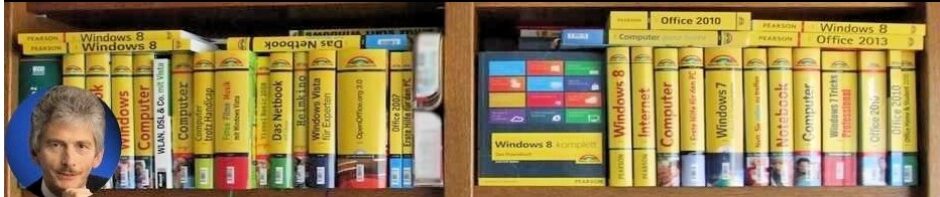
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/13/ec13751e08dc47e78920c9b83b7d26d9/0123842412v2.jpeg?#)