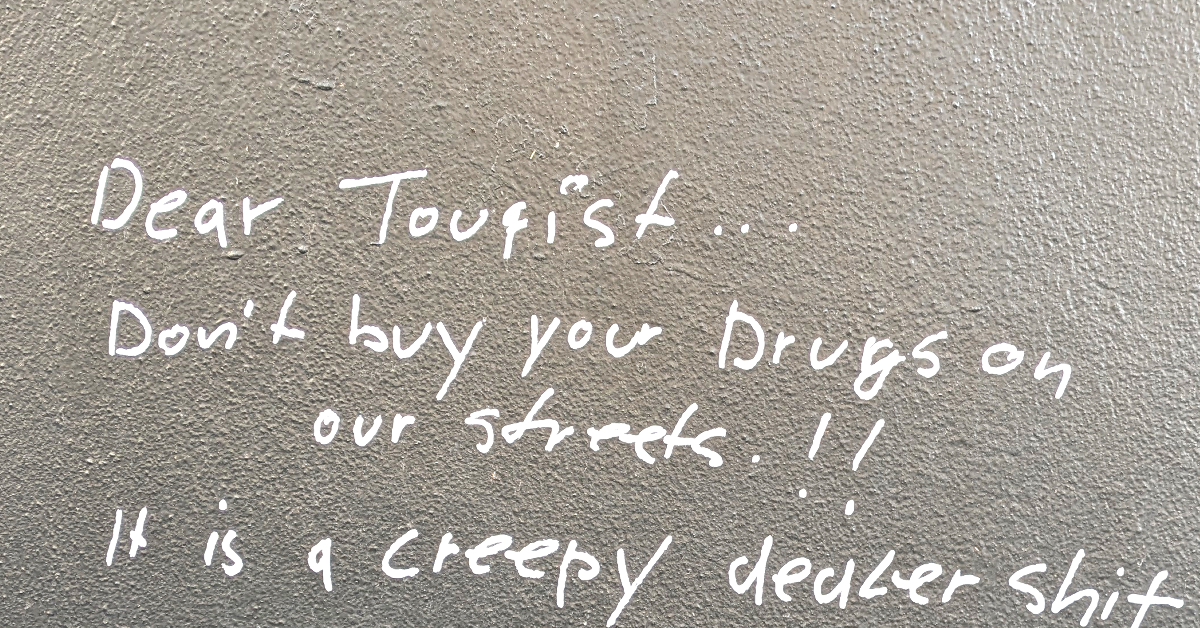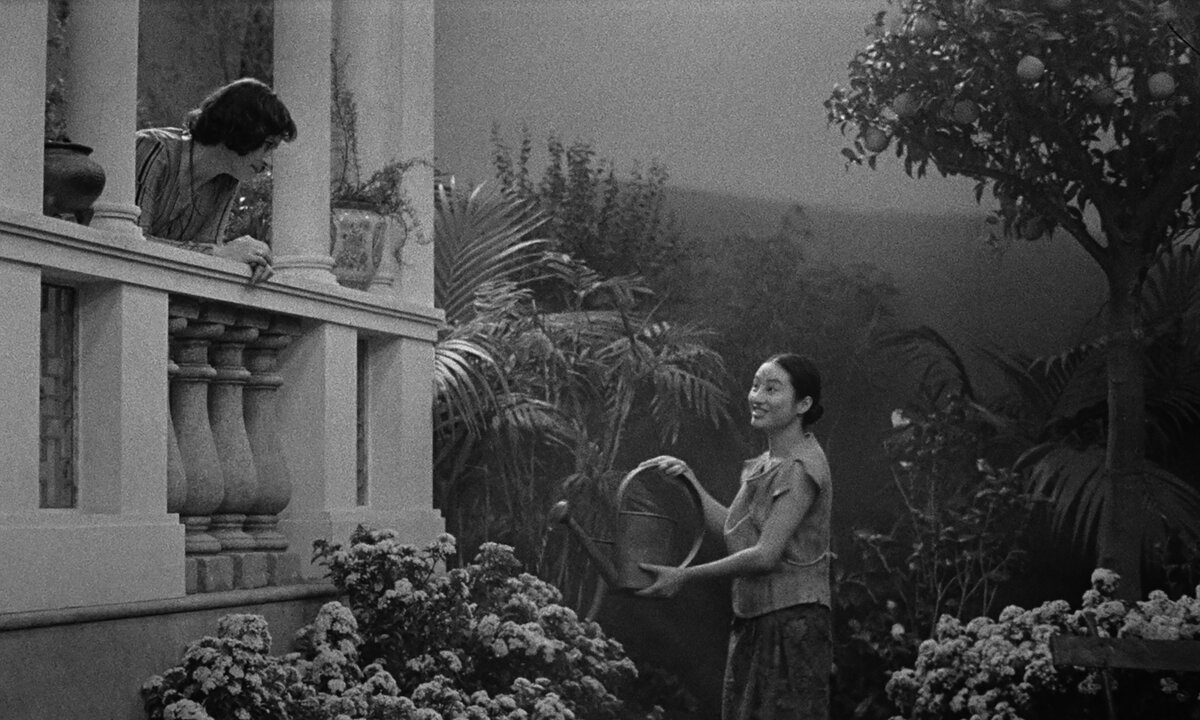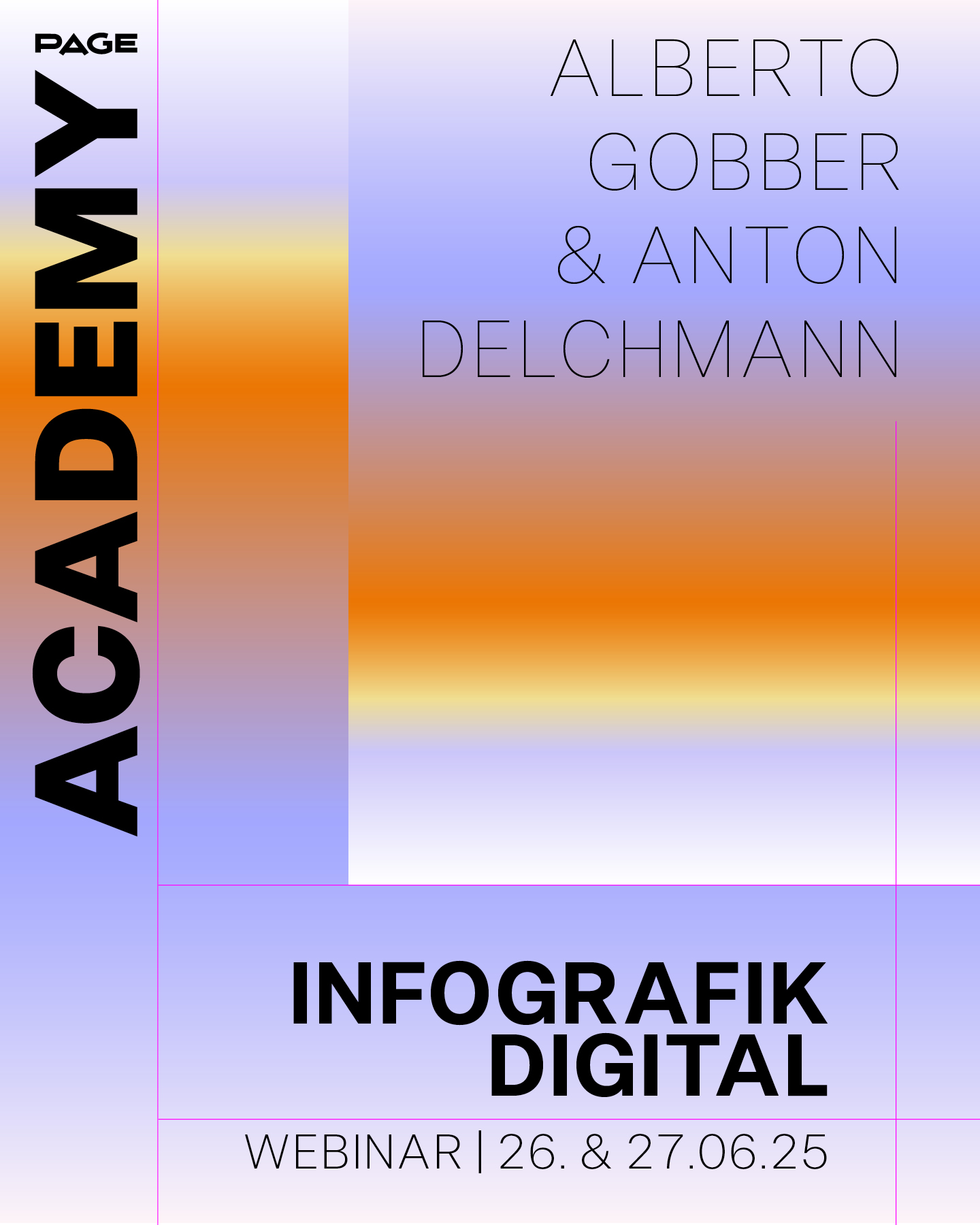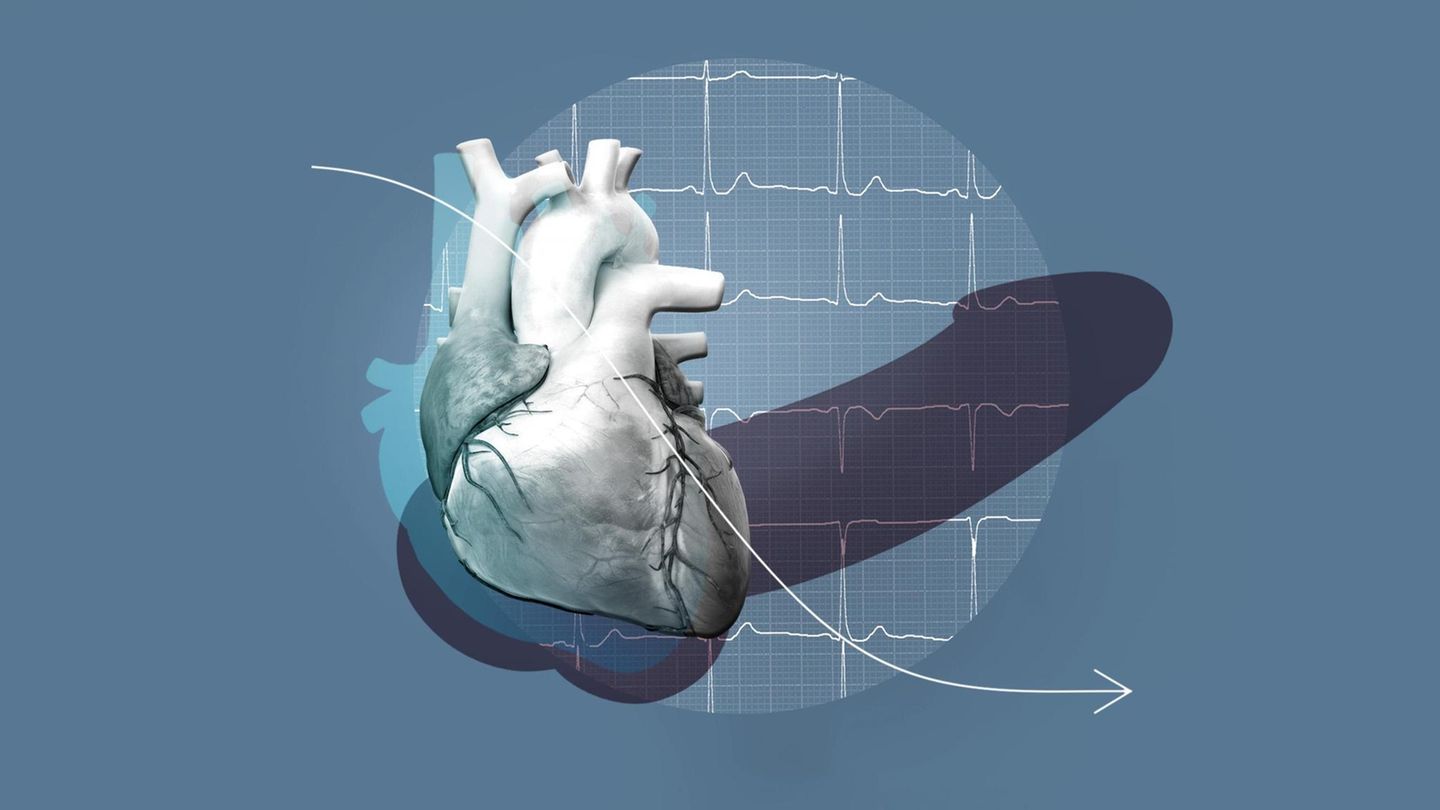Überfischung: Von Fangquoten und Netzen: Wie im Mittelalter der Fischfang gezügelt wurde
Schon im Mittelalter regulierten Obrigkeiten den Fischfang und verboten bestimmte Netze. Der Historiker Nikolas Jaspert erklärt, was das über die Haltung der Menschen zur Natur sagt

Schon im Mittelalter regulierten Obrigkeiten den Fischfang und verboten bestimmte Netze. Der Historiker Nikolas Jaspert erklärt, was das über die Haltung der Menschen zur Natur sagt
Im Januar 1403 erhält der Stadtrat von Valencia einen Brief vom Grafen von Denia. Es geht um Fische. Die gerade aus Katalonien eingetroffenen neuen Netze würden – bemängelt der Graf – "das Meer in Brand setzen". Die Netze seien ungeeignet und holten zu viel Beifang aus dem Wasser. Deshalb verbietet er den Fischern in Valencia, die besagten Netze zu nutzen.
Nicht nur auf der iberischen Halbinsel macht man sich in jener Zeit Gedanken zur Überfischung. In London haben Bürgermeister und Ratsherren bereits 1386 erkannt, dass Netze und Fischzäune die Bestände in der Themse bedrohen – und den Fang reglementiert.
"Das Wort Nachhaltigkeit wurde nicht benutzt, aber eine Vorstellung davon gab es sehr wohl"
Hatten die Menschen im Mittelalter also so etwas wie ein Umweltbewusstsein? "Die Quellen zeigen, dass unseren Vorfahren durchaus bewusst war, dass ihr Handeln die Natur negativ beeinflussen konnte", meint der Historiker Nikolas Jaspert, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg.
In seinem neuen Buch "Fischer, Perle, Walrosszahn" (siehe unten) schreibt er die erste Geschichte des Mittelalters aus der Warte des Meeres – und zeigt darin auf, wie alt die Diskussionen um Überfischung und Fischfangmethoden sind. Gleichzeitig räumt er mit dem Klischee auf, die Menschen im Mittelalter hätten sich keine Gedanken über die Folgen ihres Wirtschaftens und den Verbrauch von Umweltressourcen gemacht. "Das Wort Nachhaltigkeit wurde nicht benutzt, aber eine Vorstellung davon gab es sehr wohl", so Jaspert.
Im Mittelalter spielte Fisch auf dem Speiseplan eine unterschiedlich große Rolle, je nach Region, Verfügbarkeit und sozialem Stand der Menschen. Machten Meerestiere in Küstengebieten, etwa in Byzanz einen Hauptbestandteil der Ernährung aus, verspeisten die Bewohner an Nord- und Ostseeküste zunächst in erster Linie Süßwasserfische wie Karpfen oder Welse. Erst im Hochmittelalter wandten sich Fischer verstärkt dem Meer zu: Grätenfunde zeigen, dass vor allem ab dem 11. Jahrhundert häufiger Salzwasserfische wie Kabeljau, Hering und Seehecht auf dem Teller landeten. In jener Zeit entwickelte sich Fisch, etwa in Norwegen, auch zu einem gewinnträchtigen Exportgut.
Schwarmfische fingen die Menschen im Mittelalter mit Netzen, etwa mit Stell- und Treibnetzen, in denen sich die Tiere verhedderten. "Erstere werden fest als Wehre zwischen Pfählen ausgespannt, während die Treibnetze an Bojen befestigt frei im Wasser schwimmen", schreibt Jaspert.
Der König von Frankreich normierte die Netze für den Fischfang
Offensichtlich verfolgten die Obrigkeiten die Entwicklung der Fischbestände aufmerksam. Ihnen ging es darum, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen – und Fischpopulationen langfristig zu bewahren. Deshalb fiel eine Überfischung schnell auf: "Kritik an den Zerstörungen der marinen Flora und Fauna durch Schleppnetze wurde, etwa in Narbonne, bereits im 13. Jahrhundert geäußert", schreibt Jaspert. "In Frankreich erließ König Philipp IV. im Jahre 1289 eine Ordonnance, die allzu wirkungsvolle Netze verbot beziehungsweise ihre Nutzung zeitlich einschränkte und die Größen der Maschen normierte." Auch in Venedig schränkte der Stadtrat die Nutzung von Stellnetzen ein, unter anderem, um die Wasserzirkulation in der Lagune zu schützen.
Haben bereits die Menschen im Mittelalter das Meer trotz dieser Schutzmaßnahmen überfischt? Jaspert: "Die Forschung tendiert derzeit zu dem Befund, dass eine langfristige Beschädigung des Ökosystems durch den Menschen im Mittelalter nicht nachgewiesen werden kann."
Fest steht dagegen: Schon vor mindestens 700 Jahren wurde erkannt, dass der Fischfang reguliert werden muss. Die Diskussion aber, wie viel und unter welchen Umständen Meerestiere gefangen werden dürfen, ist noch lange nicht abgeschlossen – und wem der Fisch gehört.















:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)







:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/57/ee/57eedd11c2043e71aadc1828a06e3063/0124267466v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/aa/be/aabe28802bb6011fa4674c0846129ada/0124123611v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/b5/c4b5f9ba2c6a913088a84b641e36de3f/0124266663v2.jpeg?#)