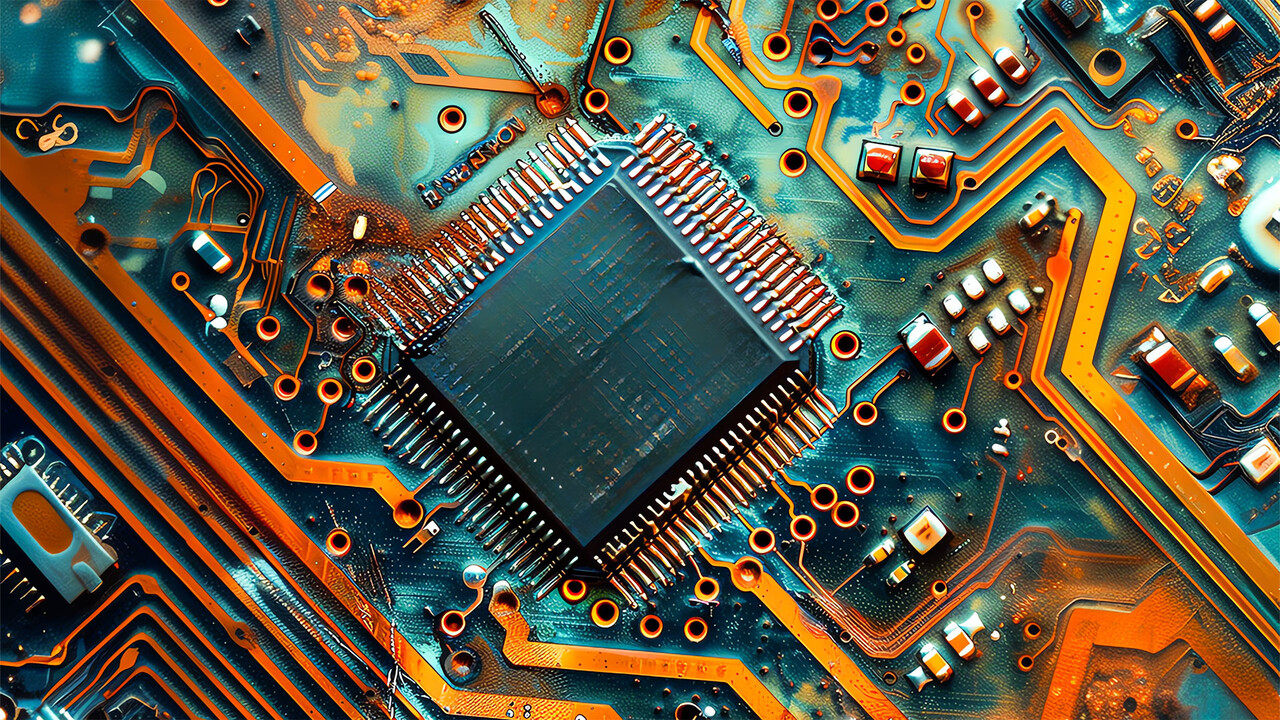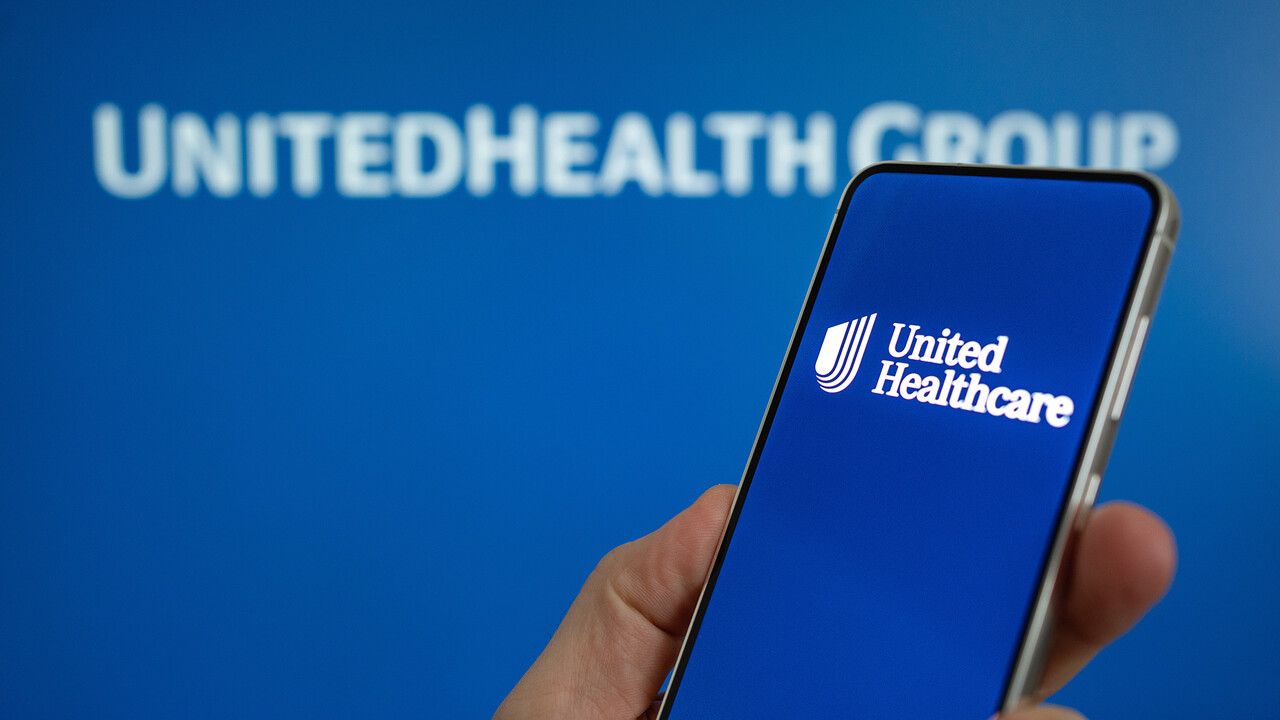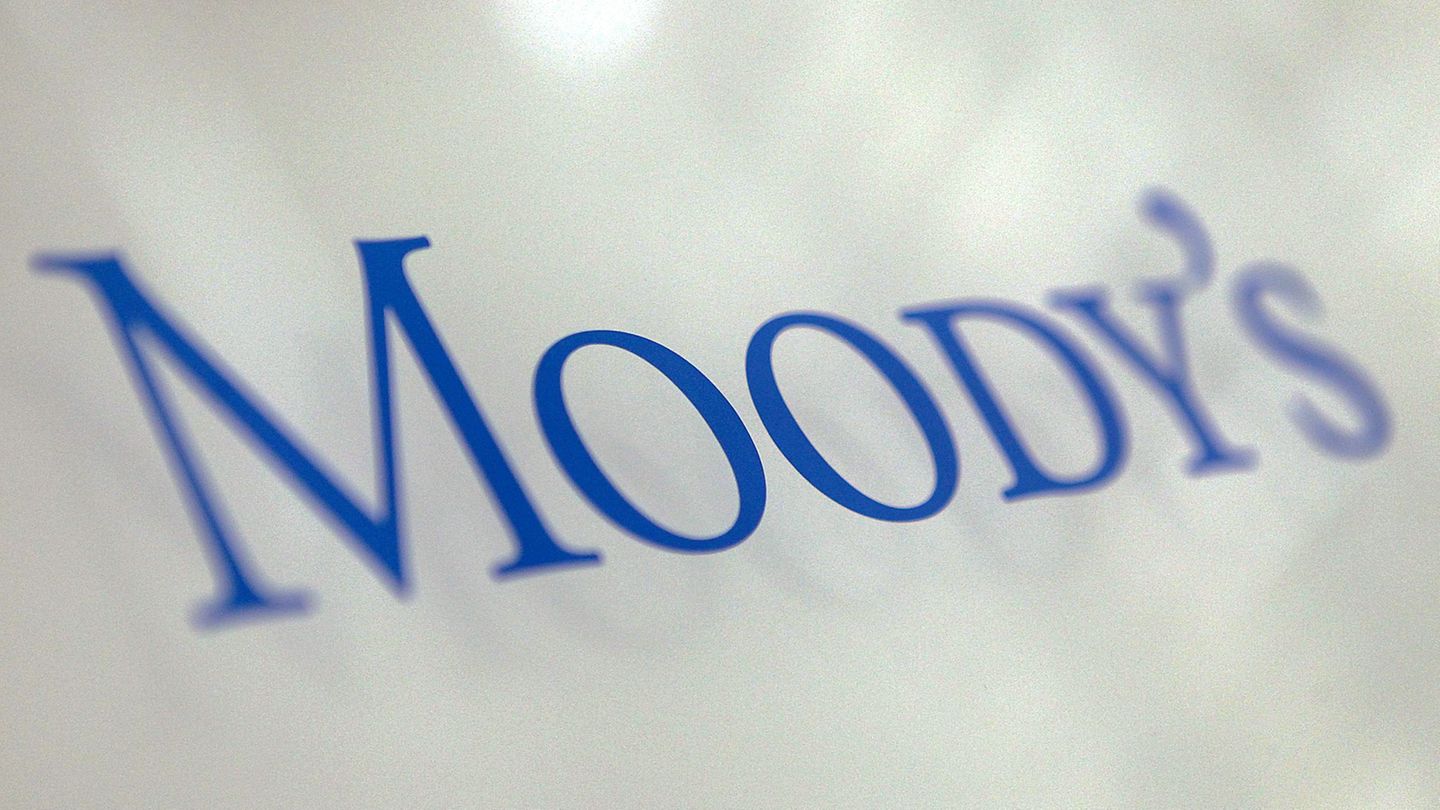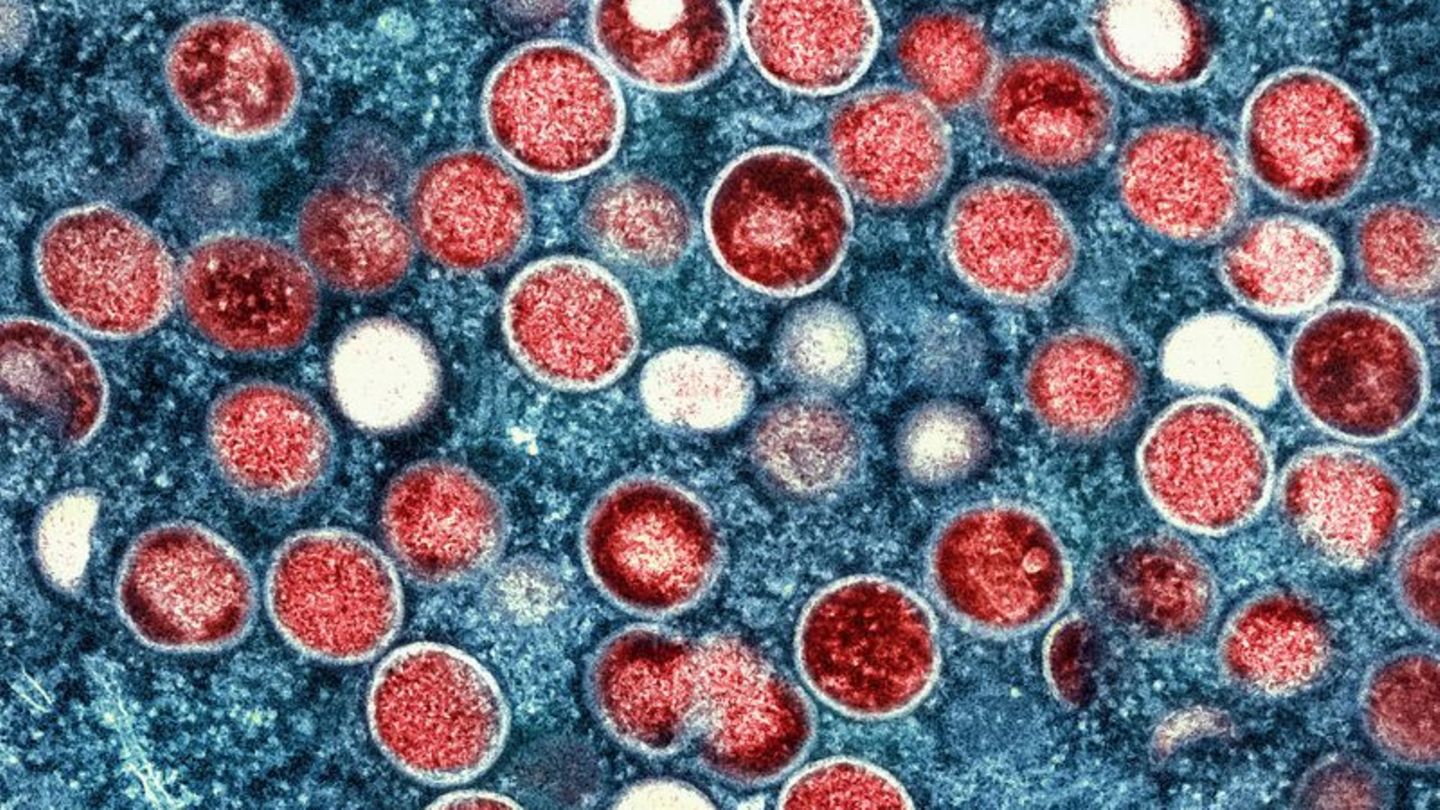"Stell dich nicht so an!" : Wie wir uns von den schädlichen Glaubenssätzen unserer Eltern befreien
Unsere Eltern haben uns viel mitgegeben. Auch schädliche Glaubenssätze, die uns dazu bringen, über unsere Grenzen zu gehen. Wo genau kommen sie her – und wie werden wir sie wieder los?
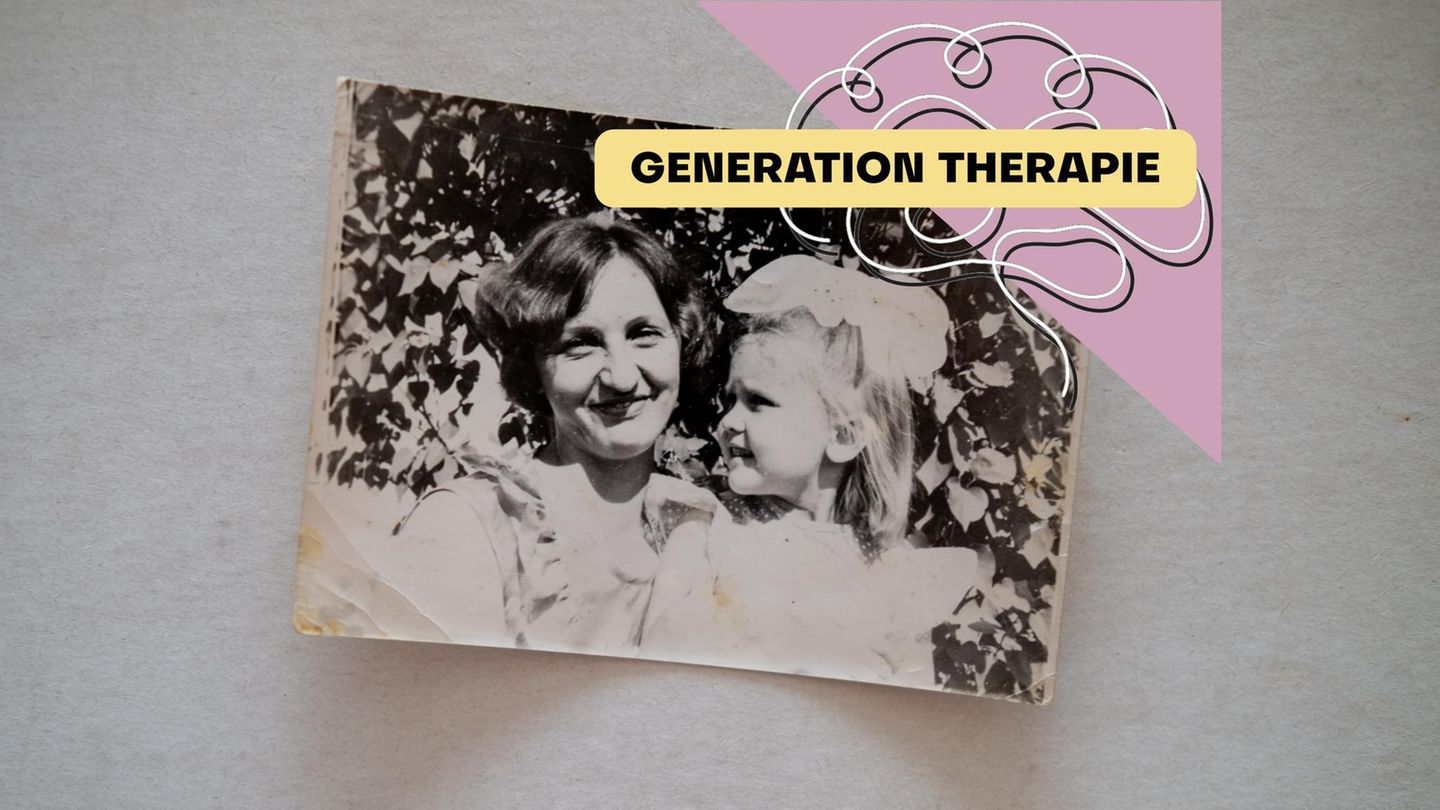
Unsere Eltern haben uns viel mitgegeben. Auch schädliche Glaubenssätze, die uns dazu bringen, über unsere Grenzen zu gehen. Wo genau kommen sie her – und wie werden wir sie wieder los?
Als Maren* 1982 zum ersten Mal mit Liebeskummer nach Hause kam, hatte ihre Mutter kaum tröstende Worte für sie übrig, außer der Floskel: "Andere Eltern haben auch schöne Söhne." Als sie 1986 ihre Ausbildung abbrechen wollte, bekam sie zu hören: „Stell dich nicht so an“ – man müsse auch mal die Zähne zusammenbeißen, daran sei noch keiner gestorben. Als ihr Bruder wegen eines Bandscheibenvorfalls im Job ausfiel, waren die Eltern entsetzt, nicht wegen seiner Schmerzen, sondern darüber, was sein Arbeitgeber denken würde, wenn er so lange fehlte. Wärme, Nähe, Zugewandtheit? Fehlanzeige. "Wir sind emotional am langen Arm verhungert", sagt Maren, 58, heute. Die Psychologin Bettina Lamberti beschreibt die Familien der Babyboomer als "Orte der Ungeborgenheit und des Unverständnisses".
Wie uns Gefühlserbschaften beeinflussen
Emotionale Taubheit, Härte gegen sich selbst, eine gewisse Distanziertheit: Das war häufig der familiäre Nährboden der in den Fünfziger- und Sechzigerjahren geborenen Kinder. Die Prägungen unserer Eltern, die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, haben auch unsere Lebenswelten geformt. Expert:innen sprechen von "Gefühlserbschaften", wenn die Erfahrungen und Überzeugungen der Vorfahren in uns fortwirken. Etwa in Form von inneren Antreibern, die uns dazu bringen, die Zähne zusammenzubeißen und über unsere Grenzen zu gehen, bis wir nicht mehr können. Nicht wenige brennen aus, weil sie nicht lernen durften, rechtzeitig Nein zu sagen: Laut AOK ist die Zahl der Burnout-Fälle im letzten Jahrzehnt um mehr als 70 Prozent angestiegen.
Dabei könnte die heutige Babyboomer- und Erbengeneration eigentlich entspannt sein. Anders als unsere Eltern, die als Kinder existenziellen Bedrohungen durch Gewalt, Zerstörung, Vertreibung oder Hunger ausgesetzt waren, leben wir in Frieden und Wohlstand. Warum genau ist der innere Drang, durchzuhalten und es allen recht zu machen, dann trotzdem häufig so stark, obwohl wir spüren, dass wir uns damit schaden?
Unsere Eltern waren erst Überlebende, dann Funktionierende
Die Gründe können – unter anderem – in den vererbten Kriegstraumata unserer Eltern liegen. Zudem waren sie in der Zeit des Nationalsozialismus einer "Kultur der Abhärtung" ausgesetzt, die es ihnen verbot, Gefühle wie Angst oder Schmerz zu zeigen. Und nach dem Krieg ging es darum, das Land wieder aufzubauen –"da war es sinnvoll zu sagen: Wir müssen erst mal ackern, die Trümmer wegräumen nach dem Krieg, wir müssen Wohlstand aufbauen, und wir sehen ja, dass es funktioniert, zu ackern", sagt Matthias Lohre, Autor des Buches "Das Erbe der Kriegsenkel. Was das Schweigen der Eltern mit uns macht". Nicht Trauern und Mitgefühl wurden belohnt, sondern einmal mehr Zähigkeit und Selbstdisziplin.
Die Historikerin Miriam Gebhardt macht weniger den Krieg für die Prägungen unserer Eltern verantwortlich als die damals dominante Ideologie der "Lebensbemeisterung", in deren Geiste sie selbst erzogen worden sind. Dieses Erziehungsmuster hatte seine Wurzeln im 19. Jahrhundert und unterstellte, "dass der Mensch auf der Welt ist, um einen Lebenskampf zu bestehen und sich in einer feindlichen Umwelt durchzusetzen. Er musste das Leben als antagonistisch begreifen und sich durch Härte, Abhärtung und Selbstgenügsamkeit behaupten".
Man glaubte, dass ein Baby von der Mutter getrennt werden sollte
Dieses Menschenbild lag auch dem Erziehungsratgeber "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" der Nationalsozialistin Johanna Haarer zugrunde, der sich ab 1934 ein Monopol erobert hatte. Es propagierte, dass Mutter und Kind von Anfang an getrennt werden sollten.
"Man nahm an, dass ein neugeborenes Kind ein nicht fühlendes, quasi in sich abgeschlossenes Wesen ist, das man am besten sich selbst überlässt" (Miriam Gebhardt).
Die Entwicklungspsychologin Hildegard Hetzer habe sogar minutengenau berechnet, wieviel man sich mit seinem Nachwuchs beschäftigen sollte: Im ersten Lebensjahr elf Minuten am Tag. "Viele praktische Ratschläge führten dazu, dass ein Kind frühzeitig lernte, Emotionen und Schmerz zu unterdrücken", so Gebhardt. Und diese aus heutiger Sicht grausamen Vorstellungen haben nicht nur unsere Eltern geprägt – sie haben sich in abgeschwächter Form bis in die Siebzigerjahre gehalten, als die Babyboomer bereits geboren waren. Haarers Buch wurde bis 1987 verlegt.
Die Ideale der Abhärtung und emotionalen Tapferkeit seien unseren Eltern – bei allem Leid, die sie verursachten –, aber auch zugute gekommen, meint Gebhardt. "Asketisch, genügsam und hart mit sich selbst umgehen zu können, war während des Kriegs und im extrem harten Nachkriegswinter 46/47 sicherlich hilfreich." Unsere Eltern erlebten also früh, dass diese Eigenschaften nützlich sein können. Ebenso wie ihnen das "Wirtschaftswunder" gezeigt hat, dass sich Disziplin und Durchhaltevermögen auszahlen. So kommt es, dass sie uns diese Werte bewusst oder unbewusst mit auf den Weg gegeben haben. Doch wie werden wir diese inneren Überzeugungen unserer Eltern wieder los, wenn sie uns heute schaden?
Glaubenssätze waren einmal Überlebensstrategien
Das Wichtigste sei, zu akzeptieren, dass "diese inneren Überzeugungen zu uns gehören und verstanden werden wollen, bevor wir sie im Alltag freundlich in die Schranken weisen können", sagt die Hamburger Familientherapeutin Felicitas Römer. Erst wenn wir erkennen, welche existenziellen Ängste sich dahinter verbergen, können wir ein tieferes Verständnis für uns selbst entwickeln und uns annehmen. Römer bestätigt:
"Dieser wahnsinnige innere Antrieb, den viele Babyboomer haben, kann eine verinnerlichte Angst vor Armut, Verlust und Not sein, die in den Kriegserlebnissen der Eltern ihre Wurzeln hat“.
Häufig gehe es aber sogar um die zutiefst existenzielle Angst, ausgestoßen zu werden, die uns daran hindert, zur Chefin oder zum Partner Nein zu sagen. Diese Furcht stecke auch hinter der berühmt-berüchtigten Frage unserer Eltern: "Was denken die Nachbarn?" Womit sich ein Kreis schließt: Das lebensbedrohliche Gefühl des Ausgestoßen- und Verlassenseins haben viele unserer Mütter und Väter als hilflose Säuglinge und im Krieg erlebt – und wir als ihre Nachkommen, die im langen Schatten des Nationalsozialismus aufgewachsen sind, teilweise ebenfalls. Maren etwa wurde als Baby allein zuhause gelassen, wenn die Mutter den älteren Bruder vom Kindergarten abholte. Ein Baby schreien zu lassen, ein Kind zu ignorieren oder gar zu schlagen, waren bis in die Siebziger akzeptierte Erziehungsmethoden.
So werden wir vererbte Überzeugungen los
Erst wer verstanden hat, dass verinnerlichte Glaubenssätze wie "Stell dich nicht so an", oder "Reiß dich zusammen" einmal Überlebensstrategien waren, bekomme "ein vollkommen anderes Gefühl für sich selbst, als wenn er bloß denkt, ich bin so blöd, ich lade mir immer nur Arbeit auf“, sagt Römer. Dieser Lernprozess, für den es nie zu spät sei, bringe irgendwann Ruhe ins innere System. "Vieles schachtelt sich neu in dem Moment, in dem ich verstanden habe: Warum arbeite ich eigentlich mehr als mir guttut? Wo kommt das her, wo gehörte das ursprünglich mal hin? An welchen Stellen in meinem Leben hat das vielleicht auch eine gute Funktion? Brauche ich manchmal sogar so einen inneren Antreiber? Was bekomme ich für meine Leistungen – Anerkennung, Bestätigung, einen besseren Selbstwert? Und was passiert, wenn ich das aufgebe?" Wenn man diese Fragen beantwortet hat, ist man seinen inneren Anteilen nicht länger ausgeliefert, sondern kann mit Abstand darauf schauen und im Alltag geschmeidiger mit ihnen umgehen.
Manchmal reiche es aber schon aus, den inneren Stimmen aufmerksam zuzuhören. Sagen sie "Ich muss" oder sagen sie "Du musst"? Im ersten Fall sind die Antreiber und Glaubenssätze im System verankert, dann bleibt nichts anderes übrig, als gut mit ihnen leben zu lernen. Im zweiten Fall haben wir sie nicht internalisiert und es ist leichter, sie dahin zurückzugeben, wo sie herkommen. Etwa so: "Nein, Mama, du sagst mir jetzt nicht, was ich machen soll" oder "Papa, lass mich jetzt bitte in Ruhe!".
*Namen sind der Redaktion bekannt