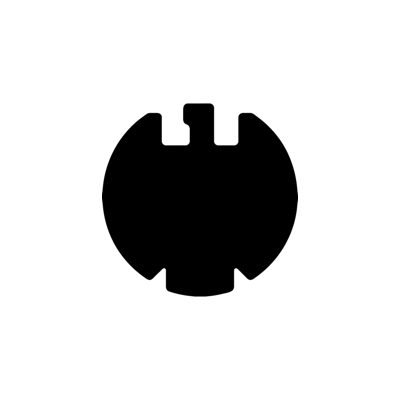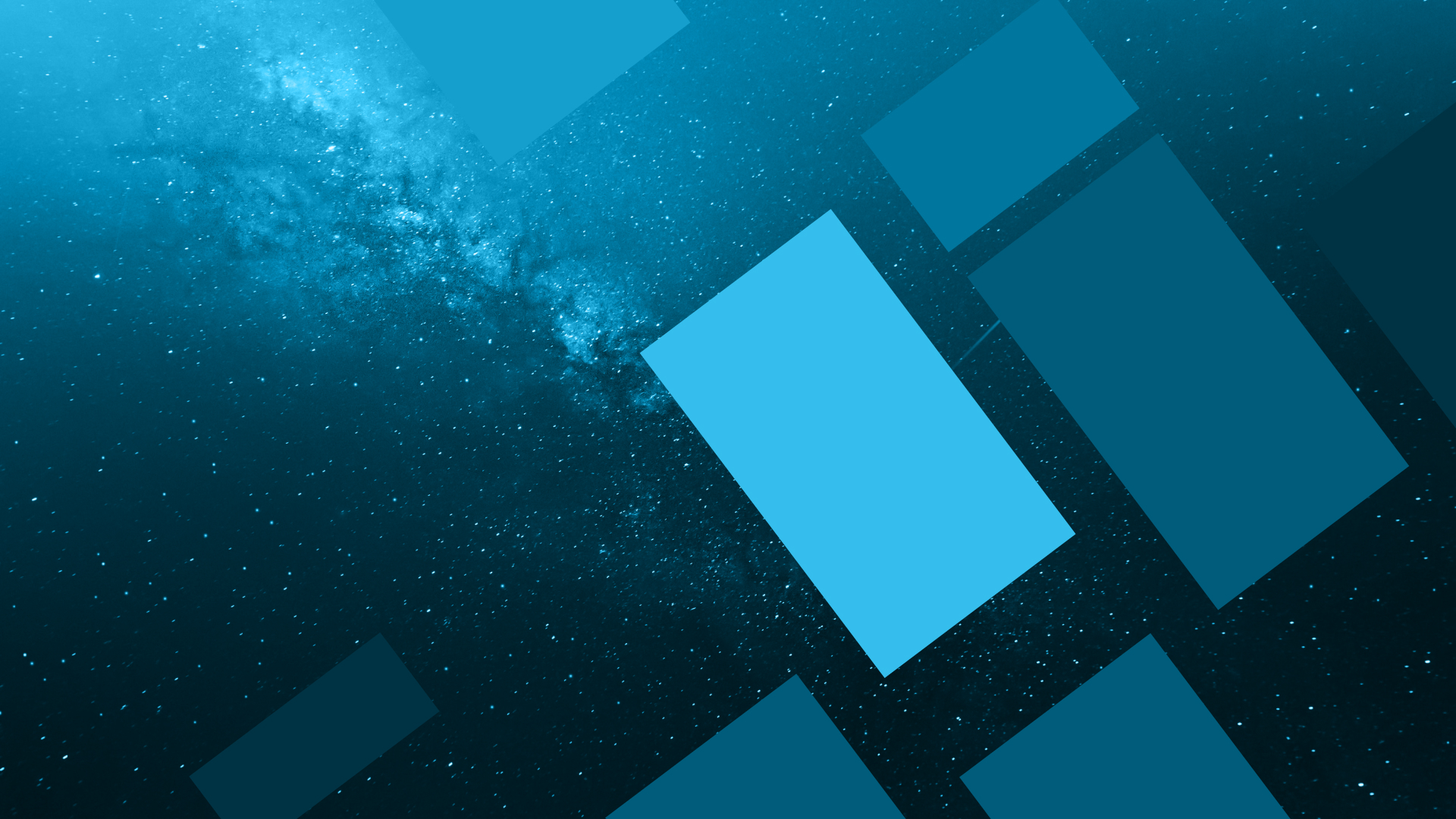Konklave: Eingeflüstert vom Heiligen Geist? Was die Spieltheorie über die Papstwahl verrät
Im Verlauf der Jahrhunderte musste die Kirche mühsam lernen, worauf es bei der Wahl eines Pontifex ankommt. Die heutigen Regeln beeinflussen, wer dabei eine Chance hat und wer nicht

Im Verlauf der Jahrhunderte musste die Kirche mühsam lernen, worauf es bei der Wahl eines Pontifex ankommt. Die heutigen Regeln beeinflussen, wer dabei eine Chance hat und wer nicht
Nichts darf nach außen dringen, wenn in den kommenden Tagen 133 Kardinäle den nächsten Papst wählen. Entsprechend sprießen die Spekulationen, was genau in der Sixtinischen Kapelle passiert, auf welchem Weg die Kardinäle ihr nächstes Oberhaupt bestimmen.
Einige Anhaltspunkte liefert die Wissenschaft, genauer die Spieltheorie. Sie untersucht, wie Gruppen zu einer Entscheidung kommen. Die Papstwahl gilt als ein Paradebeispiel: "Das Konklave ist ein interessanter Fall von qualifiziertem Mehrheitsbeschluss mit vielen Teilnehmern und ohne formale Abstimmungsblöcke", schreiben die Ökonomen László Á. Kóczy und Balázs Sziklai.
Gewalt und Spaltung nach einer Papstwahl
Auf Außenstehende wirken die Rituale rund um das Konklave ewig und unabänderlich. Und doch sind dessen Regeln das Ergebnis einer allmählichen Evolution, die bis in die Neuzeit reicht. Die Politikwissenschaftler Josep M. Colomer und Iain McLean diskutieren in einer Studie, wie die Kirche über Jahrhunderte aus misslungenen Papstwahlen gelernt hat. Wie sie verschiedene Ansätze erprobte und letztlich zu verbindlichen Regeln fand. Aus Sicht der Spieltheorie gelten die durchaus als effizient: Sie sind geeignet, schnell einen weithin akzeptierten neuen Papst hervorzubringen.

© Eric Vandeville / abacapress
Gelernt hat die Kirche dabei auf schmerzhafte Weise, denn jede sich hinziehende Papstwahl stürzte sie ebenso in eine Krise wie jede später angefochtene. Einige Male endete die Suche nach einem neuen Pontifex sogar mit Gewalt. Und nicht selten führte die Papstwahl zu einer Spaltung der Kirche, einem Schisma, wenn verfeindete Lager unterschiedliche Oberhäupter ausriefen. Dazu trug bei, dass frühere Wahlregeln Pattsituationen oder widersprüchliche Ergebnisse zuließen, wodurch sich interne Spannungen in äußeren Konflikten entluden.
Die Zeit nach dem Tod eines Papstes, die Sedisvakanz, ist eine Krisenzeit für die katholische Kirche. Anders als bei einer Erbmonarchie, bei der mit dem Tod des alten Herrschers schon sein Nachfolger feststeht, und im Gegensatz zu Demokratien, wo die vorherige Regierung erst aus dem Amt scheidet, wenn die neue eingesetzt wird, bleibt die katholische Kirche nach dem Tod des Pontifex ohne Oberhaupt und das für ungewisse Zeit. So lange fehlt den Gläubigen das Zentrum, um das sie sich scharen und auf das sie sich trotz aller Differenzen einigen können. Einflussreiche Gruppen drohen dann ihre Macht auszubauen. Entsprechend wichtig ist es, dass die Kirche schnell einen neuen Papst findet.
Wo so viel auf dem Spiel steht, erstaunt es, wie unspektakulär Papstwahlen in den vergangenen 500 Jahren abliefen. Schon so lange gab es keinen nennenswerten Gegenpapst mehr, trat kein Schisma nach einer Wahl auf. Und während im Mittelalter die Konklaven zuweilen Monate, gar Jahre dauerten, findet die Kirche heutzutage schnell ein neues Oberhaupt, seit 1903 im Schnitt nach drei Tagen. Dies ist umso beeindruckender, da sich hier eine weltumspannende Institution mit mehr als einer Milliarde Mitgliedern auf eine Person einigen soll, die fortan wie ein Monarch regiert. Kein Vergleich zu den monatelangen Präsidentschaftsrennen in den USA oder wochenlangen Koalitionsverhandlungen in Deutschland.
Isolation fördert den Pragmatismus
Dazu tragen entscheidend die Regeln rund um die Papstwahl bei. Wer wahlberechtigt ist und wie die Wahl verläuft, hat die Kirche über die Jahrhunderte immer klarer definiert. Zur Geschwindigkeit trägt vor allem das Konklave selbst bei: die Isolation der Kardinäle. Sie werden "cum clave", "mit dem Schlüssel", so lange weggeschlossen, bis sie sich auf einen neuen Pontifex geeinigt haben. Dieses Vorgehen entstand im 13. Jahrhundert, als zuvor die Dauer der Papstwahlen ausgeufert waren.
Um den Druck zu erhöhen, wurde im Konklave sogar die Nahrung rationiert und die Kardinäle schliefen auf provisorischen Nachtlagern. Beides gibt es heute zwar nicht mehr, doch das Eingeschlossensein fördert weiterhin den Pragmatismus. Hält ein Kardinal hartnäckig an seinem Wunschkandidaten fest, schadet er sich damit selbst. Das steigert die Kompromissbereitschaft.

© ullstein bild
Trotzdem muss die durchschnittliche Kürze moderner Konklaven überraschen, denn die Hürden zur Wahl eines Papstes sind hoch. Statt einer einfachen ist eine "qualifizierte" Mehrheit nötig: Der Kandidat muss zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen. Durch diese Regel ist eine breite Unterstützung des neuen Papstes gewährleistet und damit ein stabiler Transfer der Macht. Die Einführung der Zweidrittelmehrheit in der Neuzeit in Kombination mit dem Konklave schuf laut Iain McLean ein optimales Verhältnis zwischen Stabilität und Entscheidungsfreude.
Wie es anders geht, zeigt ein Blick auf alternative Wahlsysteme. In vielen Demokratien ist eine absolute Mehrheit von 50 Prozent üblich. Dies kann eine Spaltung der Wählenden in zwei Gruppen fördern. Wenn einige für eine dritte Gruppe stimmen, bleibt ihre Stimme meist ohne Chance und damit wertlos. Der Druck ist daher hoch, sich einer von zwei Gruppen anzuschließen.
Das kann polarisierende Folgen haben, wie sich zurzeit besonders dramatisch in den USA zeigt. Nur vergleichsweise wenige Stimmen entschieden dort im vergangenen Jahr aus zwei extrem unterschiedlichen Optionen den zukünftigen Kurs des Landes. Die Opposition ging trotz fast gleich großer Stimmenzahl leer aus, sie fühlt sich nicht repräsentiert und zweifelt die Legitimität der unerwünschten Regierung an. Zudem können in solchen Wahlsystemen auch politisch extreme Kandidaten gewinnen: Trump wurde Präsident, obwohl die Hälfte des Landes gegen ihn war.

© abacapress
Bei der Papstwahl hingegen reicht bereits ein Drittel der Wahlmänner, um einen Kandidaten zu blockieren, das gibt polarisierenden Kandidaten wenig Chancen. Die Sorge, dass ein Populist oder ein Erzkonservativer auf den Peterstuhl gelangen könnte, ist daher gering. Ebenso unwahrscheinlich aber auch, dass ein Progressiver sich durchsetzt, der etwa beim Thema Frauenpriesterschaft den bisherigen Standpunkt der Kirche revidieren würde.
Warum Favoriten früh aus dem Rennen sind
Die hohe Hürde könnte auch ein Grund sein, warum nicht immer jene als Papst aus dem Konklave kommen, die "als Papst hineingingen". Solche viel diskutierten "Papabile" mit einer starken Lobby können auch eine ähnlich vehemente Opposition gegen sich aufbringen. Und sie muss nicht sonderlich groß sein, um eine Sperrminorität aufzubringen.
In der Berichterstattung zur Papstwahl entsteht zuweilen der Eindruck, dort stünden sich wie bei den US-Präsidentschaftswahlen zwei Blöcke gegenüber: Traditionalisten und Progressive. Tatsächlich wirkt die Zweidrittelregel einer solch starken Polarisierung entgegen, laut Spieltheorie, sobald der Kreis der Wählenden nicht zu klein und zu homogen ist. Dann ist in der Regel keine Gruppe stark genug, allein den Sieger zu erkoren. Auch, weil es anders als bei der absoluten Mehrheit keinen Druck gibt, sich in großen Blöcken zusammenzuschließen.

© Rodolfo Felici / Ansa
Das Wahlverhalten der Kardinäle lässt sich eher durch eine Vielzahl kleinerer Gruppen beschreiben, die während der Wahlgänge wechselnde Koalitionen bilden. Diese Gruppierungen darf man sich nicht als feste Blöcke vorstellen. Denn zunächst herrscht das Wahlgeheimnis, es gibt also keinen Fraktionszwang. Zudem sind alle Kardinäle ähnlich gut informiert und daher unabhängiger von einflussreichen Personen oder Parteien. Anders als etwa bei einer Bundestagswahl, bei der einige Menschen ihnen wenig bekannte Direktkandidaten wählen, bloß weil sie zur erwünschten Partei gehören. "Im päpstlichen Konklave gibt es nur wenige Kardinäle mit einer klaren politischen Präferenz. Möglicherweise existieren einige Wahlblöcke, aber keine formellen Parteien, die Sanktionen gegen aufmüpfige Wähler verhängen könnten. Kurz gesagt: Jeder Kardinal wählt seine Position unabhängig von den anderen", schreiben Kóczy und Sziklai.
Nicht die Mitte gewinnt
Nun könnte es naheliegen, dass aufgrund der hohen Hürden stets Kandidaten der Mitte gewinnen. Wie in einem Gedankenexperiment, in dem man alle Kardinäle in einer Reihe aufstellt, sortiert von konservativ bis reformorientiert, um dann die mittlere Person zum Favoriten zu küren, den Median, der beide Kräfte ausgleicht.
Doch bei hinreichend vielen Wählenden, und dies ist im Konklave gegeben, gibt es mehr als nur ein wahlentscheidendes Thema. Statt in nur einer Dimension verortet die Spieltheorie die Kardinäle in einem multidimensionalen Interessensraum von wahlentscheidenden Kriterien. "Konservativ/reformorientiert" ist dann nur eines davon (das sich noch in mehrere Unterkategorien unterteilen lässt). Für manche Kardinäle ist daneben wichtig, ob ein Kandidat eher für eine zentral oder dezentral organisierte Kirche steht, ob der Kandidat der römischen Kurie eher nahe oder fern steht, ob der Kandidat eher Typus "Diplomat" oder Typus "Seelsorger" ist, woher er kommt, welches Alter er hat und ob er Charisma besitzt, um als neuer Pontifex die Menschen für die Kirche zu gewinnen. Die Kardinäle bilden in diesem mehrdimensionalen Interessensraum automatisch Cluster. Kandidaten mit besonders guten Wahlchancen sind dann nicht jene, die möglichst mittig platziert sind, sondern die, die durch ihren Mix an Eigenschaften die Zustimmung ausreichend vieler Cluster auf sich vereinen.

© Stefano Costantino / Zuma Press
Dies lässt sich ganz bildlich vorstellen: Verteilen sich viele Menschen in Trauben in einem Saal, ist nicht automatisch die Person genau in der Mitte des Raumes der Mehrheit am nächsten, auch nicht die, die mitten in einer Gruppe steht, sondern die, die zwischen vielen oder zwischen großen Gruppen steht. Dieser Ort muss nicht eindeutig sein, es kann mehrere solcher Positionen geben.
Erst durch den mehrdimensionalen Interessensraum wird erklärbar, warum die Kardinäle 1978 einen Italiener wählten, auf den selbst Liberale ihre Hoffnung setzten, um nach dessen Tod wenige Woche später einen konservativen Polen zum Oberhaupt zu bestimmen.
Je größer die Zahl an Kardinälen und damit die Zersplitterung der Wählergruppen, umso eher passieren laut McLean "Überraschungen": die Wahl von Personen, die zuvor nicht als Favoriten galten.
Der Heilige Geist soll den Ausschlag geben
Bewerbungsreden oder offizielle Debatten gibt es während eines Konklaves nicht. Die Wählenden orientieren sich am Verlauf der Wahlergebnisse und an den Pausengesprächen in kleinen Gruppen. Nach allem, was über Wahlgänge in der Vergangenheit nach außen drang, zeichnen sie sich zuweilen durch große Dynamik aus. Zeigt sich, dass ein Kandidat nicht die nötige Mehrheit erreicht, kann er schon beim nächsten Wahlgang massiv Stimmen verlieren. Die Wähler schwenken dann um, orientieren sich neu. Kandidaten erhalten auf einmal signifikant viele Stimmen, die zuvor kaum eine erhielten. Dies kann zu regelrechten Erdrutschsiegen führen, bei denen Personen, die zu Beginn als Außenseiter erschienen, innerhalb weniger Wahlgänge mit hoher Zustimmung gewinnen.
Dies ist als Bandwagon-Effekt – zu Deutsch Mitläufereffekt – bekannt: Scheint die Kandidatur einer Person Fahrt aufzunehmen, springen Wählende auf den Erfolgszug mit auf – eventuell auch deshalb, weil ihnen über den Überraschungskandidaten nicht genug bekannt ist und sie sich daher der vermeintlich abzeichnenden Mehrheitsmeinung anschließen.
Zudem wünschen sich viele Kardinäle ein starkes Ergebnis für den Gewählten. Es zeugt nicht nur von der Einigkeit der Kirche, es stärkt auch die Autorität des neuen Pontifex. Und solch ein Erdrutschsieg lässt sich als göttlich inspiriert interpretieren. Denn aus Sicht der katholischen Kirche sollte es ohnehin der Heilige Geist sein, der den Kardinälen die richtige Wahl einflüstert. Und dem Willen des Herrn will ein Kardinal nicht im Weg stehen.

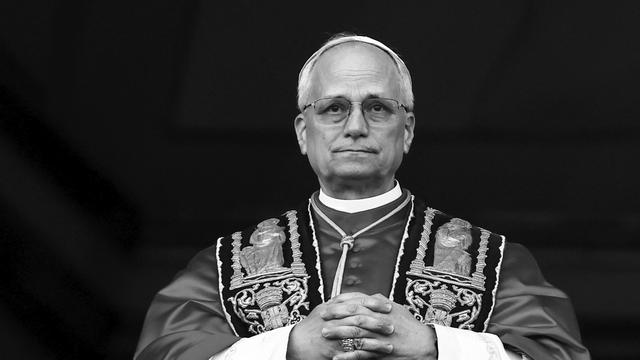















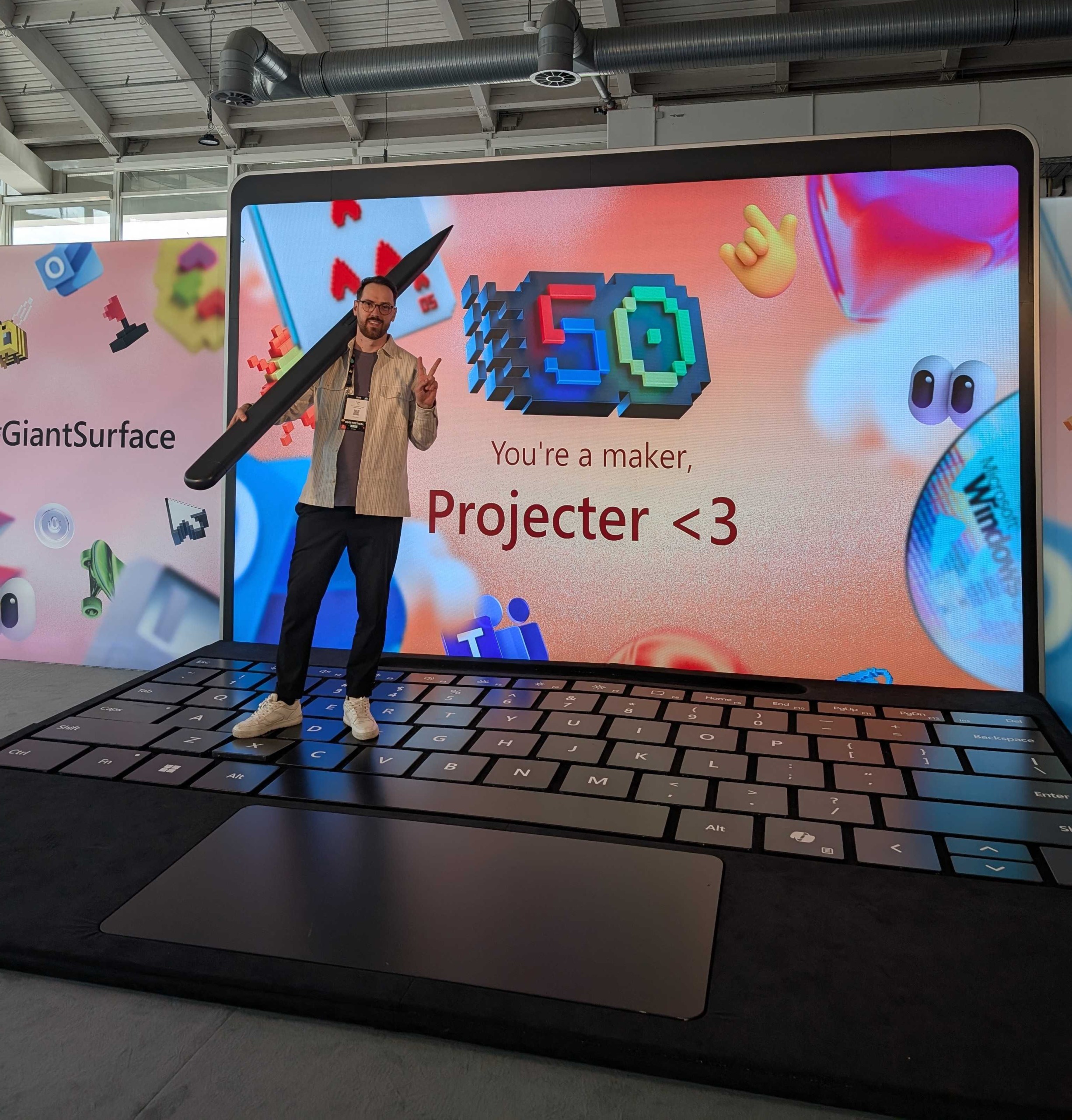



:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/51/c751686510f49bec5115a55ab93b5fee/0124517652v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5d/90/5d905a0b8cc48e8bc465b13c37a07f2e/0124513944v2.jpeg?#)


![Sportförderung, Wirtschaftsförderung oder unnötige öffentliche Ausgaben? [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)






![Deals: Autofahrer aufgepasst - Für ein paar Euro erspart ihr euch, was mich gerade 300€ kostete [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/marderschreck-marderschaden-anti-marder-ultraschall-sensor-autofahren-auto-automobil-versicherung-was-hilft-gegen-marder_6352773.jpg?#)