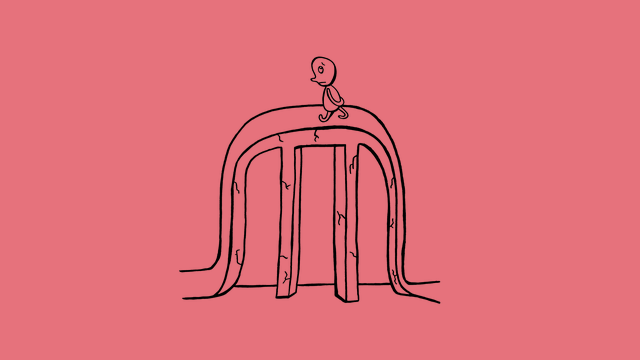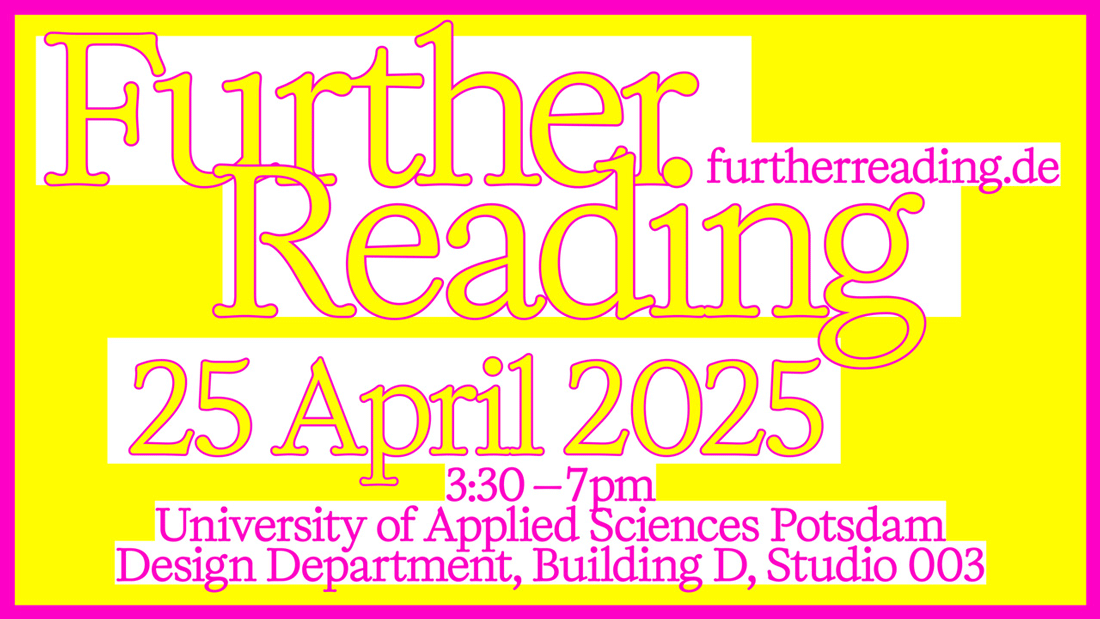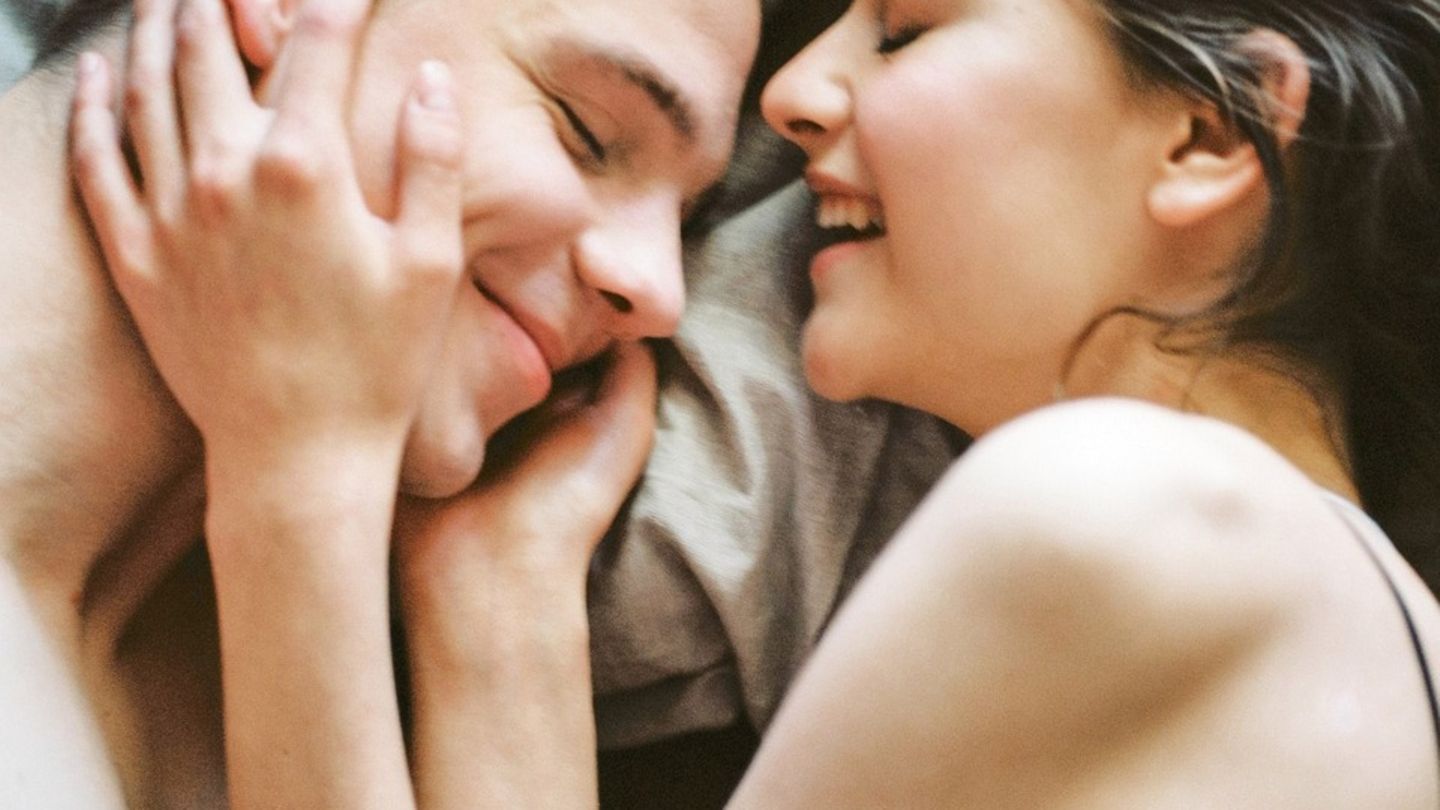Hautbilder: "Tätowierungen waren in der Antike ein Zeichen der Bestrafung"
Eine neue Ausstellung widmet sich Tätowierungen in der Antike. Kuratorin Anne Viola Siebert erklärt, wie Tattoos Menschen brandmarkten – und warum antike Motive heute angesagt sind

Eine neue Ausstellung widmet sich Tätowierungen in der Antike. Kuratorin Anne Viola Siebert erklärt, wie Tattoos Menschen brandmarkten – und warum antike Motive heute angesagt sind
GEO: Frau Dr. Siebert, Sie haben die neue Ausstellung im Museum August Kestner in Hannover über Tätowierungen in der Antike kuratiert. Was unterscheidet moderne Tattoos von jenen im antiken Griechenland, Rom und Ägypten?
Dr. Anne Viola Siebert: In antiken Kulturen waren Tätowierungen ein Zeichen der Ausgrenzung, der Bestrafung und Stigmatisierung. Wer in Griechenland, Rom und Ägypten ein Tattoo trug, hat dieses nicht freiwillig erhalten. Tätowierungen fanden stets unter Fremdzwang statt und beraubten die betroffene Person ihrer – heute würde man sagen – bürgerlichen Existenz. In der Gegenwart dagegen entscheiden sich Menschen freiwillig, Tattoos zu tragen und bestimmen auch das Motiv. Die Hautbilder sind Ausdruck von Individualität.
Das heißt, bei Tätowierten in der Antike handelte sich um Sklaven oder Kriegsgefangene?

© Detlef Juerges / Museum August Kestner
Oder um Verbrecher. Die Griechen nutzten die Zuschreibung "tätowiert" auch, um sich von Bevölkerungsgruppen abzugrenzen, die sie als "Barbaren" betrachteten. So bezeichneten sie die Thraker, die im nördlichen Schwarzmeergebiet lebten, als "die Tätowierten", wie wir bei Herodot nachlesen können. Tatsächlich trugen vor allem Personen der thrakischen Oberschicht Tätowierungen. Für die Griechen waren Tattoos also ein Zeichen der Nicht-Griechen.
Wie kann man sich die Tätowierungen zur Bestrafung und Ausgrenzung vorstellen und wo wurden sie am Körper vorgenommen?
Es handelte sich z.B. um geometrische Zeichen wie Striche oder Dreiecke. Aber auch andere Darstellungen sind bekannt. Erhalten ist zum Beispiel ein römisches Gefäß, auf dem ein Sklave mit einer Tätowierung mitten auf der Stirn dargestellt ist – einem Efeublatt.
Aber das ist doch ein florales Motiv.
Dieses Blatt ist eine Ansammlung von Strichen und Punkten, mitnichten also ein dekoratives Element. Wer so ein Tattoo in sein Gesicht eingeritzt bekam, der wurde von allen Personen sofort als Unfreier wahrgenommen, als Außenseiter. Er hatte niemals die Chance, unerkannt davonzukommen, sein Leben lang.
Die moderne Tätowiermaschine wurde im späten 19. Jahrhundert erfunden. Wie gingen die Tätowierer in der Antike vor?
Sie verletzten die Haut des Betroffenen mit Punktierungen oder Ritzungen, und in diese Wunde wurde Farbe – etwa Ruß – eingearbeitet und zum Schluss abgewischt.
Könnte es nicht auch figürliche Tattoos gegeben haben, die als Körperschmuck getragen wurden?
Hier ist Überlieferungslage unterschiedlich. Aus Ägypten kennen wir sehr wohl figürliche Tattoos auf erhaltenen Mumien oder zu sehen beispielsweise auf einer Fayenceschale. Hierauf ist eine kniende Frau dargestellt, auf deren Oberschenkel der Gott Bes eintätowiert ist. Dafür kennen wir aus dem griechischen Bereich einen Text, der ausführlich mythologische Motive beschreibt, die einer Person als Strafmaßnahme beigebracht werden. Tätowierungen in der Antike hatten überhaupt nichts mit einem Schönheitsideal zu tun.
Im Vorfeld der Ausstellung hatte das Museum August Kestner in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, Tätowierte mit antiken Bildmotiven sollten Fotos davon bei Ihnen einreichen. Sind Hautbilder mit antiken Darstellungen heute überhaupt populär?
Absolut! Das ist ja das Spannende: Als Archäologinnen und Archäologen erkennen wir bei tätowierten Menschen immer wieder Motive, die wir genau identifizieren können – und zwar als antik. Und uns haben verschiedenste solcher Motive erreicht: das Kolosseum, Kaiserporträts, Götterdarstellungen, Amphoren, figürliche Darstellungen, die ganz offensichtlich griechischen Statuen nachempfunden sind.
Lassen Sie mich raten: Es sind Geschichtsfans, die sich antike Motive stechen lassen.
Ein junger Mann hat uns sein Tattoomotiv geschickt, das vier unterschiedliche römische Gefäßtypen zeigt. Offensichtlich handelt es sich um einen Menschen, den die römische Wirtschaftsgeschichte besonders begeistert. Gleichzeitig sollen, so hat er uns mitgeteilt, diese Amphoren seine engsten Kommilitonen aus der Studienzeit symbolisieren. Darauf muss man erst mal kommen. Solche Geschichtsfans gibt es, allerdings sind sie die Ausnahme. Ein anderer Mann hat sich eine Darstellung des griechischen Heilgottes Asklepios stechen lassen – und zwar, weil er Arzt ist und ihm dieses Motiv passend für sich selbst erschien. Ein weiteres beliebtes Tattoomotiv ist die Medusa: Sie ist heute vor allem ein Symbol von Opfern sexualisierter Gewalt und steht für weibliche Kraft und Macht. Die meisten Menschen aber lassen sich antike Motive schlicht deshalb stechen, weil sie sie schön und dekorativ finden.
Heißt das, die Antike ist gerade angesagt?
Mehr noch. Die griechisch-römische Mythologie bietet einen großen Fundus an Figuren und daraus abgeleitet dekorativen Motiven mit einer, sagen wir, überzeitlichen Komponente. Ganz offensichtlich besitzt die Antike eine Relevanz für moderne angewandte Kunst wie das Tätowieren, und sie ist für viele Menschen ein Identifikationsfaktor.

















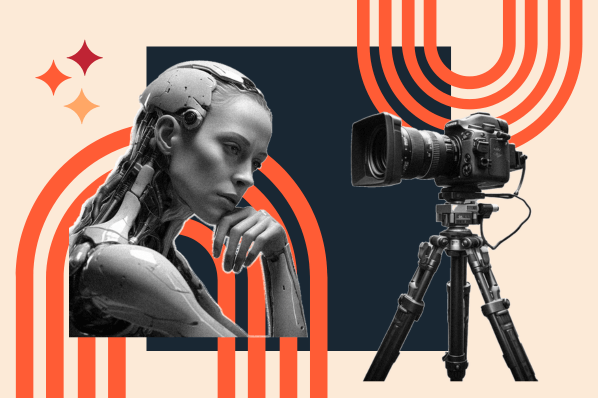
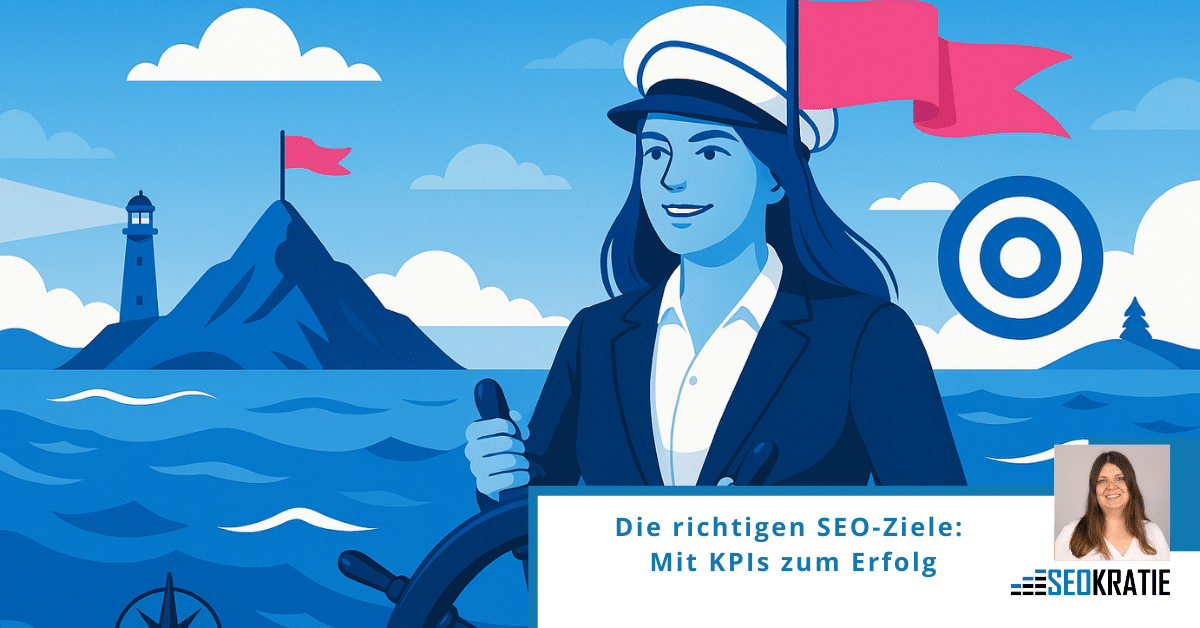


:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/4d/1d4d18230dd6ea00a5b56151d22e7c09/0124273433v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/53/1c/531ca4e7248c6b0ca27bc0841e01b04e/0123928600v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/4d/7b4db513dbf3dffae788c10172bf461a/0123980029v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/48/8a/488a09be8cd964e15d30843bc249f395/0124273194v2.jpeg?#)