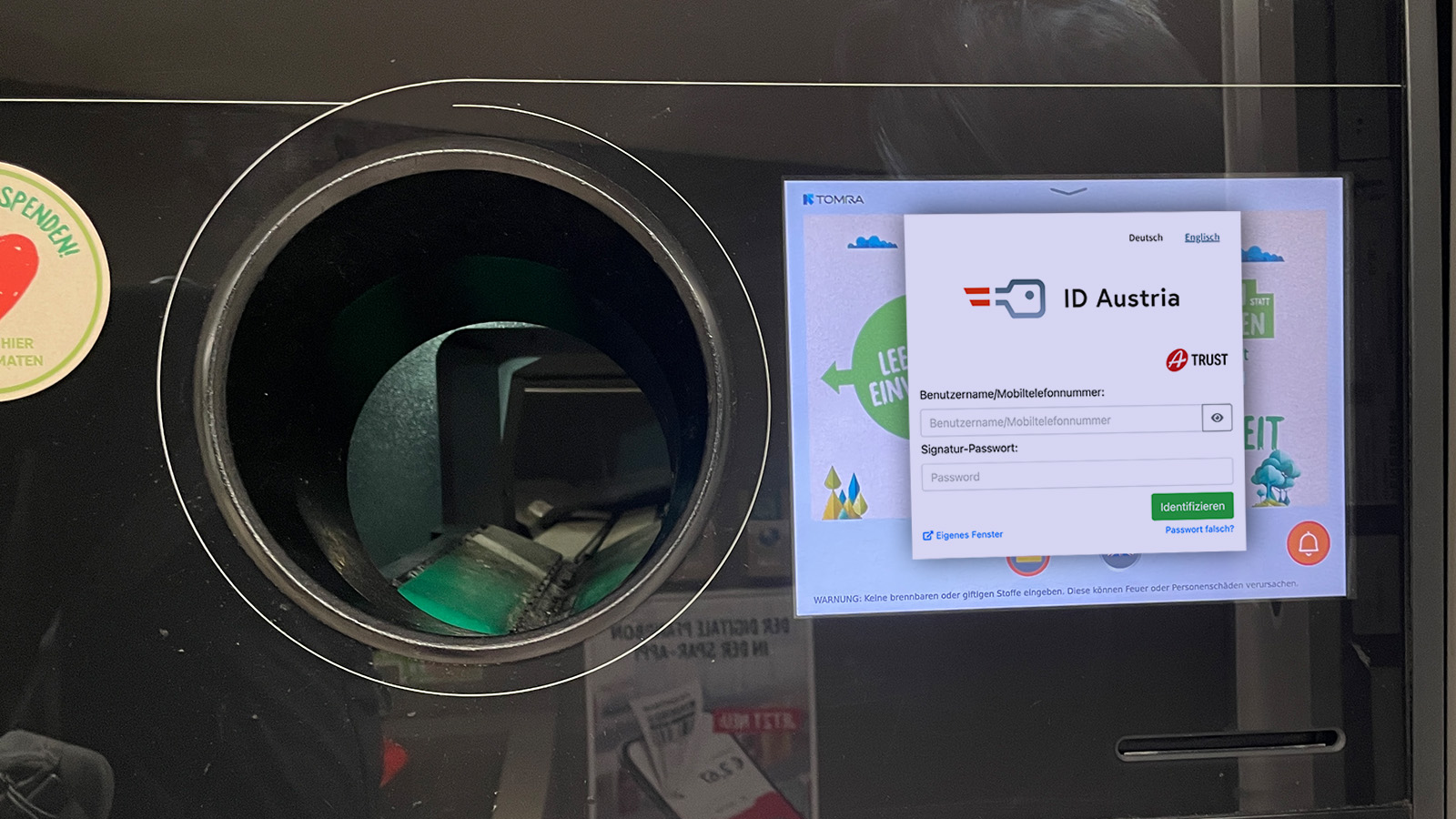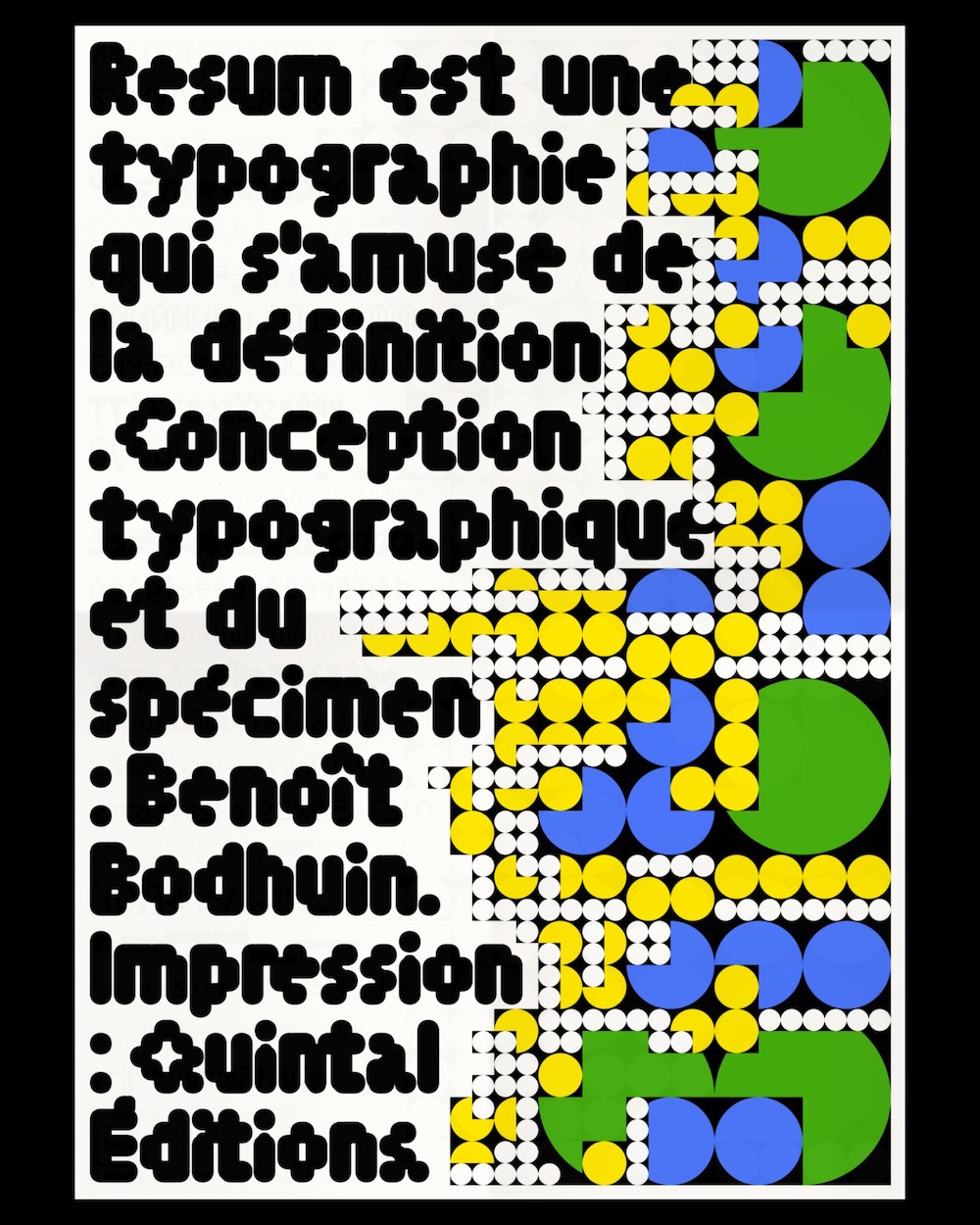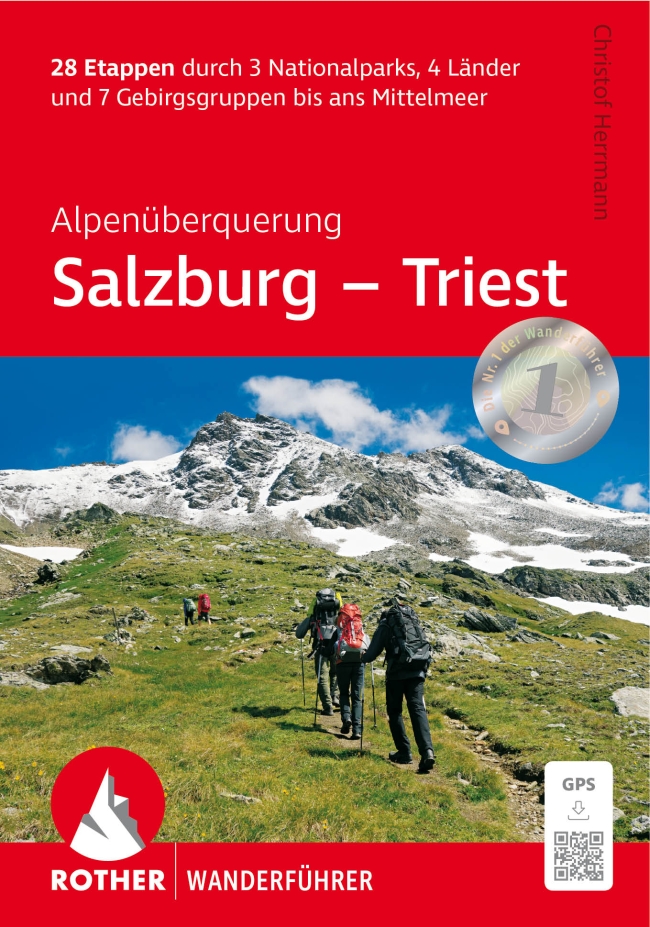Echolot: Sicher durch den Signalsalat: Wie Fledermäuse Crashs vermeiden
Jeden Abend flattern Fledermäuse zu Tausenden aus ihren Höhlen. Echolot weist ihnen den Weg. Wieso sie trotz Schallwellen-Wirrwarr nicht zusammenstoßen, erklärt eine neue Studie

Jeden Abend flattern Fledermäuse zu Tausenden aus ihren Höhlen. Echolot weist ihnen den Weg. Wieso sie trotz Schallwellen-Wirrwarr nicht zusammenstoßen, erklärt eine neue Studie
Wer jemals eine Cocktail-Party in einem hallenden Raum besucht hat, kennt den Effekt: Alle schnattern durcheinander, jeder versucht, den Lärm zu übertönen. Die Stimmen verschmelzen zu einer dröhnenden Kakophonie. Keiner versteht mehr irgendetwas, anstelle anregender Unterhaltungen bringt der Abend nur Kopfschmerzen.
Fledermäuse besuchen keine Soirées. Dennoch ist der Kakophonie-Effekt für sie höchst relevant, denn sie orientieren sich mit Hilfe von Schallwellen. Was den Menschen ihr Sehsinn, ist den nachtaktiven Tieren ihr Echolot. Sie stoßen Rufe im Ultraschallbereich aus und ermitteln aus der Laufzeit des zurückgeworfenen Schalls, wie weit ein Baum, ein Beutetier oder ein Artgenosse entfernt sind. Anders als bei Vögeln spielt ihr Sehsinn in der Regel nur eine untergeordnete Rolle.

© Noam Cvikel
Was geschieht nun, wenn tausende Fledermäuse abends zeitgleich aus ihrer Schlafhöhle flattern, auf der Suche nach Nahrung? Die Schallwellen ihrer Rufe müssten sich übertönen, überlagern, auslöschen – und zwar so sehr, dass die Fledermäuse im Signalsalat akustisch erblinden. Als "Cocktailparty-Albtraum" bezeichnen Fledermaus-Forschende diesen Effekt augenzwinkernd. Zu erwarten wäre, dass die Tiere im allgemeinen Geflatter und Geschnatter andauernd zusammenstoßen.
Doch in der Realität sind Kollisionen so selten, dass es "beinahe aufregend" sei, Zeugin eines Zusammenstoßes zu werden, sagt Aya Goldshtein vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Zusammen mit Forschenden der Universitäten in Tel Aviv, Konstanz und Jerusalem untersuchte sie, wie die Tiere Signalstörungen vermeiden. Dazu stattete das Team Mausschwanz-Fledermäuse im israelischen Hula-Tal mit Trackern und winzigen Ultraschall-Mikrofonen aus und schickte sie ins Getümmel. Die Ergebnisse flossen auch in ein Computermodell ein, das die Sinneswahrnehmungen der Fledermäuse und ihre resultierenden Bewegungen simulierte.
Am brenzligsten war die Situation beim Verlassen der Höhle. Durchschnittlich passierten 25 Fledermäuse pro Sekunde den Ausgang. An diesem Engpass wurden 94 Prozent aller Echos gestört. Doch die Lage besserte sich innerhalb von Sekunden. Dazu entfernten sich die Fledermäuse zügig vom Epizentrum des Lärms. Sie vergrößerten den Abstand zueinander, ohne jedoch den Schwarm zu verlassen. Außerdem stießen sie häufigere, kürzere und schwächere Rufe mit höherer Frequenz aus. So gingen durch Jamming, also Störungen durch zu viele Signale ähnlicher Frequenz, zwar viele Informationen über die Umgebung verloren. Aber das wichtigste Hindernis konnten die Fledermäuse besser im Blick behalten: die Artgenossin, die direkt vor ihnen flog. Kommt es im Gedrängel doch mal zum Crash, ist das übrigens nicht so schlimm. Die leichten und wendigen Fledermäuse fangen sich im Flug schnell wieder.
Die Forschenden im Hula-Tal sind nicht die ersten, die dem Cocktailparty-Albtraum auf den Grund gingen. Andere Arbeiten untersuchten beispielsweise das Verhalten kleiner Gruppen von Fledermäusen im Labor oder werteten Aufnahmen von Mikrofonen an Höhleneingängen aus. Die aktuelle Studie habe die Situation jedoch erstmals aus Sicht einer Fledermaus betrachtet, sagt Co-Autor Omer Mazar: "Nur wenn wir uns so gut wie möglich in die Lage eines Tieres versetzen, können wir verstehen, vor welchen Herausforderungen es steht und was es tut, um diese zu lösen."





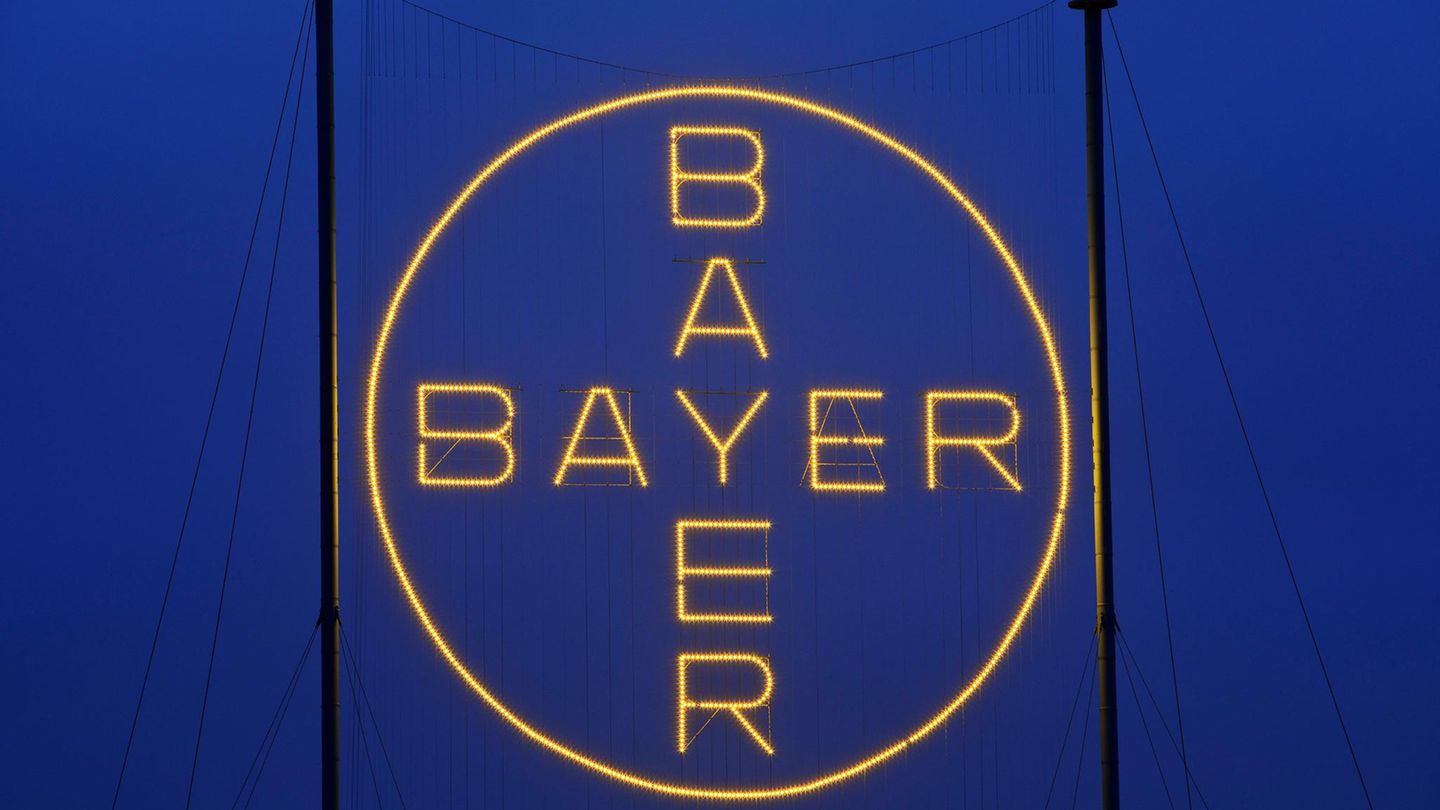









:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/86/9e/869ea5840f55bcccbcd7c66ca9b15dfe/0123861967v1.jpeg?#)


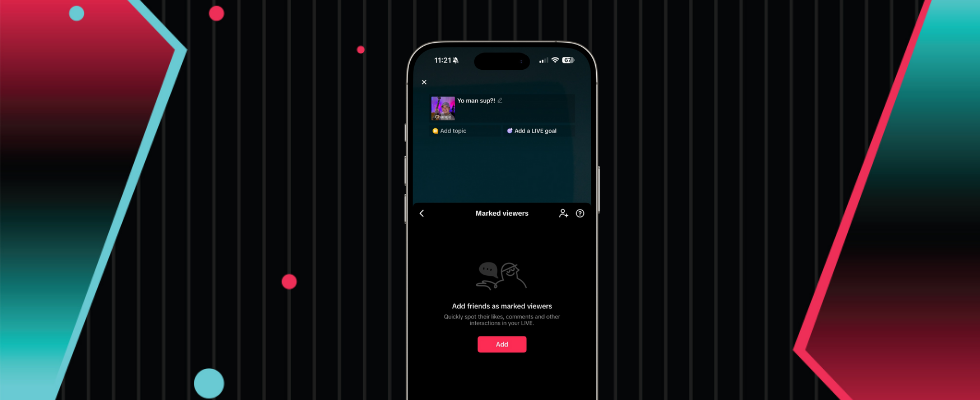




,regionOfInterest=(511,540)&hash=7b4bb77f8895512d1471693e28c1767b7a75e82f953dd016f083b400f0a9c9cb#)
,regionOfInterest=(255,142)&hash=9c0b2b79bf65ed0e46d9f1bea5be17e354069b313e2961e221f8b1270b4025f7#)