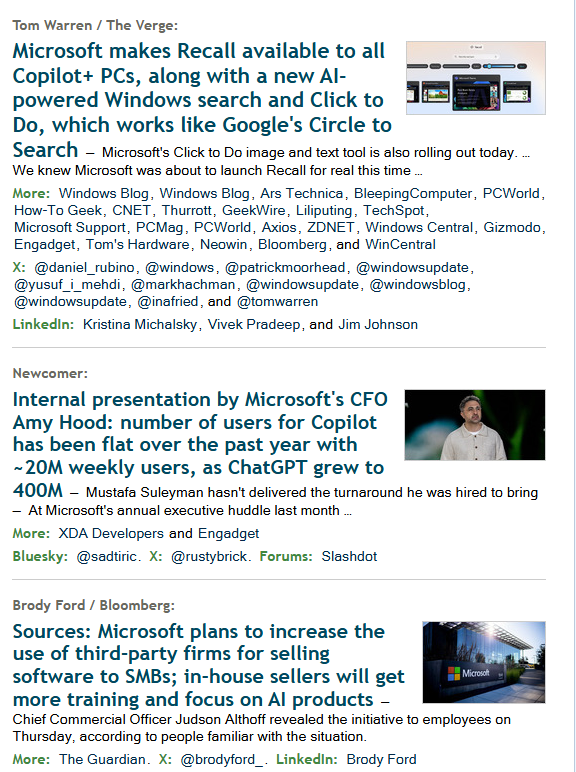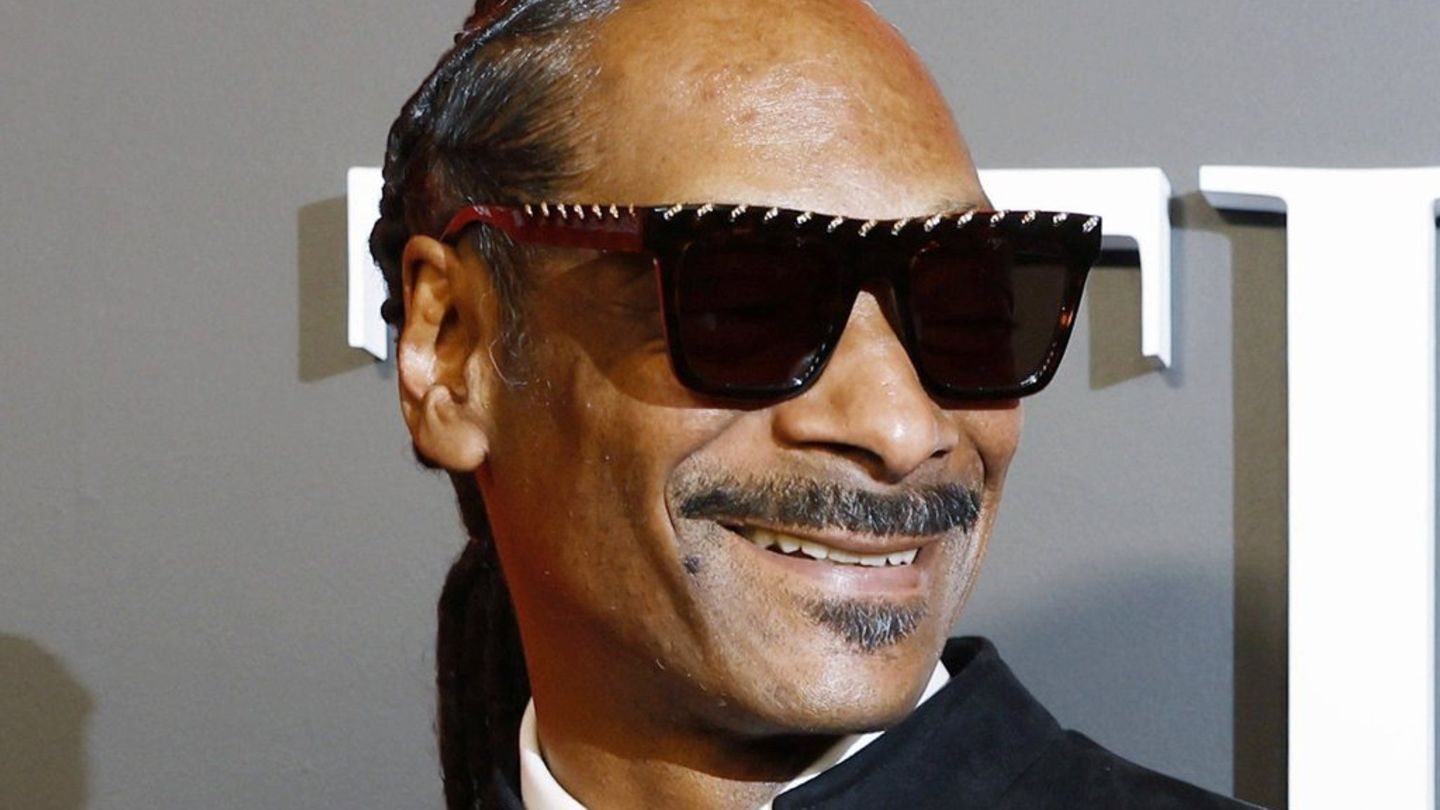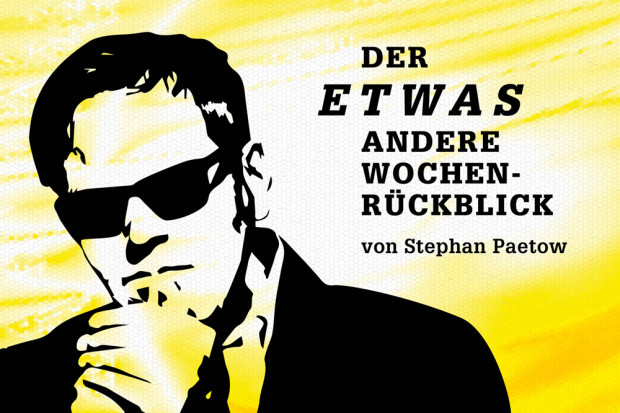Bürger statt Bosse: So stoppst du den Angriff auf die selbstbestimmte Energiewende
Gastbeitrag von Christian Ofenheusle, Sebastian Müller Du hast es vielleicht nicht einmal mitbekommen, aber im Hintergrund passiert eine Entwicklung, die dazu führen könnte, dass die wichtige Energiewende die Macht einiger weniger Konzerne vergrößern könnte – und uns alle behindern, unseren eigenen Strom zu produzieren. Bis zum 10. April kannst du jetzt noch eine Petition unterschreiben, […] The post Bürger statt Bosse: So stoppst du den Angriff auf die selbstbestimmte Energiewende appeared first on Volksverpetzer.

Gastbeitrag von Christian Ofenheusle, Sebastian Müller
Du hast es vielleicht nicht einmal mitbekommen, aber im Hintergrund passiert eine Entwicklung, die dazu führen könnte, dass die wichtige Energiewende die Macht einiger weniger Konzerne vergrößern könnte – und uns alle behindern, unseren eigenen Strom zu produzieren. Bis zum 10. April kannst du jetzt noch eine Petition unterschreiben, um das zu stoppen.
Bis zum 10. April unterschreiben
Die Bürger-Energiewende, also die von Bürgern getragene Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energie, hat in den letzten Jahren massiv an Fahrt aufgenommen. Fast jeder von uns kann mittlerweile selbst Strom produzieren, dadurch selbst Geld sparen, damit das Netz entlasten und damit die Kosten des Stromnetzes für alle reduzieren und zugleich das Klima schonen. Aktuell wittern aber die fossilen und ehemals nuklearen Energieversorger um E.ON und RWE wieder Morgenluft.
Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU wurden auch Dinge neu bewertet, die bisher als unumstößlich galten, wie etwa die Beteiligung auch einzelner Bürger bei der Energiewende. In einem gemeinsamen Positionspapier haben die Energieriesen kürzlich klar dargelegt, dass sie statt dieser lieber wieder ein zentralisiertes Energiesystem mit mehr Gaskraftwerken und einer Streichung der Vergütung für eingespeisten Strom aus Solaranlagen hätten. Dies wird als günstigste Lösung für eine stabile Stromversorgung verkauft.
Aber es regt sich auch Gegenwind:
Eine Gruppe von Energiewende-Experten um den YouTuber „AkkuDoktor“ hat etwa eine Petition gestartet, die noch bis 10. April – also morgen – unterzeichnet werden kann. Die Petition hat bereits die 30.000er-Marke geknackt, daher werden die Petenten auf jeden Fall vom Petitionsausschuss des Bundestages eingeladen und angehört. Je mehr Unterschriften sie aber mitbringen, desto wahrscheinlicher ist, dass sie mit ihren Forderungen auch Gehör finden. Und diese Forderungen sind so ziemlich das Gegenteil der mutlosen Entwürfe, die aktuell aus Koalitionsverhandlungen nach außen dringen.
Statt einer Rückkehr zu Großkraftwerken und einer irgendwie mit Wasserstoff geschönten Erdgas-Renaissance setzt die Petition auf die Einbindung bereits bestehender, dezentraler Lösungen zur Stabilisierung des Stromnetzes. Batterien, die bereits zu hunderttausenden in den Wohnungen stehen, sollen so genutzt werden können, dass sie auch dem Stromnetz dienen und es stabilisieren. Der einfachste Weg hierzu ist, die Aufladung der Akkus vom Morgen in die Mittagszeit zu verschieben, wenn der meiste PV-Strom im Netz ist. Finanzielle Anreize wie variable Netzentgelte sollen das so attraktiv machen, dass es sich ganz von allein lohnt, ohne zusätzliche Förderung und ohne Zwang.
Scheinargumente auf dem Vormarsch
Dass diese Idee nicht jedem schmeckt, versteht sich von selbst. Die Argumente, die dagegen vorgebracht werden, sind auch nicht alle von der Hand zu weisen. So weist das Positionspapier der Konzerne etwa zurecht darauf hin, dass das Energierecht ein echter Paragrafendschungel geworden ist, der an vielen Stellen pragmatische Lösungen verhindert. Während das Original des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus dem Jahr 2000 mit gerade einmal 12 Paragrafen auskam, sind es in der heutigen Fassung über hundert. Was dabei aber übersehen wird, ist, dass im Jahr 2000 viele Herausforderungen und ihre technischen Lösungen noch gar nicht existierten, welche inzwischen mit aufgenommen wurden.
Das Ergebnis dieser Nachbesserungen spricht aber für sich: Bereits rund 69 % des Stroms stammt aus Anlagen, die erst durch das EEG möglich wurden. Der Zubau von Fotovoltaik war 2023 und 2024 so hoch wie in noch keinem Jahr zuvor. Gerade wurde die 5-Millionste Solaranlage in Betrieb genommen.

Gerade dieser Erfolg wird aber von Energiewende-Kritikern als Problem dargestellt. Zu viel Strom aus Sonne und Wind würde für große Schwankungen in der Erzeugung sorgen und damit die Stabilität des Stromnetzes gefährden.
Strom aus Wind und Sonne: Das Märchen von den Blackouts
Tatsächlich wurde in Deutschland in den letzten Monaten an einigen Tagen mit wenig Wind und Sonne weniger Strom erzeugt, als verbraucht wurde. Das Angstwort „Dunkelflaute“ geisterte durchs Netz. Dennoch fällt auf, dass der Strom nicht ausgefallen ist. Das liegt daran, dass Deutschland Teil des europäischen Stromnetzes ist, in dem sich die Länder gemeinsam versorgen.
Dabei fließt der Strom immer von der Regelzone mit dem gerade günstigsten Preis zu der Zone mit dem höchsten Preis, das ist normal in einer Marktwirtschaft. Wird in einem Land ein Überschuss erzeugt, gibt es diesen an die Nachbarländer ab. Herrscht hingegen Unterversorgung, erhält man eben den Überschuss von nebenan.
Dennoch ist jedes Land angehalten, die Erzeugung im eigenen Netz möglichst stabil zu halten. Das ist auch wesentlich günstiger für die Verbraucher, denn wenn man etwa Engpässe mit Strom aus teuren Gaskraftwerken ausgleichen muss, ist das wegen des hohen Gaspreises extrem kostspielig. Es wird zwar eine ganze Reihe an “Reservekraftwerken” vorgehalten, aber die werden aus diesem Grund erst im Notfall eingesetzt.
Kurz gesagt: Deutschland könnte sich also jederzeit komplett selbst mit Strom versorgen, aber das wäre teuer, denn so müssten etwa anstelle von günstigem dänischem Windstrom oder Strom aus österreichischen Pumpkraftwerken zur Abdeckung von Spitzenlasten teure Gaskraftwerke laufen. Und Erdgas ist im Übrigen bekanntlich auch keine heimische Energiequelle.
Aber welche Möglichkeiten gibt es denn dann, Lücken in der Erzeugung zu füllen und Spitzen zu glätten? Nicht nur wer eine Powerbank fürs Handy hat, kennt die naheliegendste Antwort: Batterien schaffen genau den Puffer, den man braucht, wenn aktuell keine Stromquellen zur Verfügung stehen.
auch beim Strom!
Batteriespeicher zählen heute bereits zur Standardausstattung bei der Anschaffung von Solaranlagen. Selbst bei Balkonkraftwerken wird aktuell bereits jedes zweite Gerät mit einem kleinen Speicher ausgeliefert, wie wir aus Gesprächen mit führenden Unternehmen erfahren haben. Die Anzahl an kleinen Speichern, die in Haushalten betrieben werden, übersteigt die von Gewerbe- und Großspeichern um den Faktor 140 (1,8 Mio. zu rund 13.000). Trotz jeweils geringerer Kapazität sorgt das dafür, dass sie mit insgesamt bereits knapp 20 Gigawattstunden das mit Abstand größte Potenzial zum Abfangen von Erzeugungsspitzen und zur Überbrückung von Engpässen in sich tragen. Der starke Preisverfall bei den Speichern sorgt zudem dafür, dass ihre Anzahl auch weiterhin ansteigen wird, denn sie rechnen sich einfach immer schneller.
Also alles gut? Leider nein!
Dieses Potenzial kann aktuell nicht genutzt werden, da die Speicher hauptsächlich für die Optimierung des Eigenverbrauchs genutzt werden. Das bedeutet, alle Überschüsse in den Morgenstunden laufen in den Speicher, bis der voll ist, und dann am Mittag, wenn der Strom aus den Millionen von Solaranlagen Abnehmer bräuchte, können sie nichts mehr aufnehmen. Die Mittagsspitze geht also weiterhin voll ins Netz.
Fachleute fordern deshalb schon lange “Peak Shaving” und “Valley Filling”. Speicher sollen dazu genutzt werden, die Lastspitzen zu kappen, die es meist rund um die Mittagszeit gibt. Gleichzeitig sollen die Speicher dann auch die „Täler“ mit weniger Erzeugung durch Einspeisung in diesen Zeiten „zuschütten“.
Grundsätzlich wäre auch genug freie Kapazität in den Speichern vorhanden, um sie auf diese Weise sinnvoll einzusetzen. Schätzungen gehen im aktuellen Normalbetrieb von etwa 70 % ungenutzter Speicherkapazität aus. Die Bedingung, um diese sinnvoll einzusetzen, ist aber eine intelligente Steuerung.
Das “Solarspitzengesetz” aus dem letzten Jahr hätte die Möglichkeit geboten, entsprechende Anreize für selbige zu schaffen. Leider wurde dort im Gegenteil festgelegt, dass Solaranlagen nun abgeregelt werden, wenn die Überschüsse zu groß werden, und dass Einspeisung in Zeiten negativer Börsenstrompreise (die treten insbesondere dann auf, wenn viel Sonnenstrom im Netz ist) nicht mehr vergütet wird – Regelungen, die also in erster Linie die Erzeugung treffen, statt die intelligente Speicherung anzuregen. Die Möglichkeit, Netzentgelte – die immerhin einen Anteil von rund einem Viertel am Strompreis haben – variabel zu machen und so zum Laden der Speicher in günstigen und Entladen in teuren Zeiten anzuregen, wurde lediglich für große Verbraucher wie Wärmepumpen und Wallboxen fürs E-Auto eingeführt. Kleinere Haushalte gehen hier bislang leer aus. Die eingangs erwähnte Petition möchte auch das ändern.
Aber reicht das denn überhaupt?
Der Gesamtverbrauch in Deutschland schwankt im Tagesverlauf zwischen 40 und 70 Terawattstunden. Das ist eine ganze Menge. Die Differenz zwischen Erzeugung und Netzlast ist allerdings wesentlich überschaubarer. Mit knapp 20 GWh Kapazität wären die bestehenden Kleinspeicher bereits heute in der Lage, viele Mittagsspitzen im Jahresverlauf aufzunehmen. An einzelnen Tagen mit sehr viel Wind- und Sonnenstrom würde weiterhin Strom in die Nachbarländer exportiert werden.
Investoren haben hier ein Geschäftsmodell erkannt. Daher liegen für diese Fälle bereits etliche Anträge auf den Bau von Großspeicheranlagen bei den Genehmigungsbehörden. Alternativ könnten es aber auch einfach noch viel mehr Kleinspeicher sein. Das Gleiche gilt für die Tage mit „Dunkelflaute“. Wenn Wind und Sonne weniger erzeugen, als im Netz gebraucht wird, können die Kleinspeicher bereits heute einen wichtigen Beitrag leisten. Um diese Täler vollständig auszugleichen, müsste es aber ebenfalls noch eine ganze Menge mehr davon geben.

Um einen entsprechenden Zuwachs an Speichern wird man sich aber nicht wirklich Gedanken machen müssen. Aktuelle Berechnungen belegen, dass sich Kleinspeicher durch den netzdienlichen Einsatz sogar dann lohnen können, wenn man sie ganz ohne Photovoltaik betreibt. Das erhöht die Anzahl der Haushalte, für die sich die Anschaffung lohnen kann, auf ALLE, also rund 40 Millionen. Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme gehen von einem Speicherbedarf von 180 GWh bis 2045 aus. Selbst wenn sich also 90 % aller Haushalte dazu entscheiden würden, einen der gängigen 2,5-kWh-Speicher anzuschaffen, wäre das immer noch nur die Hälfte der erforderlichen Kapazität. Ganz ohne Großspeicher wird es also nicht gehen. Aber bei einer potenziellen Nutzung von mehreren Millionen Geräten treten auch noch andere Faktoren in den Vordergrund.
Was kostet der Spaß?
Bis vor wenigen Jahren waren Speicher tatsächlich noch sehr teuer. Auch dank der Elektromobilität hat sich hier aber einiges getan. Ein Beispiel: Lithium-Batterien sind um satte 97 % günstiger als noch 1991:
Das führt dazu, dass sich jetzt nicht mehr nur Großspeicher wirklich lohnen. Auch kleine Speicher mit PV-Anlage haben fossile und nukleare Energiequellen bereits beim Preis hinter sich gelassen:

Genauer liegen diese je nach Ausstattung aktuell bei 200-800 Euro pro kWh-Kapazität. Rechnet man da nun noch die möglichen Ersparnisse durch netzdienlichen Einsatz dazu, dann macht sich die Anschaffung eines Speichers auch für kleine Haushalte noch schneller bezahlt. Zudem bieten moderne Kleinspeicher mit 6.000 Ladezyklen eine ausreichend lange Lebenszeit, um die Anschaffungskosten sogar mehrfach wieder einzuspielen.
Und die Umwelt?
Desinformationen rund um die Umweltkosten von Batterien sind allgegenwärtig. Selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien finden sich Grafiken wie diese, die die Umweltkosten von E-Autos aufgrund der Batterien als doppelt so hoch einstufen wie die von Verbrennern:
Solche Berichte führen meist nicht nur Scheinargumente ins Feld, sondern unterschlagen oft auch zentrale Punkte wie die weitere Nutzung der Speicher. Ebenso wie ein E-Auto erst beim Laden im entsprechenden Strommix seine klimafreundliche Wirkung entfaltet, ist es beim Heimspeicher die Menge an fossiler Energie, die er verdrängen kann, welche über seinen CO₂-Fußabdruck entscheidet. Je netzdienlicher er eingesetzt wird, desto kleiner ist derselbe.
Zentral ist an dieser Stelle, dass die Berechnung der ökologischen Sinnhaftigkeit des netzdienlichen Einsatzes der knapp 20 GWh Speicherkapazität bereits bestehender Kleinspeicher mit null Emissionen starten muss, denn sie sind ja bereits gebaut und angeschlossen. Diese nun dazu zu befähigen, noch weiteren CO₂-lastigen Strom aus dem Netz zu verbannen, ist auch vom Umweltaspekt her ein No-Brainer.
Bürger-Energiewende
Ein Energiesystem, bei dem viele mitmachen können, ist daher nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für alle gemeinsam eine gute Idee. Von dieser sollte man sich nicht durch Scheinargumente abbringen lassen – insbesondere nicht von denen, die damit ein Eigeninteresse verfolgen. Stattdessen heißt es Mitmachen! Die Petition zur Einbindung von Kleinspeichern läuft nur noch bis morgen, also am besten jetzt gleich unterzeichnen.
Artikelbild: Bernd Weißbrod/dpa
The post Bürger statt Bosse: So stoppst du den Angriff auf die selbstbestimmte Energiewende appeared first on Volksverpetzer.








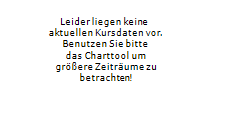




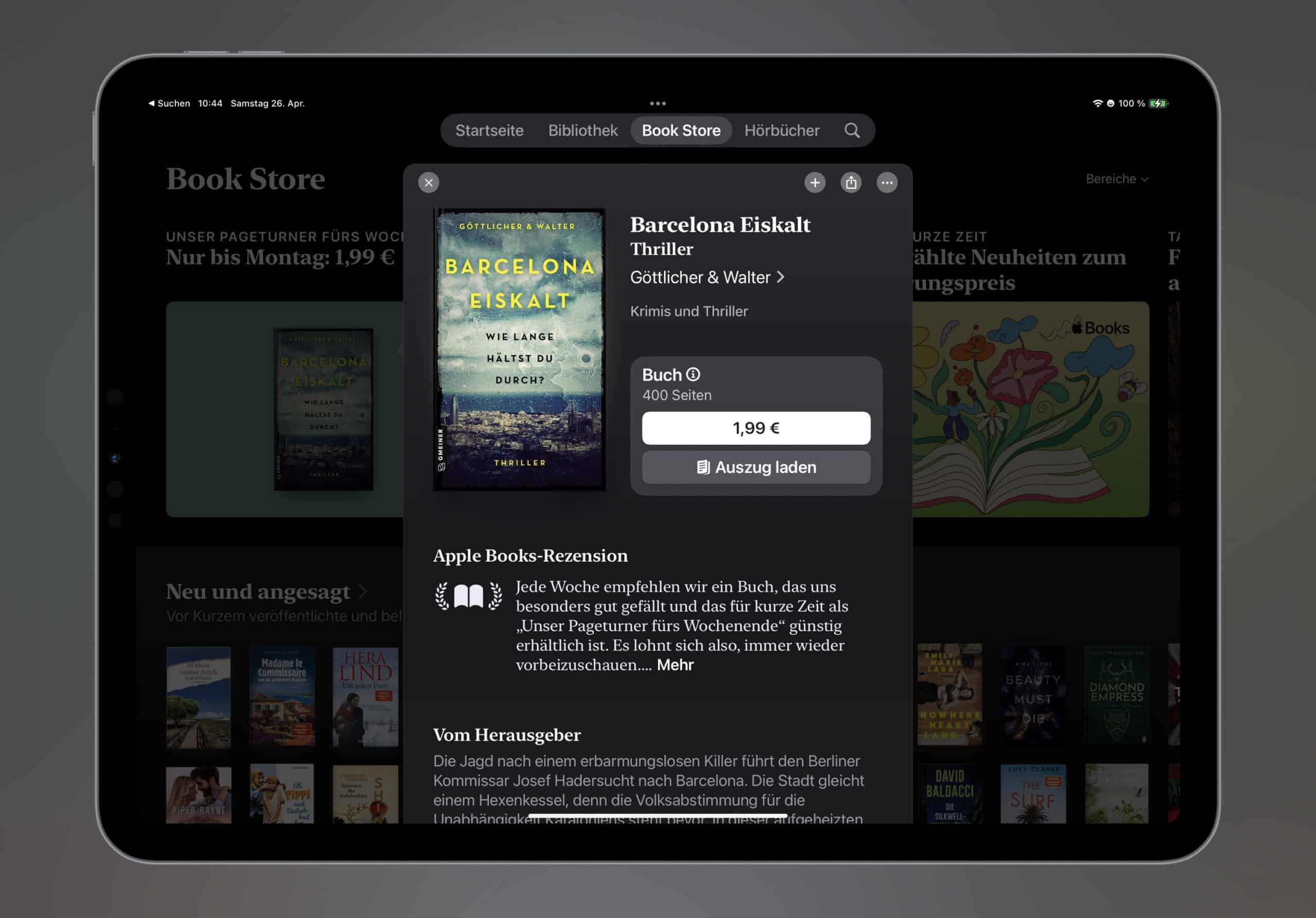




![Warum die Google Search Console eines der wichtigsten Relaunch-Werkzeuge ist [Search Camp 368]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/02/Search-Camp-Canva-368.png)
![SEO-Monatsrückblick März 2025: Google AIO in DE, AI Mode, LLMs + mehr [Search Camp 369]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/03/Search-Camp-Canva-369.png)