Bahn vor Gericht: Warum der DB Navigator ein Fall für die Justiz ist
Wie ihr wisst, findet am 19. Mai 2025 (11:30 Uhr) der Prozessauftakt gegen die Deutsche Bahn vor dem Landgericht Frankfurt am Main statt. Dabei geht es um nichts Geringeres als den Datenschutz in der DB-Navigator-App. Digitalcourage hat die Bahn verklagt – unter anderem, weil die App zahlreiche persönliche Daten ihrer Nutzer ungefragt an Drittunternehmen übermittelt. […]

 Wie ihr wisst, findet am 19. Mai 2025 (11:30 Uhr) der Prozessauftakt gegen die Deutsche Bahn vor dem Landgericht Frankfurt am Main statt. Dabei geht es um nichts Geringeres als den Datenschutz in der DB-Navigator-App. Digitalcourage hat die Bahn verklagt – unter anderem, weil die App zahlreiche persönliche Daten ihrer Nutzer ungefragt an Drittunternehmen übermittelt. In diesem Beitrag möchte ich ein paar zentrale Fragen aufgreifen und aus technischer Perspektive einordnen.
Wie ihr wisst, findet am 19. Mai 2025 (11:30 Uhr) der Prozessauftakt gegen die Deutsche Bahn vor dem Landgericht Frankfurt am Main statt. Dabei geht es um nichts Geringeres als den Datenschutz in der DB-Navigator-App. Digitalcourage hat die Bahn verklagt – unter anderem, weil die App zahlreiche persönliche Daten ihrer Nutzer ungefragt an Drittunternehmen übermittelt. In diesem Beitrag möchte ich ein paar zentrale Fragen aufgreifen und aus technischer Perspektive einordnen.
Warum sammelt die DB-Navigator-App Daten über ihre Nutzer?
Ich kann letztlich nur aus der technischen Analyse ableiten, welche Daten die App überträgt und an welche Dienstleister diese Daten fließen. Warum die Deutsche Bahn das genau so gestaltet hat, kann nur die Bahn selbst beantworten.
Was aus den Mitschnitten aber eindeutig hervorgeht: Schon bei der reinen Suche oder Buchung einer Reise werden Daten wie die Anzahl der Reisenden, ob Kinder mitreisen, Start- und Zielbahnhof und vieles mehr an externe Dienstleister übermittelt. Darüber hinaus wird das Nutzungsverhalten innerhalb der App durchgehend erfasst – also, welche Bereiche der App der Nutzer aufruft, wie lange er sich wo aufhält und welche Schritte er durchführt. Vermutlich nutzt die Bahn diese Daten, um die App aus ihrer Sicht zu »optimieren« – sei es für bessere Nutzerführung oder für wirtschaftliche Zwecke wie Marketing und Analyse.
Darf die Bahn das überhaupt?
Grundsätzlich wäre es sogar legitim, solche Daten für bestimmte Zwecke zu erheben – wenn dies im Einklang mit geltendem Recht erfolgt. Das bedeutet: Der Nutzer muss vorher informiert werden, welche Daten für welchen Zweck verarbeitet werden und er muss frei entscheiden können, ob er dem zustimmt oder nicht. Genau das passiert hier nicht.
Stattdessen behauptet die Bahn pauschal, dass die eingebundenen Tracking- und Analysedienste »technisch erforderlich« seien. Diese Dienste lassen sich nicht abwählen. Nutzer haben damit keine echte Wahlmöglichkeit. Aus meiner Sicht verstößt das gegen die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie gegen das Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG), das unter anderem eine informierte und freiwillige Einwilligung für solche Datenverarbeitungen vorschreibt.
Sind diese Tracker wirklich »technisch erforderlich«?
Ganz klar: Nein.
Wer sich technisch auskennt, kann die Verbindungen zu Adobe, Google, Tealium und Co. blockieren – und trotzdem funktioniert die App weiterhin vollständig, inklusive Fahrplanauskunft und Ticketbuchung. Von einer echten technischen Erforderlichkeit kann also keine Rede sein. Hier wird aus meiner Sicht ein rechtlicher Trick genutzt, um das Einwilligungserfordernis zu umgehen – zulasten der Nutzer.
Welche Alternativen haben Verbraucher?
Leider kaum welche. Die Bahn macht die App zunehmend alternativlos, da viele Services – etwa der Ticketkauf im Zug – ausschließlich über den DB Navigator möglich sind. Wer die App aus Datenschutzgründen nicht nutzen möchte oder kein Smartphone besitzt, hat kaum noch eine Chance, bestimmte Bahnangebote zu nutzen.
Es gibt allerdings datenschutzfreundlichere Alternativen, wenn man sich lediglich über Verbindungen informieren möchte. Dazu gehören zum Beispiel Apps wie Transportr oder Öffi. Diese greifen auf öffentlich verfügbare Fahrplandaten zu, verzichten aber auf Tracking. Allerdings bieten diese Apps keine Möglichkeit, Tickets zu kaufen oder andere personalisierte Bahn-Services zu nutzen. Für den vollständigen Funktionsumfang – etwa die Buchung von Fahrkarten – bleibt Nutzern aktuell keine echte Alternative, außer den DB Navigator zu verwenden.
Fazit: Digitalzwang statt Wahlfreiheit
Der DB Navigator ist kein harmloses Alltagswerkzeug, sondern ein Paradebeispiel dafür, wie digitale Dienste genutzt werden, um Menschen systematisch zu entmündigen. Die Deutsche Bahn zwingt Millionen Fahrgäste in eine datenschutzrechtlich fragwürdige Abhängigkeit – und verkauft das auch noch als vermeintlich technisch notwendig. Wer keine Wahl hat, sich dem zu entziehen, wird nicht freiwillig, sondern unter Druck zum gläsernen Kunden gemacht. Das ist kein technischer Fortschritt, sondern ein gesellschaftlicher Rückschritt. Denn Bahnfahren gehört zur Grundversorgung in diesem Land. Wer darauf angewiesen ist, darf nicht gezwungen werden, sein Verhalten von US-Konzernen und Marketingdienstleistern auswerten zu lassen. Genau das aber passiert Tag für Tag – und das nicht trotz, sondern wegen bewusster Entscheidungen der Deutschen Bahn. Diese Praxis ist nicht nur rechtlich höchst zweifelhaft, sondern zeigt auch, wie Unternehmen Grundrechte mit scheinheiligen Argumenten aushebeln wollen.
Es bleibt zu hoffen, dass der Prozess am 19. Mai klare Maßstäbe setzt und die Rechte der Nutzer stärkt. Denn Bahnfahren sollte möglich sein, ohne sich tracken und überwachen zu lassen.







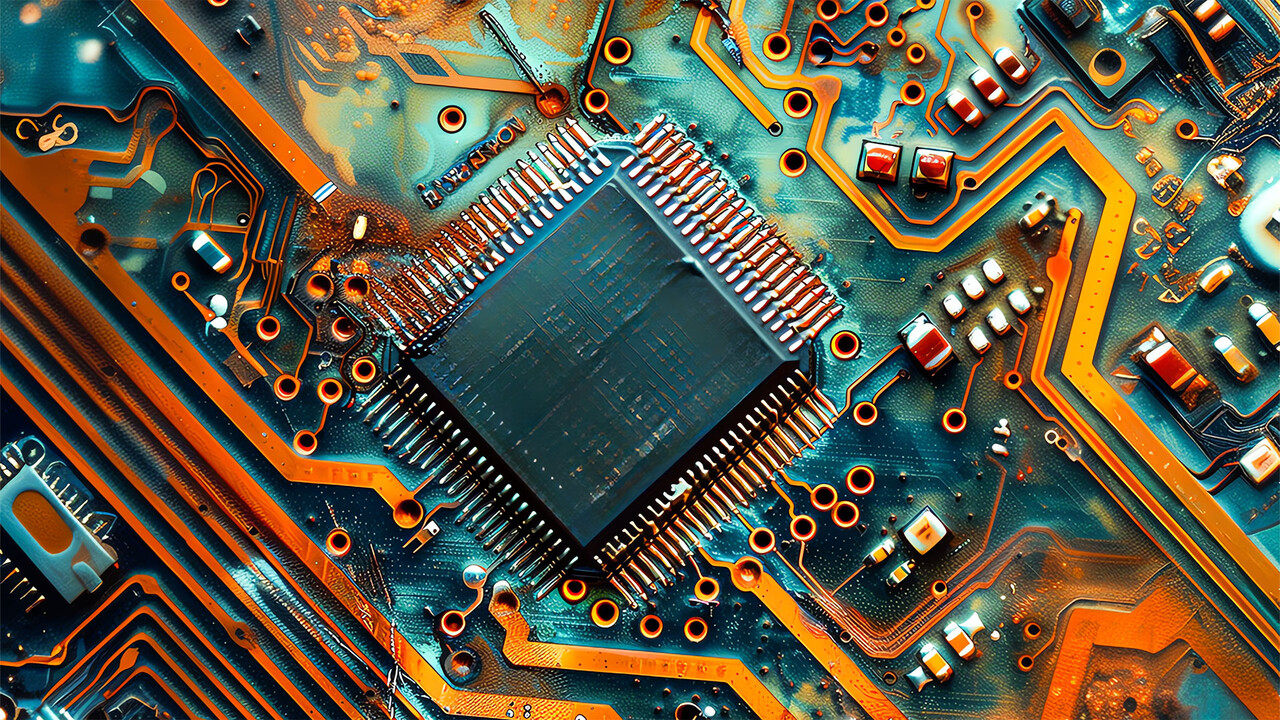
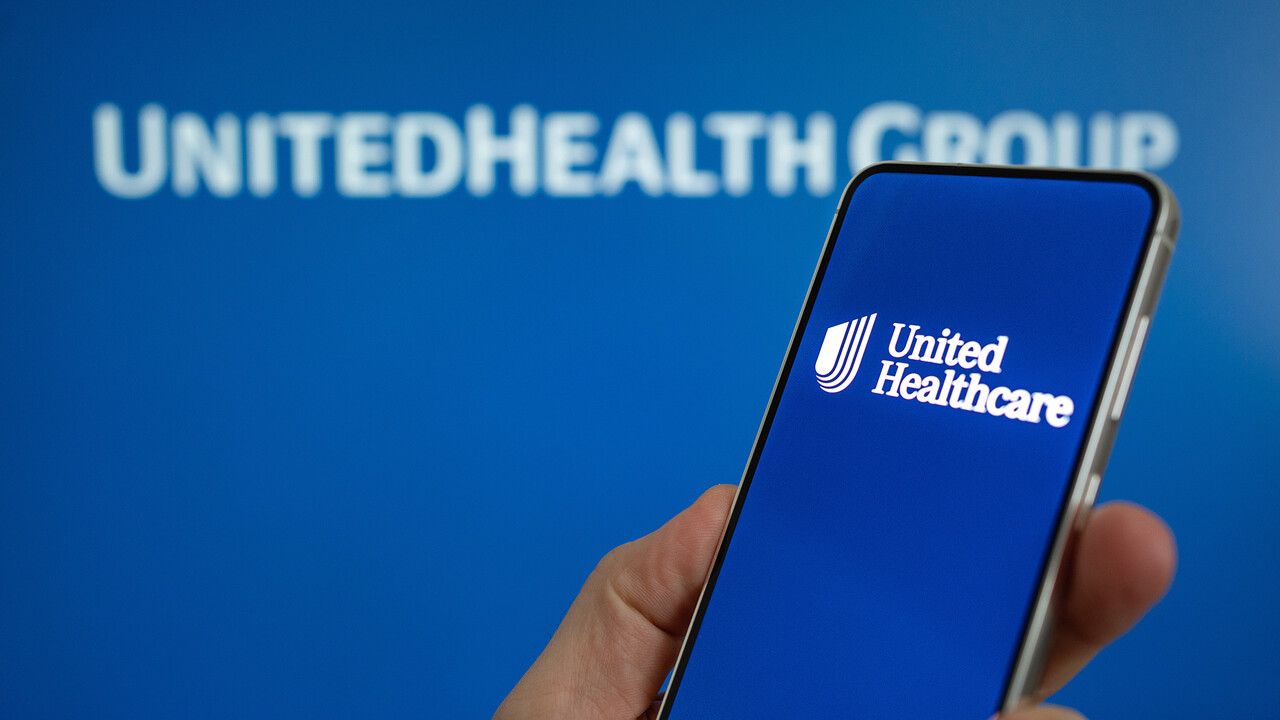



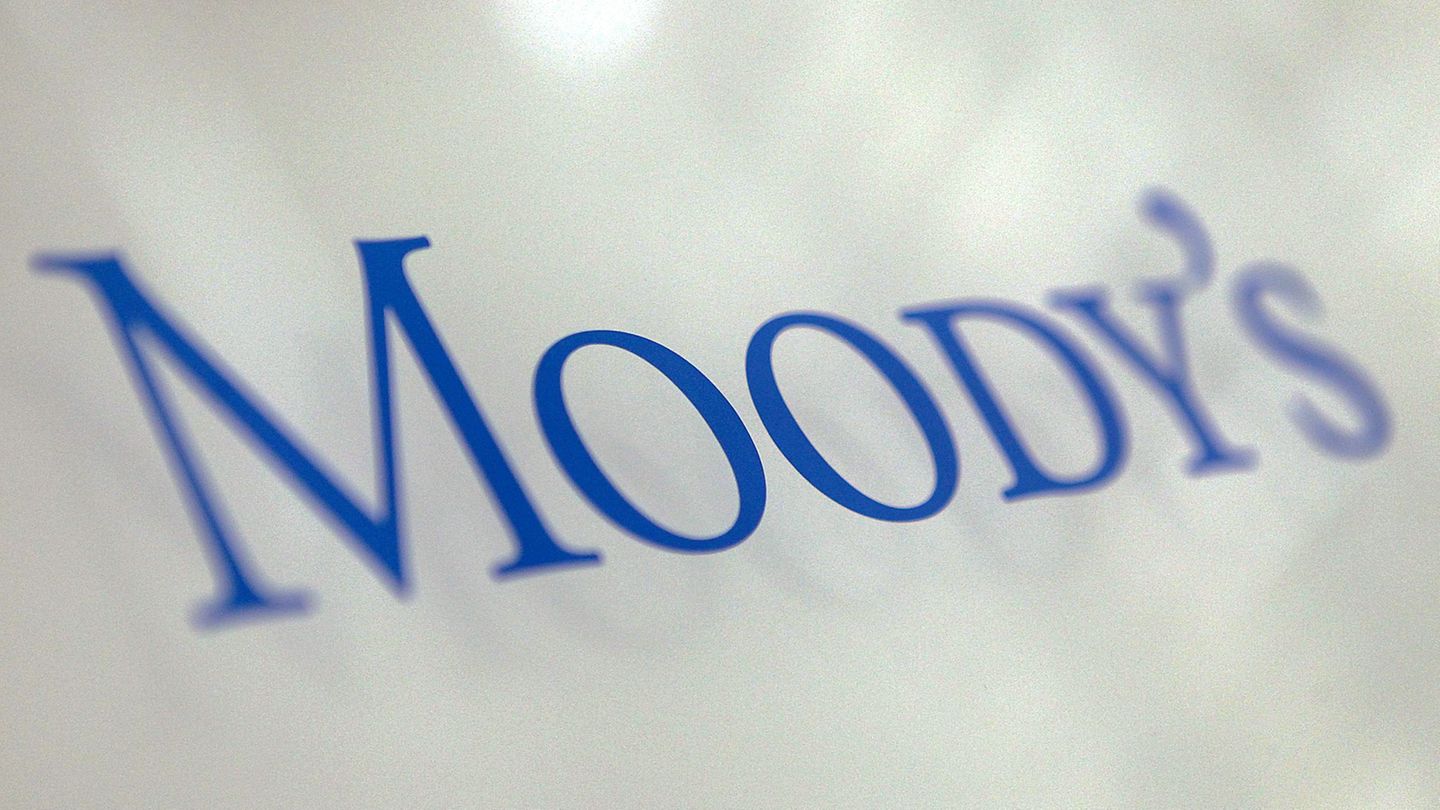
















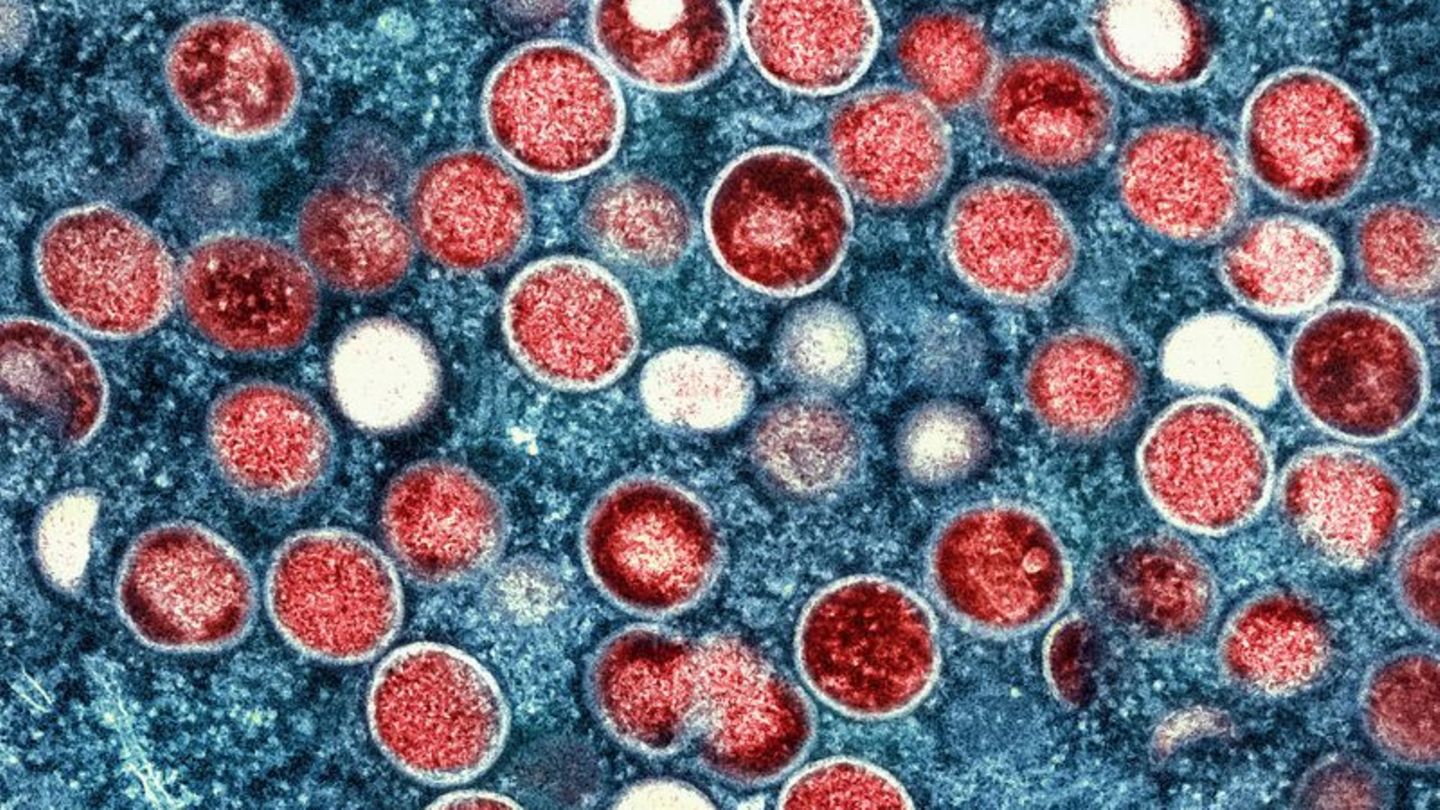







































,regionOfInterest=(1667,1318)&hash=23d15d34f2fe8dfe065f9a6b9583221238137d3f3f91ff8ce303e37c4c217ecf#)

,regionOfInterest=(1060.5,596.5)&hash=82a9fa5560f00168f9abfab82685fe75d1ea7837878ac87e990b9e07c4517d9c#)
