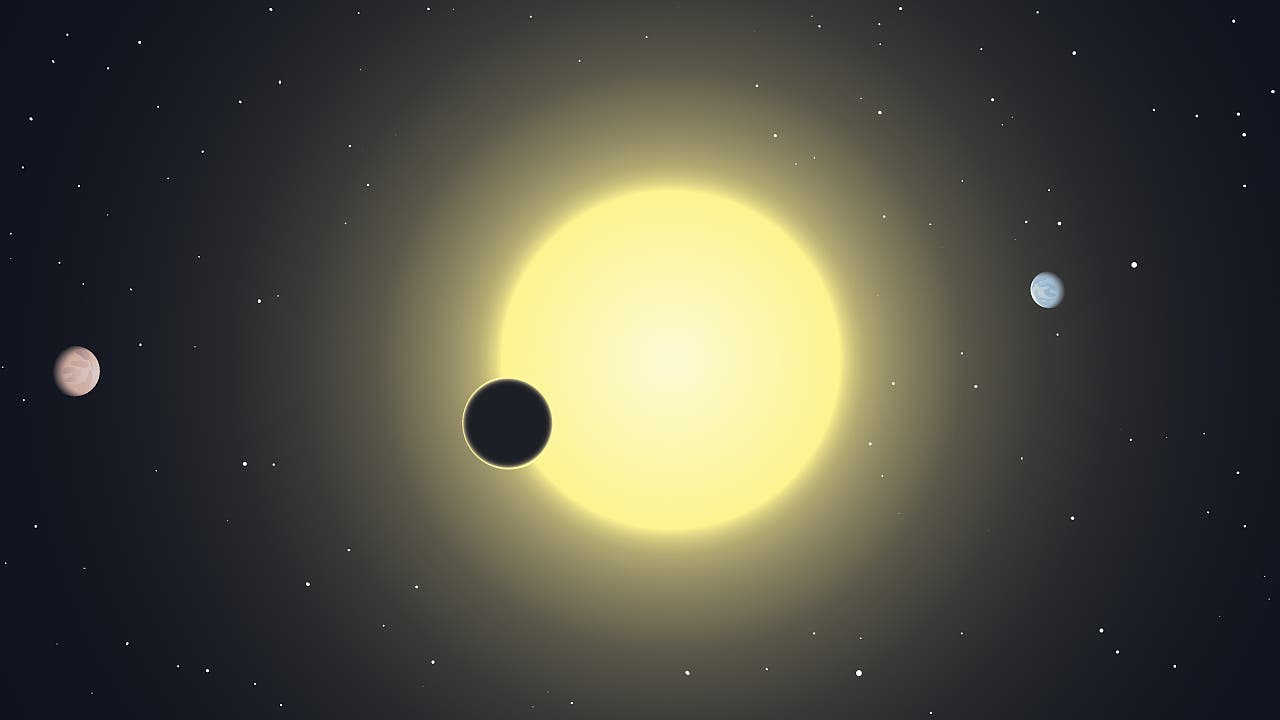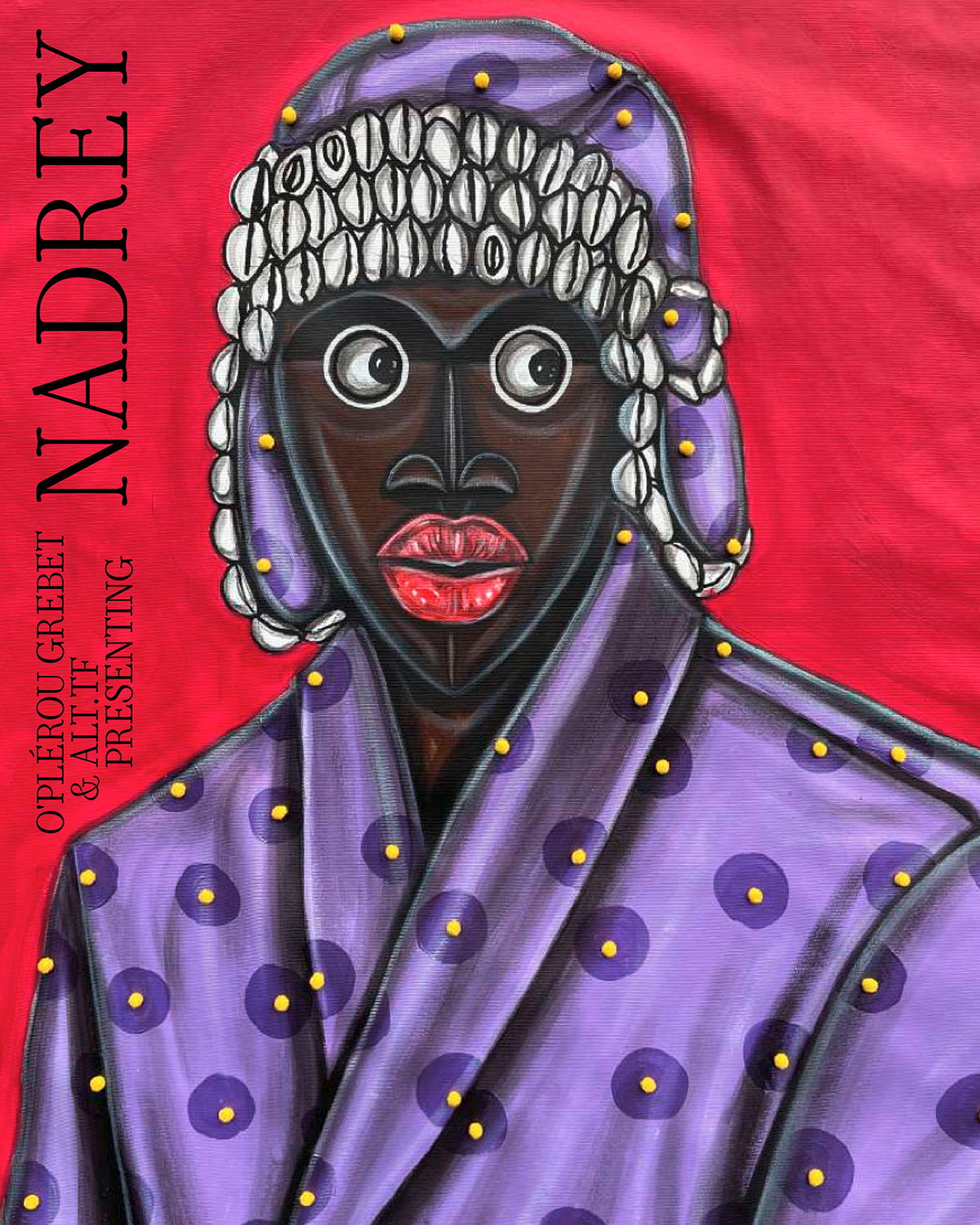Timo Pache: Wenn es die FDP nicht mehr gibt – man müsste sie neu erfinden
Die FDP hat sich selbst ins Abseits manövriert – trotzdem fehlt jetzt eine liberale Stimme im Bundestag. Deutschland könnte eine Partei, die realistische Reformen in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik aufzeigt, gut vertragen

Die FDP hat sich selbst ins Abseits manövriert – trotzdem fehlt jetzt eine liberale Stimme im Bundestag. Deutschland könnte eine Partei, die realistische Reformen in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik aufzeigt, gut vertragen
Zugegeben, es liegt nicht besonders nah, gerade an die FDP zu denken. In Washington feierte in dieser Woche ein US-Präsident seine ersten 100 Tage im Amt – und vor allem sich selbst. Der Rest der Welt gratulierte sich derweil bestenfalls dazu, dass man wenigstens diese 100 Tage schon hinter sich hat. Und in Berlin bereitete sich Friedrich Merz darauf vor, am kommenden Dienstag endlich jenes Amt zu übernehmen, das ihm nach eigener Auffassung die letzten 20 Jahre in der CDU mehr oder weniger vorenthalten wurde. Zwischen all diesen historischen Ereignissen und Entwicklungen wird die FDP mindestens für die nächsten dreieinhalb Jahre keine Rolle mehr spielen.
Kürzlich traf ich ein langjähriges Parteimitglied und engagierten Spender der Partei und fragte ihn, wie es denn nun weitergehe. Er blickte mich gequält an, sagte nichts und warf nach zwei oder drei Sekunden schweigend seine linke Hand nach hinten über die Schulter – aus, vorbei, weg damit.
Also gut, heute geht es um die FDP – wen interessiert’s?
Zumindest in den Nachlesen zum Koalitionsvertrag von Union und SPD offenbarte sich eine empfindliche Leere: Nach den 146 Seiten verspürten nicht wenige schon wieder eine kleine Sehnsucht nach einer Stimme, die von der arg geschrumpften großen Koalition etwas mehr eingefordert hätte als den kleinsten gemeinsamen Nenner. Die mehr Ehrgeiz verlangt, mehr Reformen, mehr Aufbruch. Die in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik Alternativen aufzeigt, aber realistische wohlgemerkt. Denn an sich wird der neue Bundestag genug Alternativen bieten zu Merz und Klingbeil, nur leider vor allem schrille und radikale, eben nicht realistische und rationale.
Im Bundestag fehlt die liberale Stimme
Wenn in den Talkshows nur noch Professoren und Wirtschaftsweise diese Rolle übernehmen, aber niemand mehr am Rednerpult des Bundestags gegen die Behäbigkeit von Bürokratie und Sozialstaat argumentiert, dann stimmt etwas nicht. Hier wird die FDP fehlen. Deswegen lohnt es sich doch noch mal, zwei oder drei Gedanken an eine liberale Partei zu verschwenden – die, die es noch gibt, und die, die es einmal geben könnte. Oder sollte. Um dahin zu gelangen, muss man noch mal einige Monate zurück in die Vergangenheit reisen.
Denn mit der Wahl von Merz zum neuen Kanzler und der Vereidigung der neuen Minister wird in der kommenden Woche auch jener Mann die Bühne in Berlin verlassen, der mit seinem Trotz und seiner bloßen Anwesenheit im Kabinett bis zuletzt den alten Richtungsstreit unter den Liberalen verkörperte: Volker Wissing, der scheidende Verkehrsminister.
Schon in den Monaten vor dem Bruch der Ampelkoalition war in den Berliner Reihen der Liberalen, unter Bundestagsabgeordneten und den Kabinettsmitgliedern, nur noch wenig Freundliches über den eigenen Verkehrsminister zu hören gewesen. Dann platzte die Regierung, und während mit Parteichef Christian Lindner alle anderen FDP-Minister und Staatssekretäre aus der Regierung ausschieden, blieb Wissing im Amt und verließ Partei und Fraktion. Was damals ein Glück für Lindner war – der Aufruhr durch den Bruch der Ampel übertönte den Bruch in der eigenen Partei – ist für die FDP aber noch nicht ausgestanden.
Treuloser Haufen von sehr selbstbewussten Einzelgängern
Unter allen Parteien in Deutschland war die FDP schon immer die merkwürdigste. Die Suche nach Zweifel und Widerspruch – immer ein unerlässliches Arbeitsmittel für Journalisten – war nirgendwo so einfach wie bei den Liberalen. Egal worum es ging, man fand immer schnell eine halbwegs prominente und relevante Stimme, die mit irgendetwas in der Partei partout nicht einverstanden war. Die FDP war immer nicht nur eine Partei, sondern ein ziemlich treuloser Haufen von sehr selbstbewussten Einzelgängern.
Die Freiheitsliebe, die die Partei so gerne für sich proklamiert, hat jedoch in den vergangenen 15 bis 20 Jahren zuweilen seltsame Blüten getrieben. Wie in vielen bürgerlichen Parteien anderer Länder auch hat sie sich zumindest in einem Teil der FDP verengt und radikalisiert: auf eine zunehmend platte Abwehr gegenüber dem Staat und all seinen Instrumenten, von der Steuerverwaltung über die Sozialsysteme bis hin zur Arbeit von Notenbanken, einst auch aus liberaler Sicht der Hort von Ordnungspolitik und Verlässlichkeit. So konnte es passieren, dass selbst ein Minister wie Wissing (fast 30 Jahre in der Partei, die meiste Zeit davon Kreisvorsitzender, Landesvorsitzender, sechs Jahre stellvertretender Ministerpräsident, dazu noch Generalsekretär im Bund und Minister) mit einem Plädoyer für den Erhalt von Straßen und Schienen – gleichbedeutend mit: „mehr Geld“ – in den Verdacht geraten konnte, ein linker Ausgabenpolitiker zu sein, der liberal nur als wokes „liberalala“ betreibt.
Natürlich sind Wahljahre spezielle Zeiten, in denen abweichende Meinungen in den eigenen Reihen nie gerne gesehen werden. Das gilt durch die Bank für alle Parteien. Doch in keiner Partei wurde die Auseinandersetzung um den eigenen Kurs vor und nach dem Koalitionsbruch so erbittert ausgetragen, wurde am Ende der Kompromiss so diffamiert und die eigene Programmatik so binär betrieben wie in der FDP. Die Idee des Liberalismus existierte dort zuletzt nur noch als illiberale Ideologie.
Die FDP braucht eine neue Strategie
In zwei Wochen wählt die Partei einen neuen Vorsitzenden und eine neue Führungsspitze. Wissing hat die Partei verlassen, und mit ihm viele Liberale, die an eine FDP glaubten, die in einer mehrheitlich linken oder mehrheitlich konservativen Regierung einen entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Die im Zweifel dafür sorgt, dass die Freiheit doch eine Chance behält, sei es in der Steuer-, in der Wirtschafts-, in der Innen- oder in der Gesellschaftspolitik. Die FDP als Korrektiv, als Funktionspartei – aber eben: als Partei, die im Staat und seinen Organen bereitwillig genau diese Funktion übernimmt. Die sich nicht verweigert und den Staat als Ordnungsmacht ablehnt, sondern selbst als Instrument betrachtet, als ihr Instrument.
Es ist ungewiss, wie es unter der künftigen Führung mit der FDP weitergeht. Der Kurs von Christian Lindner, der nach großen Erfolgen nun doch einigermaßen gescheitert abtritt, ist für eine FDP als Funktionspartei in der Regierung eine Sackgasse: Die Komplettverweigerung in der Finanz- und Haushaltspolitik mag eine programmatische Alternative sein, doch mit ihr ist ein Staat in den kommenden zehn bis 15 Jahren in Europa nicht mehr zu machen. Selbst mit radikalen Reformen und mehr Wachstum werden sich nicht die Haushaltsspielräume ergeben, die künftige Regierungschefs brauchen, um Deutschland in einer zunehmend aufgepeitschten Welt zu behaupten. Auch ein Kanzler Friedrich Merz hätte mit der aktuellen FDP nichts mehr anfangen können – die Aufgaben, die auf ihn warten, sind kein Wünsch-Dir-Was.
In der außerparlamentarischen Opposition mag eine konservativ-libertäre Ausrichtung der künftigen FDP-Spitze ihre Arbeit erleichtern. Vielleicht reicht es so irgendwann auch mal wieder für das eine oder andere Mandat in einem Parlament. Aber als ernsthafte politische Kraft verliert die Partei so jede Bedeutung. Wenn es eine solche liberale Partei in Deutschland dann nicht mehr gibt: Man müsste sie dringend erfinden.







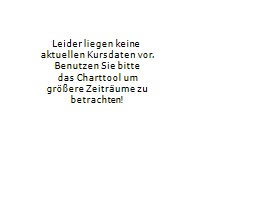
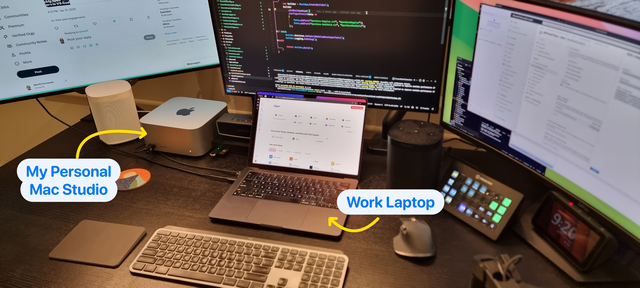
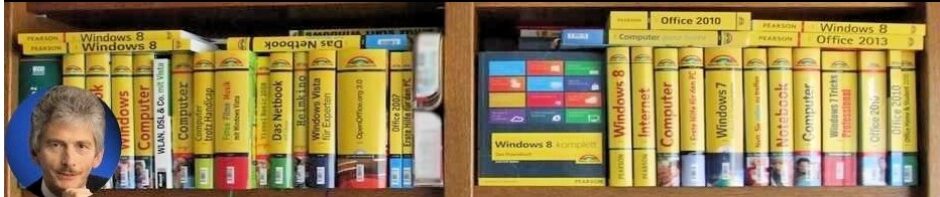

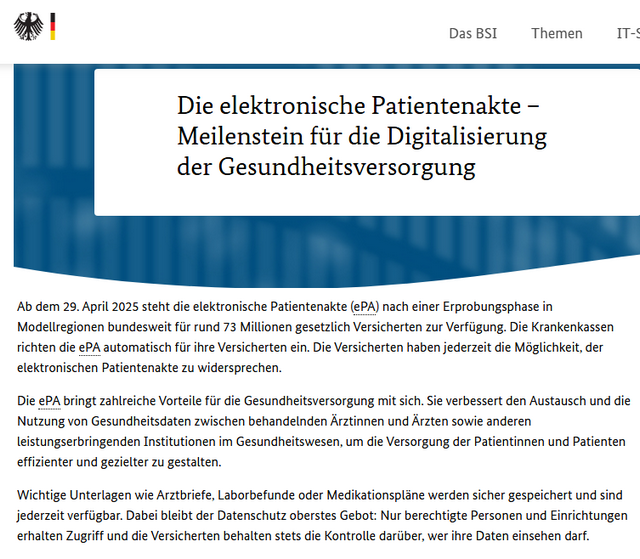






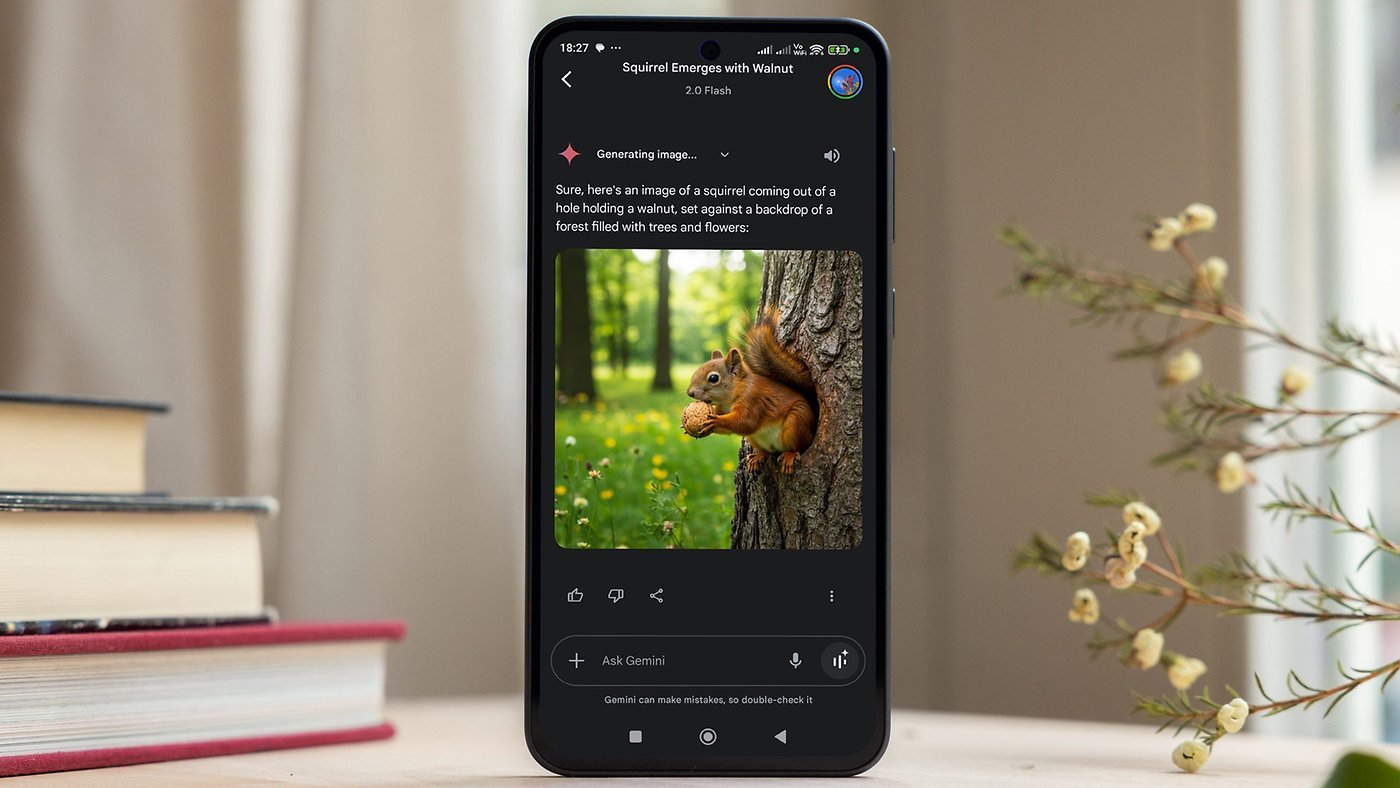
,regionOfInterest=(1562,791)&hash=9310586991a666d64fdca38b87ed14b6fa7cec390e2e310cf435879a5ff604e4#)