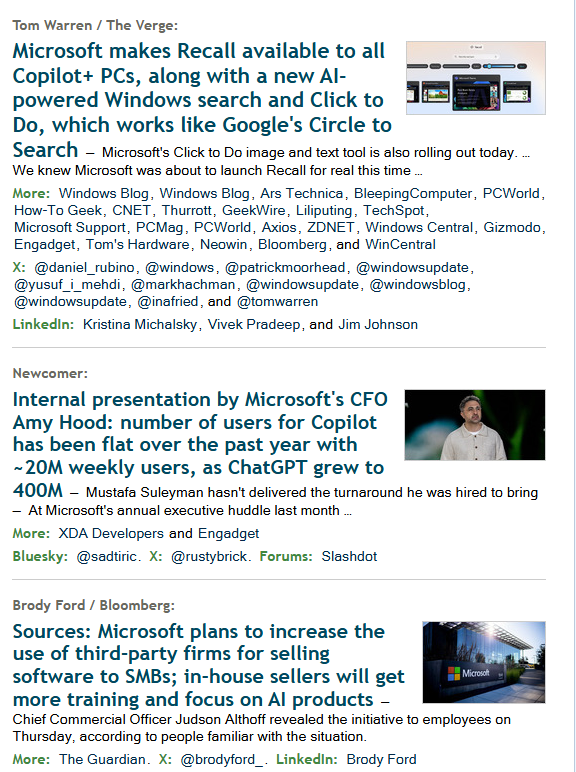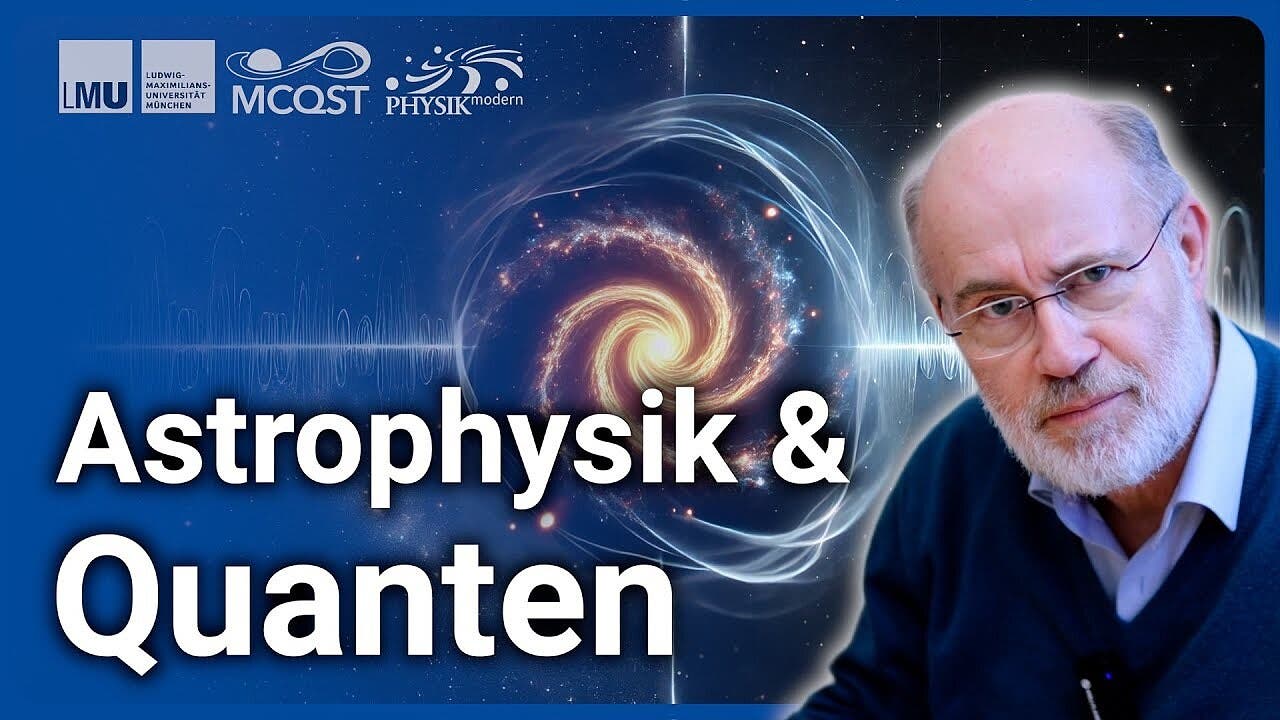Peter Neururer und Winnie Schäfer über die wilden 90er: „Winnies Wortwahl war nicht jugendfrei“
In den Neunzigern zählten Peter Neururer und Winfried Schäfer zu den prägenden Trainern der Bundesliga. Im Doppelinterview packen beide aus – über ein Jahrzehnt, das den Fußball veränderte.

Hinweis: Dieses Interview erschien erstmals in unserem Spezialheft über die Neunziger Jahre im März 2010.
Winnie Schäfer, Peter Neururer, wissen Sie noch, wann Sie sich das erste Mal in der Bundesliga begegnet sind?
Neururer: Irgendwann Anfang der Neunziger. Wir spielten mit Saarbrücken zu Hause gegen den KSC.
Schäfer: Ich erinnere mich. Stefan Brasas stand bei euch im Tor.
Und wie ging es aus?
Neururer: Wir haben gewonnen.
Mit 2:0. Es war der 22. August 1992.
Neururer: Im Rückspiel nagelte uns Karlsruhe an die Wand, aber es ging kurioserweise unentschieden aus, weil Winnies Stürmer Rainer Krieg hinter einem Ball herrannte, der praktisch schon über die Linie war, um ihn ins Tor zu kicken. Der Schiri entschied auf Abseits.
Schäfer: Das war unsere große Zeit, wir waren im Europacup, nie zuvor und nie mehr danach hat der KSC so gut gespielt. Aber als wir 2:2 gegen Saarbrücken gespielt hatten, fingen die von den Ehrenplätzen schon an zu meckern.
Sie können sich aber gut erinnern.
Schäfer: Fällt mir gerade wieder ein. Ich weiß noch, dass ich nach dem Spiel eine Pressekonferenz gab, die Wellen schlug. Ich war so sauer, dass ich in Richtung der Stadtoberen sagte: „Wenn unsere Mannschaft aus Schalke käme und diesen Tabellenplatz innehätte, würden sie ganz Gelsenkirchen blau-weiß anmalen. Aber Karlsruhe kennt man nur, weil ab und zu Christian Klar (ehem. Mitglied der RAF, Anm. d. Red.) mit dem Hubschrauber landet.“ Au weia. Der Gemeinderat ist aus allen Wolken gefallen. Aber eine Woche später, als wir zu einem Europacupspiel aufbrachen, saßen die Herren wieder als erstes im Bus.
1992 war das Jahr, in dem die Sendung „ran“ die Bundesliga in neuem Licht zeigte. Wie veränderte sich damals der Fußball?
Neururer: Damals noch gar nicht so sehr. Gut, Wattenscheid 09 waren die ersten, die mit einer Viererkette spielten. Aber das Spiel blieb noch dasselbe. Was sich änderte, war die Berichterstattung. Fußball wurde Boulevard.
Eine nicht unerhebliche Veränderung. Auch für Sie als Trainer.
Neururer: Das stimmt. Das Fernsehen stellte plötzlich Richtmikrofone an den Trainerbänken auf. Dadurch veränderte sich das Verhalten der Schiedsrichter uns gegenüber komplett. Ende der Achtziger lief es noch ganz anders: Als junger Aachener Trainer meckerte ich über Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder – leicht roter Kopf, überragender Typ. Ich sagte: „Schiri, wat pfeifst du für ne Scheiße.“ Kommt der auf mich zu, guckt und sagt: „Halt deine Klappe, wat trainierst du für ’ne Scheiße.“ Und das Thema war erledigt. Das änderte sich ab 1992 völlig.
Wie muss man sich das vorstellen?
Neururer: Zum Beispiel als Rainer Krieg das Abseitstor für den KSC erzielte. Die Wortwahl vom Winnie war da wahrlich nicht jugendfrei.
Schäfer: Könnte sein.
Neururer: Und zwischen uns ein riesiges Mikrofon. Alles wurde eingefangen und die Schiedsrichter legten jedes Wort auf die Goldwaage. Mussten sie ja auch, schließlich bekam es nun auch jeder TV-Zuschauer mit.
Schäfer: Aber, Peter, wir haben von dieser Berichterstattung doch auch profitiert. Der Fußball gewann unglaublich an Wert.
Wie erlebten Sie die Kommerzialisierung in Fußballstädten wie Saarbrücken und Karlsruhe?
Neururer: Schleppend. Besser gesagt: Gar nicht. Der 1. FC Saarbrücken hatte sich zunächst noch mit Finanzspritzen von Oskar Lafontaine und seiner Regierung über Wasser gehalten. Aber 1993 hatte ich gerade meinen Vertrag dort verlängert, als mich ein Reporter von der „Bild“ anrief und sagte: „Gilt der auch für die Oberliga?“ Wir waren kurz davor, die Lizenz zu verlieren. Dabei brauchten wir nur noch zwei Punkte, um die Klasse zu halten. Das Gespräch kriegten einige Leistungsträger mit. Die fragten mich, was sie jetzt machen sollten. Ich sagte: „Als Mensch rate ich euch: Seht zu, dass ihr Land gewinnt! Als Trainer sage ich: Gebt Gas, damit wir sportlich auf jeden Fall in der Liga bleiben.“ Aber so was bleibt natürlich in den Köpfen hängen. Wir gewannen kein Spiel mehr.
Schäfer: Mein Vorteil war, dass ich aus meiner Zeit als Spieler die Badener Mentalität kannte. Und die ist von Natur aus eher gemütlich. Im „Badnerlied“ heißt es ja auch: „… in Mannheim die Fabrik.“ Da wird gearbeitet, in Karlsruhe geht es ruhiger zu. Wenn der KSC früher abstieg, veränderte sich in der Region nichts. „Im Schatten wird man auch braun“, hieß die Devise. Als Carl-Heinz Rühl und ich dann 1986 übernahmen, versuchten wir, Jahr für Jahr die Strukturen zu verändern und neue Einnahmequellen zu finden. Als ich den KSC schon lange verlassen hatte, traf ich mal den Oberbürgermeister, der mir gestand: „Herr Schäfer, wir wissen erst jetzt, was wir durch den Abstieg an Geld verloren haben.“ Als wir noch Europacup spielten, hatte im Rathaus offensichtlich nie einer mitgerechnet.
In Saarbrücken war man sich über den Wirtschaftsfaktor Fußball auch nie im Klaren.
Neururer: Ehe dort so ein Gutachten erstellt wurde, war der Klub doch längst in den Amateurbereich abgestiegen.
Wie viele Pressekonferenzen waren Anfang der Neunziger bei Ihren Klubs üblich?
Schäfer: Eine pro Woche, wenn‘s hochkommt. Es waren eher Einzeltermine, die die Journalisten direkt mit uns machten: „Bild“ und „Kicker“ arbeiteten von Frankfurt aus, ein Redakteur kam von der Lokalzeitung. Da brauchte ich keinen Pressesprecher.
Neururer: Die Anfragen kamen direkt bei uns Trainern auf den Schreibtisch. Aber dann wechselte ich aus dem beschaulichen Ruhrgebiet von Schalke nach Berlin.
Beschauliches Schalke?
Neururer: Verglichen mit Berlin war Schalke Anfang der Neunziger noch eine Kurabteilung. Dort lernte ich, wie man die Medien gegeneinander ausspielt.
Wie denn?
Neururer: Wenn man sechs Tageszeitungen an einem Ort hat, gibt man einer die wichtige Information und die anderen sanktioniert man. So lässt sich wunderbar eine Positionierung vornehmen, und die Medien müssen zusehen, dass sie mit dir auskommen.
Schäfer: Das fiel mir in Karlsruhe schon schwerer. Wenn mich da der lokale Sportreporter ärgerte, ließ ich im Fernsehen öfter mal despektierlich den Namen seiner Zeitung fallen. Irgendwann luden die mich dann zum Krisengespräch ein und wir vertrugen uns fortan.
Nach Ihrem Wechsel zum VfB Stuttgart war das nicht mehr so einfach.
Schäfer: Es gab in Stuttgart leider Spieler, die der Presse gezielt Informationen zuspielten. Das hatte es in Karlsruhe nie gegeben. Carl-Heinz Rühl war ein starker Manager, zu dem konnte kein Spieler gehen und sich ausheulen. In Stuttgart herrschte aber ein Präsident, der aus der Politik stammte …
… Gerhard Mayer-Vorfelder …
Schäfer: … und der ließ mich ziemlich schnell fallen, als es nicht lief. Ein Trainer ist immer nur so stark, wie ihn das Präsidium macht. Ich kenne das noch aus Zeiten als Aktiver in Gladbach. Wenn da ein Spieler bei Manager Helmut Grasshoff um ein Gespräch bat, ließ der ihn mitten im Satz stehen. „Herr Grasshoff, könnte ich …“ Schluss. Der überlies alle Macht dem Trainer.
Hatten Sie auch mal so einen starken Manager, Peter Neururer?
Neururer: Ich hatte das Pech, wenn ich mal einen starken Manager hatte, dass meistens ein Präsident daneben saß, der dessen Stärke durch seine Schwäche wieder beiseite schob – oder andersherum.
Wo sind Sie denn rausgeekelt worden?
Neururer: In Köln schlug mir Präsident Klaus Hartmann vor, einen Sportdirektor zu verpflichten. Ich hielt die Idee für gut. Hartmann fragte mich nach meinen Vorschlägen. Lektion eins: Fangfrage. Nennt ein Trainer in so einem Moment einen Namen, nennt er einen anderen nämlich nicht. Aber ich Trottel sagte frei heraus: „Karl-Heinz Thielen, Heribert Bruchhagen oder Rolf Rüssmann“. Keiner von denen war damals frei. Fragt mich also kurz darauf der Präsident: „Was halten Sie von Carl-Heinz Rühl?“ Sage ich: „Wenn der hier Manager wird, gebe ich meinen Vertrag zurück.“
Warum?
Neururer: Glauben Sie mir, ich hatte mit dem komische Erfahrungen gemacht. Nun kam der – und wir sprachen uns aus. Dachte ich zumindest. Am nächsten Tag aber erscheint im „Express“ die Schlagzeile: „Rühl: Neururer: ist so tot wie Olsen“. Morten Olsen war mein Vorgänger gewesen. Rühl dementierte zwar, irgend was in dieser Richtung gesagt zu haben, aber von da ab wusste ich, dass ich bei der nächsten Niederlage raus bin. Ich nahm den Spielplan in die Hand und sagte zu meiner Frau: „Schatz, Ende September spielen wir gegen Hertha. Wenn wir da verlieren, können wir an die Algarve in Urlaub fliegen.“ Genau so kam es. Die Zeiten, dass ein Trainer neben dem Präsidenten so was wie der Alleinherrscher war, gingen Anfang der Neunziger definitiv zu Ende.
Schäfer: In Karlsruhe lief es anders. Da hat der Verein immer versucht, meine Beschlüsse umzusetzen. Ich hatte auch die Möglichkeit, ein Veto einzulegen.
Bei welcher Gelegenheit?
Schäfer: Als Oliver Kahn 1994 nach München ging, überlegten wir, Bodo Illgner nach Karlsruhe zu holen. Es war alles schon in die Wege geleitet. Doch nach der WM 1994 hatte der plötzlich ein extrem schlechtes Image. Alles, was ich über ihn hörte, war nicht gut für unsere Mannschaft. Im letzten Moment musste ich mich für Claus Reitmeier als Keeper entscheiden – was vom Klub ohne Murren umgesetzt wurde.
Der KSC war damals das leuchtende Beispiel eines Ausbildungsklubs. Inwieweit blickten Sie, Peter Neururer, mit Hochachtung auf die Arbeit des Trainers Schäfer?
Neururer: Gar nicht. Denn keiner außer den KSC-Spielern und den Co-Trainern konnte doch beurteilen, was Winnie da machte. Klar, er war erfolgreich. Aber ich habe mich auch stets gegen die – zugegeben seltenen – Lobe für meine Arbeit verwehrt. Denn es ist doch so: Wenn ich die Spieler eine Woche lang rückwärts laufen lasse, sie am Wochenende aber gewinnen, bin ich ein guter Trainer. Mache ich das augeklügeltste Training mit den neuesten Methoden und sie verlieren, bin ich ein Versager. Aber natürlich muss Winnie in Karlsruhe über lange Zeit etwas richtig gemacht haben.
Schäfer: Es gibt eine Geschichte von Gyula Lorant, der zu Eintracht Frankfurt kam und sagte: „Wir verlieren nur noch einmal, dann gewinnen wir alles.“ Und so kam es. Er legte die längste Siegesserie in der Geschichte der Eintracht hin. In der Zeit machte er sich einen Spaß draus, beim Training in Kniebundhose und mit Zigarre bei den Kiebitzen zu stehen und zu tratschen. Aber als die Eintracht nach ewigen Zeiten wieder mal verlor, waren all die Zweifler zurück, die sagten: „Der faule Hund, steht nur am Rand und quatscht mit den Rentnern.“
Bei Ihrem ersten Aufeinandertreffen im August 1992 spielten so konträre Fußballercharaktere wie Wolfram Wuttke und Oliver Kahn gegeneinander. Spieler, die es so nicht mehr gibt, oder?
Neururer: Die spielerischen Anlagen eines Wolfram Wuttke haben heute auch immer noch viele, aber mit Wuttkes menschlichen Verhaltensweisen wäre ein Spieler in der heutigen Medienlandschaft verloren.
Ernst Happel soll mit Wuttke überhaupt nicht klargekommen sein.
Schäfer: Happel liebte Fußballer wie Wuttke – und deshalb war er sauer auf ihn. Auch Magath war zur damaligen Zeit kein Trainingsweltmeister, aber er hat sich dem Trainer stets untergeordnet und an sich gearbeitet. Wuttke hatte andere Probleme, der konnte sich nicht fügen. Und Happel konnte es nicht fassen, dass der nicht zu Potte kam.
Hatten Sie als Trainer geheime Lieblingsspieler in Ihren Teams.
Neururer: Michael Kostner war ein Typ, auf den ich mich 100 Prozent verlassen konnte. Ein Genie, der hätte hundert Länderspiele machen müssen. Und ein Pfundskerl: Als ich in Köln rausgeflogen bin, hat Kostner protestiert und fortan kein einziges Spiel mehr bestritten. Obwohl er noch Vertrag hatte. Mit solchen Aktionen stand er sich immer wieder selbst im Weg. Dabei hat er sich aufgeopfert. In der Saison 1991/92 hat er beim 1. FC Saarbrücken eine gesamte Aufstiegsrunde mit drei gerissenen Bändern durchgespielt.
Wie das denn?
Neururer: Der hat sich vor jedem Spiel getaped, Schmerzmittel genommen und Spritzen gekriegt. In der Woche hat er nicht trainiert und dennoch jedes der zehn Aufstiegsspiele mitgemacht. Hinterher lag er jedes Mal weinend in der Kabine, aber wir haben es dank seiner Hilfe in die Bundesliga geschafft.
Winnie Schäfer, hatten Sie auch Spieler, die zu Unrecht nie den ganz großen Durchbruch erlebt haben?
Schäfer: In Karlsruhe hatte ich sehr viele, die ständig an ihrem Limit spielten. Gunther Metz oder Eberhard „Ebse“ Carl, die gaben immer alles, auch wenn es nicht die ganz großen Fußballer waren. Mit denen haben wir Bayern München 4:1 geschlagen, obwohl uns viele Leistungsträger fehlten. Mit diesen Spielern haben wir Valencia 7:0 geschlagen.
Was unterscheidet Führungsspieler wie Carl oder Kostner von heutigen Stars?
Neururer: Dass sie genau wussten, wo und wann sie Kritik am Trainer äußern können. Die haben nie den Weg über die Öffentlichkeit gesucht, um ihre Ziel durchzusetzen.
Schäfer: Es gibt ein Trainingsspiel im Dreieck. Sinn ist es, auf engstem Raum Doppelpässe zu üben. Das macht der FC Barcelona jeden Tag zum Warmmachen. Als ich diese Übung beim VfB Stuttgart machte, stand am nächsten Tag in der Zeitung: „Schäfer macht A-Jugend-Training“.
Einige VfB-Spieler kamen mit Ihrem Training wohl nicht zurecht.
Schäfer: Es gab dort sechs ältere Spieler, die meinetwegen um ihre Bedeutung in der Mannschaft fürchteten. Und die Medien nahmen solche Informationen natürlich gerne auf, weil sie von der Methodik überhaupt keine Ahnung hatten.
Peter Neururer, Sie galten damals neben Christoph Daum als ein Lautsprecher unter den Trainern. Sie hatten nie höherklassig gespielt, waren Absolvent der Sportschule. Fühlten Sie sich von Trainern, die eine Vita als Bundesligaspieler hatten, belächelt?
Neururer: Christoph Daum und ich fingen etwa zeitgleich als Trainer an und zugegeben: Wir haben auf dem Medienklavier schon verdammt laut rumgehauen. Aber egal, was wir konnten oder nicht, in meinen ersten Jahren kam nur von Spielern die Frage: „Wo hast du denn früher gespielt?“ Aber unter den Trainerkollegen war das nie ein Thema.
Schäfer: Udo Lattek hat auch nie höherklassig gespielt, obwohl er ein guter Fußballer war.
Neururer: Ich war auch ein guter Spieler, habe nur in den falschen Ligen gekickt (lacht).
Schäfer: Für einen Trainer ist es sehr entscheidend, in was für einen Verein er kommt. Wenn der Klub Ambitionen hat und die Spieler bereit sind, sich diesen unterzuordnen, ist es für den Coach erheblich einfacher.
Welche Anlagen muss ein guter Spieler mitbringen?
Schäfer: Er muss den absoluten Willen haben. Ich weiß noch, wie Oliver Kreuzer vom FC Bayern umworben wurde. Ich habe ihm gesagt: „Wenn du dahin gehst, kann ich dir nur einen Rat geben: Hau erst mal den Klaus Augenthaler auf die Aschenbahn.“ Fragt der: „Warum das denn?“ „Weil die Bayern Meister werden wollen, die brauchen also Führungsspieler und keine Mitläufer. Gut möglich, dass Augenthaler dich dann auch umhaut, aber er weiß wenigstens, dass er mit dir Meister werden kann.“
Peter Neururer, Sie haben allein in den Neunzigern sechs Profiteams trainiert. Welchen Job bereuen Sie im Nachhinein?
Neururer: Ich hätte nie zu Hertha gehen dürfen. Der Klub war pleite und die Spieler waren nicht mehr in der Lage, die Liga zu erhalten. Aber ich kannte Leute wie Walter Junghans von früher und dachte, es könnte klappen. Einen Tag vor Vertragsunterzeichnung ließ ich den Kader antreten. Vier Leistungsträger kamen auf Krücken. Da sagt der Manager: „Mach dir keine Sorgen, die sind Samstag wieder fit.“ Vollkommener Unsinn. Nach dem Training rief ich meine Frau an und sagte: „Schatz, ich komm wieder nach Hause, der Klub ist tot.“
Aber Sie sind doch nicht gefahren.
Neururer: Weil ich es mir im Wahn in den Kopf gesetzt hatte, schneller als Schalke 04 in der ersten Liga zu sein. Die spielten damals noch zweitklassig, und Präsident Günter Eichberg hatte mich ohne Angabe von Gründen entlassen, obwohl wir punktgleich mit dem Tabellenführer waren. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also habe ich in Berlin unterschrieben. Und ich bin froh, dass Friedhelm Funkel gerade wieder in die Spur kommt, sonst wäre mein Rekord ernsthaft in Gefahr geraten.
Welcher Rekord?
Neururer: Der erfolgloseste Trainer in der Geschichte der Hertha zu sein (lacht).
Schäfer: Aber so ist es nun mal: Wenn man ein Angebot aus der ersten Liga hat, muss man unterschreiben. So schwierig die Situation auch ist.
In Ihrer Hertha-Mannschaft spielte auch Uwe Rahn. Der Spieler mit der kürzesten Halbwertzeit eines Stars in der Bundesligageschichte. 1987 war er „Fußballer des Jahres“, dann stürzte er ab.
Neururer: Rahn war einer, der seine Fähigkeiten leider fast immer in ein falsches Umfeld eingebettet hat. Wenn der bei Bayern oder Borussia Dortmund gespielt hätte, und nicht bei Hertha oder dem 1. FC Köln, hätte er wahrscheinlich noch sechs, sieben Jahre auf höchstem Niveau gekickt. Allerdings neigte Uwe Rahn auch dazu, sehr intensiv Schmerz zu empfinden.
Was meinen Sie damit?
Neururer: Der setzte auch mal aus, wenn ihm ein Fußnagel eingewachsen war.
Schäfer: Jupp Heynckes hat Lothar Matthäus und Rahn zur gleichen Zeit entdeckt. Rahn war sein Liebling, weil er so eine lässige Art hatte, Tore zu erzielen. Er stammte aus dieser Gladbacher Generation, die nach Bertis Abschied das Sagen hatte. Vielen von denen fehlte das entscheidende Quäntchen Ehrgeiz.
Darüber konnten Sie sich beim jungen Oliver Kahn nicht beschweren.
Schäfer: Es reichte schon, dass der Olli seinen Gegner nur anschaute, dann kriegte der keine Flanke mehr zustande. Was den Ehrgeiz betrifft, hätte er gut in die Gladbacher Mannschaft der Siebziger gepasst. Seine Mentalität war alles andere als typisch für einen Badener.
Es geht die Mär, Kahns Vorgänger im KSC-Tor, Alexander Famulla, wollte ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mit ihm im Doppelzimmer schlafen, weil er fürchtete, der spätere Titan würde ihm das Kissen ins Gesicht drücken.
Neururer: Unter Torhütern völlig normal: Werner Vollack fürchtete als Schalker auch, dass ihn sein zweiter Mann, ein Herr namens Jens Lehmann, umbringt. Der hat das genau so gesagt: „Der will mich umbringen, der will mich umbringen, aber ich bin doch die Nummer eins.“
Schäfer: Olli war schon als Jugendlicher enorm laut auf dem Platz, der war regelrecht überehrgeizig. Ständig hing er in der Muckibude ab. Das musste ich dem irgendwann verbieten, weil er sonst nicht mehr aufgehört hätte.
„Bravo Sport“ machte ab 1994 Spieler zu Pop-Ikonen. Wie wirkte sich das auf die Kicker aus?
Neururer: Plötzlich kamen massenweise Leute zum Training. Das machte einige Kicker natürlich resistenter gegen Meinungen von außen. Der eine oder andere wurde auch resistenter gegen Aussagen des Trainers.
Mehmet Scholl galt als einer der ersten Popstars des deutschen Fußballs überhaupt.
Schäfer: Kaum zu glauben. Mehmet habe ich in einem Spiel ein- und wieder ausgewechselt. In Hamburg kam er rein, stand frierend und mit den Ärmeln über den Händen auf dem Platz, da habe ich ihn gleich wieder rausgenommen. Heute sagt er: „Das war das Beste, was mir passieren konnte.“ Schauen Sie sich nur die Karrieren von Mehmet und Lars Ricken an. Beide waren gleichauf – und was wurde aus ihnen? Mehmet wurde unter dem Manager Uli Hoeneß Europameister. Und Lars Ricken?
Mit der ganz großen Karriere hat es bei Scholl aber nicht geklappt.
Schäfer: Er hätte zum FC Barcelona wechseln können. Johan Cruyff wollte ihn haben, aber Franz Beckenbauer wollte ihn nicht gehen lassen. Ein Spielertyp wie Mehmet in Barcelona unter Cruyff – der wäre einer der ganz Großen geworden. Er wird beleidigt sein, wenn er das hört, aber es ist die Wahrheit.
Hat sich der Spielertypus seit Anfang der Neunziger verändert?
Neururer: Ich weiß noch, wie in Köln ein damaliger Jugendnationalspieler mit dem Porsche vorfuhr. Der hatte noch kein Spiel für uns gemacht. Unser Hauptsponsor war zwar ein Autohersteller, aber in dem Wagen schickte ich den Jungen erst mal wieder nach Hause. Sowas gäbe es heute so nicht mehr. Solche Dinge würden sich die Spieler heute nicht mehr erlauben, weil sie wissen, dass die Medien auf so was nur warten.
Wie hat sich die Mentalität der Aktiven sonst noch geändert?
Neururer: Früher hat kein Spieler im Bus Kopfhörer aufgehabt, da gab es kein „Jeder-für-sich“. Die haben Karten gespielt. Und abends gab es auch noch mal ein, zwei Bier auf dem Zimmer, ohne dass der Trainer etwas davon mitbekam. Heute ist alles nur noch Hightech – Gespräche untereinander gibt es nicht mehr.
Welche Veränderungen hat auch das Bosman-Urteil verursacht?
Neururer: Damit zerbrach unser Konstrukt von Fußball. Die Spieler bekamen eine Macht, die es ihnen erlaubte, sich schon nach neuen Klubs umzusehen, wenn sie nur drei Mal nicht eingesetzt worden waren. Auch wenn das Urteil arbeitsrechtlich natürlich vollkommen in Ordnung ist.
Auch die Identifikation mit dem Verein hat gelitten. Fußballer stehen heute nur noch in Ausnahmefällen für einen konkreten Klub.
Neururer: Dass ein Holländer wie Mark van Bommel Mannschaftskapitän der Bayern wird, wäre vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen. Nicht falsch verstehen: Multi-Kulti ist herrlich, aber unser Vorteil als Trainer damals war eindeutig, dass wir den Jungs noch sagen konnten: „Schaut mal auf das Wappen an eurer Brust.“ Die wussten alle, was der „Geißbock“ oder „S 04“ bedeuten. Diese Form der Identifikation gibt es nicht mehr.
Schäfer: Günter Netzer sagte, er könne es nicht mehr ertragen, wenn Spieler nach einem Torerfolg das Wappen auf ihrem Trikot küssen. Da gebe ich ihm Recht. Es schwingt immer ein bisschen Heuchelei mit.

















![Warum die Google Search Console eines der wichtigsten Relaunch-Werkzeuge ist [Search Camp 368]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/02/Search-Camp-Canva-368.png)
![SEO-Monatsrückblick März 2025: Google AIO in DE, AI Mode, LLMs + mehr [Search Camp 369]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/03/Search-Camp-Canva-369.png)